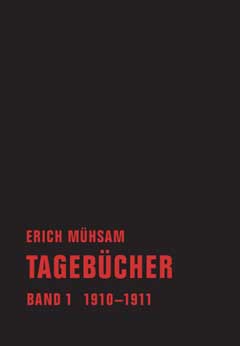V.
7. Mai – 28. Juli 1911.
S. 579 – 723
München, Sonntag, d. 7. Mai 1911.
Der elende Tripper! Ununterbrochen macht er sich bemerkbar, stört mich in meinen Absichten, lähmt meine Aktionen, vergiftet meine Laune. Nun laboriere ich seit 3 Wochen dran, und noch merke ich fast garkeine Besserung. Morgen will ich noch einmal zu Hauschild. Ich muß der Schweinerei endlich energisch zu Leibe gehn. – Gestern abend war es wieder gräßlich. Emmy war im Café – ich hatte vorher im Luitpold Eduard Joël und Frau getroffen –; sie war sichtlich geil auf mich und bat mich, ich möchte sie, ehe ich in die Torggelstube gehe, heimbegleiten. Ich tat das, ging mit hinauf zu ihr ins Atelier, und regte mich an ihren Küssen furchtbar auf. Dann zog sie sich um, und ich sah sie nackt, was mich so toll machte, daß ich vor Schmerz und Wollust hätte schreien mögen. Das enge Suspensorium wäre unter dem Druck des mächtig gestrafften Gliedes beinahe gerissen. Wir waren beide sehr betrübt, daß wir nicht tun konnten, worauf wir beide brannten. – Genau dieselbe Geschichte wie vor 5 Jahren in Wien, wo ich nackt neben der ebenfalls geschlechtskranken Irma Karczewska lag. Wir küßten uns wie wahnsinnig und mühten uns, wenigstens mit Mund und Fingern einander genüge zu tun, aber schließlich war der Widerstand des Schmerzes doch immer noch größer als der Antrieb der Lust. Das war damals die Tragik: daß wir uns erst kennen gelernt hatten und dann bald auseinandergingen, sodaß wir nie dazu kamen, einen richtigen Koitus miteinander zu vollziehen.
Schon nachmittags war ich bei Emmy gewesen. Morax und Frl. Vital waren da, und ich zeichnete einen Bilderbogen zu der Schauerballade, die Emmy und Morax zusammen bei Kati vortragen wollen. Es sind sehr lustige Bilder geworden, die Emmy sehr primitiv und dadurch umso wirksamer antuschte. – Eduard Joël ist ein netter Kerl. Aber unsere Interessen gehn doch allmählich weit auseinander, und ich kann nicht leugnen, daß ich seine Gesellschaft umso mehr schätze, je deutlicher mir die Möglichkeit scheint, von ihm Geld für den „Kain“ herauszuschinden. Angebohrt habe ich schon. Heute nachmittag werde ich wieder mit dem Ehepaar beisammen sein. Ob etwas herausschauen wird?
Nach dem Intermezzo in Emmys Atelier begleitete ich sie bis vor den „Simpl“. Das süße Ding trug auf dem ganzen Wege Leuchter und Kerze in der Hand, damit sie auf dem Heimweg die Treppen hinauffinde, zumal sie die Nacht Engert versprochen hatte. Sie erzählte mir das ganz arglos und mit vielem Bedauern darüber, daß ich nicht imstande bin, meine Pflicht zu tun. Sie könne unmöglich so lange allein schlafen. Daß es grade Engert sein sollte, war mir sehr fatal. Aber wer will den Weibern ihren Geschmack vorschreiben?
Dann also Torggelstube: Im Residenztheater war die Premiere der „Ratten“ von Hauptmann gewesen, dazu Sonnabend, wo die Halbe-Gesellschaft erschien. So saß also eine lange Tafelrunde versammelt: Halbe und Frau, Waldau, Mi von Hagen, Steinrück, Dr. Mannheimer, das Mockerl, Lina Woiwode, Basil, Dr. Kutscher, Rößler u.s.w., wozu dann noch Wedekind und schließlich Feuchtwanger und Dr. Uhde-Berneis kamen. Es wurde reichlich Bowle getrunken. Ich hatte das Zusehn und mußte allerlei schlechte Witze deswegen ertragen. – Wir schrieben eine Glückwunschkarte zu dem Erfolg der „Ratten“ an Gerhart Hauptmann. Die Terwin war wieder sehr lieb. Der Rest der Gesellschaft blieb bis nach ½ 4 Uhr nachts. Dann trennten wir uns. Gustel Waldau und besonders Steinrück waren stockbesoffen. – Übrigens waren auch Edgar und seine Frau Fritzi Schaffer dabei. Ich nahm, um mich nicht anzustrengen, ein Auto zur Heimfahrt. – Sehr bemerkenswert schien mir ein Gespräch zwischen Wedekind und Halbe. Wir sprachen über die Schauspielhaus-Aufführung von „Mutter Erde“. Wedekind meinte, das sei ein Stück, das durchaus in das ständige Repertoire der deutschen Theater gehöre. Es gebe noch manche solche Dramen, die ganz zu Unrecht abgesetzt seien. Er dachte dabei offenbar auch an eigne, nannte aber als Beispiel Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“. Wedekind schlug Halbe nun eine gemeinsame Protest-Aktion vor. Die beiden Herren sezessionierten sich dann und berieten darüber. Aus dem, was sie nachher einander sagten, ging mir hervor, daß beide gewillt sind, der Sache Realität zu geben. Natürlich Halbe nur zögernd, skeptisch und vielleicht nicht ganz gern, Wedekind stürmisch, unpolitisch, draufgängerisch. So werden sie sich vielleicht auf eine ganz gescheite Aktion einigen, und eines Tages wird das deutsche Publikum vor einer sehr verblüffenden Sensation stehn. Ich hatte Neigung, die Spalten des „Kain“ sogleich zur Verfügung zu stellen, fürchtete dann aber aufdringlich zu scheinen und schwieg.
Von Papa kam eine Ansichtskarte mit dem Holstentor drauf, in der er mir für die Gratulation zu seinem Examenstag und für die Zusendung der „Drucksache“ dankt und über seinen (recht günstigen) Gesundheitszustand berichtet. Meine Andeutungen, daß ich zur Fortführung des „Kain“ Geld brauche, hat er nicht verstanden. Außer andren Briefen einer von einem anonymen „Freund“, der die erste Nummer „passabel“ fand, über die zweite schimpft und mich warnt, das Publikum zu ignorieren. Ob der Mann recht hat? Lion Feuchtwanger erklärte mir gestern genau das Gegenteil: die zweite Nummer habe ihm in jeder Hinsicht besser gefallen als die erste. Er lehnte das Programmgedicht „Kain“ entschieden ab.
Heute vormittag kam Rößler. Wir gingen dann ins Stefanie, ich seit einem Jahr zum ersten Mal. Wirt und Geschäftsführer begrüßten mich mit Händedruck, Kellner und Gäste mit staunendem Grinsen.
München, Montag, d. 8. Mai 1911.
Die „Ratten“ von Hauptmann sind ein wunderschönes Stück. Ich sah es gestern bei der zweiten Aufführung im Residenztheater. Frau von Hagen hatte für mich eingereicht, nachdem Steinrück es bei der Premiere verbummelt hatte. Vielleicht die beste Tragikomödie, die in deutscher Sprache geschrieben ist. Der Vorwurf selbst ist ungeheuer stark. Eine Frau, die sich nach einem Kind namenlos sehnt – ihr erstes ist gestorben – nimmt eines von einem polnischen Dienstmädchen in Pflege, täuscht es ihrem Mann, dem Maurerpolier John, der in Altona arbeitet, als eignes vor, und der meldet es beim Standesamt an. Pauline, die Polin, verlangt ihr Kind zurück. Konflikte. Das kranke Kind der Frau Knobbe wird von deren größerer Tochter Selma in der Johnschen Wohnung gehütet. In ihrer Angst giebt Frau John deren Kind an Pauline. Das kleine Knobbe-Kind stirbt, während sich die Mutter und Pauline drum streiten. Nun muß der Bruder der John, der verkommene Lude Bruno helfen. Er tut es gründlich, indem er Pauline umbringt. Zum Schluß kommt alles an den Tag. Mitten hinein spielt die Komödie der Familie eines Theaterdirektors. Das Durcheinander von Groteske und Tragödie ist wundervoll gestaltet. Jede Figur prächtig gelungen, dabei – bei einer Szene, wo der Direktor mit seinen Schülern die Braut von Messina studiert – eine wunderfeine, im Stück völlig begründete theoretische Kontroverse zwischen Klassizismus und Naturalismus. Das Berliner Milieu, Sprache, Charakter der Menschen – einer der schönsten Hauptmanns. Und es war eine erfreuliche Aufführung unter Basils Regie. Außer dem Theaterdirektor Höfers, der seiner Rolle viel schuldig blieb, und seinen Schülern – außer dem Spitta v. Jacobis –, die aber wenig zu bedeuten haben im Stück, war jede Figur – trotz mancher Schwäche – famos. Frl. Schwarz gab die John. Freilich: der Gedanke, daß die Rolle am Lessingtheater von Else Lehmann gespielt wird, kann einen wehmütig stimmen. Hier und da roch man die Regiebemerkung. Im großen und ganzen aber doch eine starke gute Leistung. Auch Basil als Maurerpolier John hatte vortreffliche Momente und überzeugte. Sehr stark war die Pauline der Terwin, die in Dialekt, Haltung, Gebärde und Wärme ganz auf der Höhe ihrer Aufgabe stand. Der Erich Spitta von B. v. Jacobi war sehr fein, viel schwächer seine Geliebte, die Walpurga von Frl. Neuhöfer. Schröders alter Pastor Spitta recht gut, ebenso die Frau des Theaterdirektors, die die Ramlo spielte. Ganz ausgezeichnet gefiel mir wieder das kleine Fräulein Pricken, die aus der Selma eine richtige Zillesche Nutte machte. Ihr Aeußeres war erstaunlich gut und auch im Spiel traf sie völlig die Berliner Jöhre. – Aber hoch über allen andern stand die Leistung Steinrücks als Bruno. Er hatte nur kurz auf der Bühne zu tun, aber während er da stand, ein Bild der Verkommenheit – mit dem gelinden Stich ins Sentimentale, das der Berliner Verbrecher zu cachieren sucht, schlug einem die Angst an den Hals. Es war eine schauspielerische Leistung von unheimlicher Wucht und Geschlossenheit. – In Berlin hat das Stück einen Mißerfolg gehabt. Hier ging das schlechteste Publikum mit, das am Residenztheater auszudenken ist, das Publikum der zweiten Aufführung, die noch dazu auf einen Sonntag fiel. Es muß schon an der Aufführung gelegen haben. Ich freue mich auch Fritz Basils wegen. Seine Regieführung ist ganz vorzüglich zu nennen.
Vorher war ich mit Joëls im Luitpold gewesen, hatte sie dann zu einem Spaziergang begleitet, und zu mir ins Zimmer geführt. Es kann nicht schaden, wenn den Lübeckern berichtet wird, daß ich einigermaßen wohne. Schließlich bearbeitete ich ihn, mit Julius zu sprechen, ob nicht Papa evtl. doch etwas Geld für den „Kain“ herausrücken möchte. Dann hätten sich die Stunden Bärenführerschaft ausgezahlt. Übrigens freute ich mich selbst des Wiedersehens.
Nach dem Theater „Simplizissimus“. Emmy hat ein Verhältnis mit dem kleinen Keller angefangen. Ich Esel habe die tolerantesten Prinzipien, dazu noch einen Tripper und war doch eifersüchtig. Natürlich ließ ich mir nicht das mindeste merken. Aber es ist doch eigentümlich, wie lieb ich das kleine Hurenweib habe. Sie trug mit Morax zusammen die schöne Ballade vom Räuber vor, der seinen Bruder abmurksen will, und an seiner „blassen Brust“ das Bild der Mutter findet. Der große Bilderbogen, den ich dazu gezeichnet habe, wirkte sehr lustig zu dem Leierkastenlied. Eine peinliche Überraschung wurde uns dadurch zuteil, daß die Ichenhäuser plötzlich mit Else Lasker-Schüler das Lokal betrat. Die eifersüchtige Megäre, die komplett wahnsinnig ist, hat Emmy in Berlin mit Schimpfreden und Drohungen nachgestellt. Nun war das arme Kind ganz verängstigt. Ich hoffe, sie fährt bald wieder ab. Es wäre recht widerwärtig, wenn Emmy wieder keine Ruhe vor ihr hätte. Ich bin aber entschlossen, trotz aller Freundlichkeiten der törichten Frau gegen mich und trotz meiner Verehrung für manche ihrer Gedichte, Emmy sehr energisch gegen sie zu verteidigen. – Heut nachmittag war Emmy bei mir. Sie erzählte, daß Keller bei ihr geschlafen habe. Wir gingen in den Englischen Garten, wo wir uns viel küßten, dann aß sie bei mir Mittag. – Danach ging ich zu Hauschildt, der sich meinen armen Schwanz besah. Er verulkte mich, daß ich in meinen Jahren noch solche „Kinderkrankheiten“ bekäme. Aber er fand, daß sich der Zustand wesentlich gebessert hat, empfahl mir die bisherige Behandlung energisch fortzusetzen und riet wieder sehr von Spritzen ab. Er stellte mir in Aussicht, daß ich in 14 Tagen gesund sein könne. Noch 14 Tage! Aber wenn nur dann die Geschichte vorüber ist!
München, Dienstag, d. 9. Mai 1911.
Pfempfert schickt mir die beiden letzten Nummern der „Aktion“, in denen die Enquete über Kerr fortgesetzt wird. Dehmel schreibt ganz dumm, Else Lasker-Schüler macht mindere Knittelverse, Kurtz spreizt sich, und die übrigen sind ziemlich belanglos. Ob Kerr viel Nutzen von der Umfrage haben wird? – Erfreulich war mir, daß das Blatt unaufgefordert eine ganz gut redigierte und ziemlich auffällige Annonce des „Kain“ bringt. Wüßte ich nur erst, wie Nr. 3 bezahlt werden soll! Roda Roda riet mir, ich solle Sobotka um 100 Mark anpumpen. Vielleicht tue ich es. Ich denke auch daran, das Tagebuch aus dem Gefängnis als Buch zu verkaufen und darauf Vorschuß zu nehmen. Vielleicht kommt der Verlag Eugen Rentsch in Frage, der von mir seinerzeit ein Buch herausgeben wollte, und bei dem jetzt Toni Maier in Stellung ist. – Ich war nachmittags im Café Stefanie gewesen, am Schachtisch, wo ich mit Roda Roda einige Partien spielte. Meyrink war da, Jodocus Schmitz, der Major Hoffmann, Professor v. Stieler und Nonnenbruch. Nach dem Abendbrot traf ich im Bauer Emmy mit Morax und Ida, Keller und Engert. Emmy war sehr aufgeregt, da gleichzeitig mit der Ichenhäuser die Else Lasker-Schüler in einer Ecke des Lokals saß. Das verängstigte Kind fürchtete Revolver und Vitriol. Mir fiel mal wieder die angenehme Aufgabe zu, zu parlamentieren. So setzte ich mich zu der Lasker und kam auf Umwegen zu dem Thema Emmy. Ich erreichte das Versprechen, sie werde während der Zeit ihres Münchner Aufenthalts nicht mehr den „Simpl“ betreten, noch Emmy im mindesten nahetreten. Als ich zu Emmys Tisch zurückkam, war sie grade dabei, einen Zustand zu kriegen. Ich begleitete sie mit Keller zusammen nach Hause und sie stieß schreckliche Drohungen gegen Elschen aus. Auch noch solche Geschichten!
Abends Torggelstube. Zuerst traf ich nur Eyssler dort, der mir mit seinen lispelnden, wienerisch-urnischen Vertraulichkeiten schauderhaft auf die Nerven ging. Ein Kretin. Er ging bald und ich blieb ziemlich lange allein. Dann kam Wedekind, der sich wegen seines Verhaltens neulich entschuldigte, als er mit seiner Frau plötzlich aufbrach. Er sei in einem Zustand schwerer Depression gewesen, zumal Messthaler ihn auf 1000 Mark Konventionalstrafe verklagt habe, weil er ein Engagement im Intimen Theater nicht innegehalten habe. Gespräche über die „Ratten“, die Wedekind ebenso hoch einschätzt wie ich, über Hauptmann im allgemeinen, über Herwarth Walden, über „Kain“ und Geldbeschaffungsmöglichkeiten. Ludwig Thoma erschien. Gespräche über Wolzogen, Überbrettl, Schönherr. Wedekind rückte plötzlich mit einem Anliegen heraus: er wolle eine Erklärung veröffentlichen, daß sein Stück „Oaha“ keine Personen treffen solle, sondern eine Satire auf Satiriker sein will. Wedekind war blaß, während er seine Sache vortrug. Thoma war einer von denen gewesen, die er in dem Stück so bös hergenommen hatte, und Thoma hatte dann im „Simplizissimus“ unheimlich grob geantwortet. So war es eine brenzliche Sache, von „Oaha“ zu sprechen. Thoma wich zuerst aus; dann meinte er, – wie mir schien, um einen Fühler auszustrecken, – Wedekind solle doch mit solcher Erklärung warten, bis einmal an die Aufführung des Stücks gegangen werde. Er hatte richtig geraten. Denn Wedekind bestätigte sogleich, daß er es im Laufe des Juli, da er wieder den ganzen Monat hindurch im „Schauspielhause“ gastieren wird, spielen wolle. Die Herren einigten sich dahin, daß Wedekind eine entsprechende Erklärung im „März“ publizieren soll. Thoma benutzte die Gelegenheit, zu erklären, daß er sowohl wie der verstorbene Albert Langen herzlich über Wedekinds „Oaha“-Grobheiten gelacht hätten. Wedekind selbst gab zu, in seiner Satire ungerecht gewesen zu sein und erzählte, wie er dazu gekommen sei, sie zu schreiben. Bei einem gelegentlichen Gespräch sei ihm die Idee gekommen, daß Satiriker selbst den besten Stoff für eine Satire abgeben könnten und da habe er eben den Kreis ausgesucht, der ihm am nächsten war. – Als Thoma gegangen war, unterhielt ich mich mit Wedekind noch über Mary Irber und Vallé. Vor 3 Uhr gingen wir miteinander fort.
Heut kam ein neuer Brief von Kätchen. Ihr geht es schlecht. Sie hat Schmerzen. Dazu kommt, daß sie auf der Straße gefallen ist und sich verletzt hat. Sie möchte sich wegen des Trippers behandeln lassen, hat aber garkein Geld. Sie rechnet auf meine Hilfe. Sie hat furchtbar viel Pech gehabt in der Zeit, seit wir beisammen waren, auch eine Engagement-Aussicht ist ihr in die Binsen gegangen. Wie soll ich ihr nur helfen? Mir stehn schon wieder schauderhafte Dalles-Tage bevor. Die D. M. Z. hat sich natürlich nicht gemeldet, und da ich in der letzten Woche den Beitrag verbummelt habe, habe ich auch noch nicht gemahnt. Ich werde Rößler bitten, für Kätchen ein Geldstück zu lockern. Aber ich selbst muß endlich wieder arbeiten. Da sitze ich und schreibe das Tagebuch voll, und meine wichtigsten Sachen bleiben liegen. Vor allem muß ich endlich für die „Schaubühne“ den Artikel über die Terwin schreiben!
München, Mittwoch, d. 10. Mai 1911.
Die Angelegenheit Else Lasker-Schüler – Emmy spitzt sich dramatisch zu. Ich erhielt einen langen Brief von Elschen, in dem sie Emmy als „geiles kleines Nähmädchen“ beschimpft, in deren Mund ihr „erlauchter“ Name (an einer andern Stelle „die Majestät meines Namens“ – immer dick unterstrichen) nichts zu tun habe, und worin sie schließlich erklärt, sie lasse sich das Betreten öffentlicher Lokale nicht verbieten. Ich hielt es für ratsam, diplomatisch zu sein und schrieb einen langen vorsichtigen Antwortbrief, von dem ich auch noch eine Abschrift nahm, sodaß mir wieder die Zeit, wo ich hätte arbeiten mögen, zum Teufel ging. Ich bat die Lasker, mir persönlich den Gefallen zu tun, den Simpl. zu meiden. Abends im Café kriegte ich dann einen weiteren albernen Brief, in dem u. a. stand, sie (Tino von Bagdad) habe in Berlin nur Emmy aus dem Café entfernt wissen wollen, um den einzigen Ort, wo man sich aufhalten könne, nicht verflachen und verhuren zu lassen. Im übrigen: „Bei Philippi sehn wir uns wieder.“ – Ich ging also mit in den „Simpl“, um bei eventuellem Krach Emmys Partei nehmen zu können. Aber Elschen kam nicht. Jedenfalls vermute ich, daß ihre Hysterie sie nicht ruhen lassen wird, bis nicht der Krach da war. Und wenn sie ihn nicht provoziert – Emmy ist auch nicht die Zahmste.
Nachmittags kam Rößler ins Café und dann zu mir zum Abendbrot. Auch Emmy erschien. Die beiden geilten sich aneinander auf, und nach dem Essen legte sich Rößler auf den Diwan und es begann ein Piacere, zu dem ich sittsam das Gaslicht ausdrehte. Da ich merkte, daß Emmy sich ganz auszog, und so schon wie auf Kohlen stand, da die Gruppe Tat auf mich wartete, ließ ich die beiden bald allein. – Es ist seltsam, daß ich auf den alten Rößler nicht eine Spur eifersüchtig bin. Die ganze Geschichte gestern machte mir einen diebischen Spaß. Ich mußte über Emmys unbefangene Selbstverständlichkeit sehr lachen. Sie ist schon ein erotisches Genie. Sie will immer und jeder Mann und jede Situation ist ihr recht.
Mittags im Hofgarten hatte ich Uli und Lotte getroffen. Ich konstatierte mit vielem Schmerz, daß doch eine rechte Entfremdung zwischen uns eingetreten ist. Besonders Lotte sagte mir Bosheiten, die kaum mehr freundschaftlich zu deuten sind. Es wäre sehr schade, wenn das Puma in der Dauerehe mit Strich völlig verbürgerte. Ulis Naturell läßt die Entwicklung zum Glück nicht befürchten.
Heut schreiben wir den 10. Mai. Mit Arbeiten und Correspondenz bin ich ganz zurück. Mir graut, wenn ich mich meiner Pflichten erinnere.
München, Donnerstag, d. 11. Mai 1911.
Gestern abend, als ich mit Halbe und Genossen von der Kegelbahn aus zu Kathi Kobus kam, saß Elschen Lasker mit der Ichenhäuser richtig im Lokal. Emmy hatte sie vorher nicht bemerkt, bekam jetzt aber, als sie die Frau sah, wieder richtige Zustände der Todesangst, sodaß wir schleunigst aufbrachen und in ziemlich großer Gesellschaft ins Stefanie gingen. Ich schrieb der Lasker von dort aus einen Brief, in dem ich ihr erklärte, ich sehe in ihrem Verhalten einen Akt der Geringschätzigkeit gegen mich und betrachte daher unsere freundschaftliche Beziehung als erledigt.
München, Freitag, d. 12. Mai 1911.
Emmy unterbrach mich gestern mittag im Schreiben. Es war auch nicht allzu wichtig, was ich hätte notieren können. Auch der Bericht über den gestrigen Tag kann kurz ausfallen. Das Erfreulichste war, daß ich endlich den Terwin-Artikel geschrieben und abgeschickt habe. Wenn Jacobsohn nur rasch Geld schicken möchte. Es wird ja nur sehr wenig werden, aber ich bin schon fast ganz pleite. Ein paar Mark hoffe ich noch von Fuhrmann zu kriegen. Und heute muß ich unbedingt wieder was an das Montagsblatt schicken, um gleichzeitig mahnen zu können. Ich habe große Angst, daß es vergeblich sein wird. Die 6 Mark, die ich vorgestern an Kätchen schickte, machen sich schwer fühlbar. Dabei bittet auch Johannes wieder um Geld. Aber ich kann ihm diesmal wirklich nicht helfen.
Heut ist Friedels Geburtstag. Sie wird 35 Jahre alt. Ich schrieb ihr einen kurzen herzlichen Brief und legte mein letztes Gedicht bei. („Sehr traurig und bedrückt ist mein Gemüt“). Ich liebe die Frau über jeden Begriff. Jeden Tag frage ich mich: werde ich durch sie noch einmal glücklich sein? – Wenn ich Geld hätte! – Bei einer unserer letzten Begegnungen fragte ich sie, ob sie, wenn ich über die nötigen Mittel verfügte, mitkomme nach Frankreich. Da meinte sie lächelnd: „Parce que si, parce que non!“ – Es ist sehr widerlich, alle Hoffnung immer wieder auf die Arterienverkalkung des Vaters setzen zu müssen.
Gestern abend war ich im „Simpl.“ (Elschen Lasker ließ gestern nichts von sich hören oder sehn). Michel, mit dem ich nachmittags im Stefanie schon Billard gespielt hatte, war da mit Leo Greiner. Emmy war sehr niedlich und ganz verrückt auf den Schauspieler Schwirzer, den sie dann auch wohl mit nach Hause genommen hat. Ich muß schon noch zurückstehn. Allerdings hoffe ich: nicht mehr allzu lange. Heut früh war ich so aufgeregt, daß ich trotz meines Zustands onanierte, was ziemlich schmerzlos vonstatten ging. Mir ist dieser Tripper schon elend über.
Auf die Annoncen meiner Bücher im „Kain“ sind zwei Bestellungen auf je 1 „Wüste“ und „Krater“ eingetroffen. Etwelche Lyriker senden mir fürchterliche Verse zum Abdruck ohne im geringsten sich an der Notiz, „Mitarbeiter dankend verbeten“ zu stoßen. Ja, wenn die Seele glüht! – Der Verlag Eugen Diederich in Jena schickt mir im Auftrag des Pfarrers Vogel dessen 1908 erschienenes Buch „Der moderne Mensch in Luther“. Es wird wohl noch eine Weile auf die Durchstudierung warten müssen.
München, Sonnabend, d. 13. Mai 1911.
Bleibt einmal ein Tag unausgefüllt, dann fallen mir doch nachher so allerlei Dinge ein, die für den Moment interessant genug waren, um sie zu notieren. Und was über den Moment hinaus Interesse behalten wird, läßt sich ja heute doch noch lange nicht übersehn. So will ich doch noch einiges aus den letzten Tagen nachtragen. – Da war ein Mann bei mir, der sich als der Schriftsteller Singer vorstellte. Er erklärte, er wolle auch eine Zeitschrift gründen und möchte von mir wissen, was an Kapital dazu nötig sei und wie man die Sache überhaupt anfange. Ich schenkte ihm über die finanziellen Unterlagen des „Kain“ reinen Wein ein und gab ihm beide Nummern mit. Der Mann versprach, mir die Adresse eines Versicherungsonkels zu schreiben, der evtl. ein paar tausend Mark auf das Blatt pumpen würde. Bis jetzt habe ich keine Botschaft gekriegt. Ich hatte ein wenig das Gefühl, ich sollte ausgefragt werden, und ich bin auch heute noch nicht im klaren darüber, ob ich nicht den Besuch eines Spitzels hatte. Allerdings beobachtete ich den Mann, als er fortging, vom Fenster aus und sah, wie er mit den gelben Kainheften in der Hand lebhaft gestikulierte und Selbstgespräche führte. Möglicherweise spinnt der Kerl blos. – Ferner ist ein merkwürdiger Brief zu erwähnen. In Nr. 2 des „Kain“ hatte ich Frau Scharfs Übersetzung von Paul de Kocks „Mädchen mit den drei Unterröcken“ rezensiert. Jetzt kam ein eingeschriebener Brief von Dr. R. Douglas, dem Verleger des Buches, mit dem meine Freundschaft dazumal mit Ohrfeigen endete, die ich bekam, weil ich die 100 Mark Vorschuß nicht wieder herausrücken wollte, die ich für meine Lektortätigkeit an dem Verlag bekommen hatte. Die von mir acquirierten Autoren Scheerbart und Przybyszewsky waren dem Ehepaar Douglas-Andree nicht wertvoll genug, und so legte ich meine Tätigkeit nieder. – Jetzt schreibt mir dieser Herr, er habe nicht blos (wie ich tadelnd vermerkt hatte) das Buch mit dem „neckischen“ Vorwort versehn, sondern selbst Verbesserungen der Übersetzung vorgenommen und stellenweise die Übertragung überhaupt erst in eine Form gebracht, die die Veröffentlichung möglich machte. „Stets zu Ihren Diensten“ schließt er das anmutige Schreiben, das natürlich bestimmt ist, Frau Scharf zu Gesicht zu bekommen. Ich habe es ihr geschickt. Doch war es gestern noch nicht angekommen. Es wäre fatal, wenn es verloren gegangen wäre.
Gestern traf ich den Schwabinger Buchhändler Steincke, der mich ansprach und mir erzählte, er habe von Nr 1 etwa 30, von Nr 2 etwa 50 Expl. „Kain“ verkauft. Das Publikum sei sehr damit zufrieden. Außerdem sprach mich im Hofgarten ein Herr Böhm an, der sich erbot, für 4–500 Mark Inserate zu beschaffen. Ich verwies ihn an Toni Meier.
Dr. Kutscher hatte mich zu gestern abend in sein Seminar-Kolleg eingeladen, da dort ein Student, namens Schulz, einen Vortrag über den Spielplan der Volksbühnen halte. Er hatte den jungen Mann an mich empfohlen, damit ich aus meiner Praxis Material zur Verfügung stelle. Herr Schulz war aber nicht gekommen. Der Vortrag war recht interessant. Ein sehr kluger junger Mensch hatte kolossal aus allem, worüber er mal nachgedacht hatte, aufgepackt und brillierte mit mancherlei draufgängerischen Bekenntnissen. Es war viel Gutes in dem, was er sagte, auch viel Trocknes, Totes, Gemeinplätzliches, und nebenher manches Verkehrte. So beurteilte er die Psyche des Volkes ganz falsch. Es ist der große Fehler fast aller derer, die sich berufen glauben, Volkserzieher zu sein, daß sie meinen, man müsse ganz leichte Kost für die Menge auswählen und solche, die inhaltlich ihr Interesse berühren. Ich habe beobachtet, daß das sogenannte niedere Volk, sofern es noch nicht kleinbürgerlich verfault ist, sehr bereit ist, schwierigen Gedankengängen nachzugehn. Man kann den Arbeitern viel differenziertere geistige Anstrengung zumuten, als dem bürgerlichen Zeitungsleser, der alles sehr schön tranchiert, zergliedert und womöglich vorgekaut serviert haben möchte. Speziell in der Kunst ist es ganz falsch anzunehmen, daß dem einfachen Menschen Tendenz vorgesetzt werden muß. Im Gegenteil: eine reine schöne Stimmung findet in den unverdorbenen Herzen derer, die noch nicht völlig in Geschäftsspekulationen aufgehn, die willigste Resonanz. – Ich habe darüber nachher mit Herrn Schulz ausführlicher gesprochen, ihm auch erzählt, wie glücklich meine Kunden und Sollergäste waren, als sie sich einmal auf meinen Rat im Volkstheater „Carmen“ angesehn hatten.
Im Anschluß an Schulz’ Vortrag sprach Kutscher über Freilicht-Theater (mit Lichtbildern). Er fing mit Wachlers Versuch auf dem Hexentanzplatz an. Von unserem Peter Hille-Waldspiel in Schlachtensee (1903) wußte er nichts. Als ich ihm nachher davon sprach, war er sehr überrascht und notierte sich einiges. So wird der naive Versuch doch wohl noch zu seiner historischen Eingliederung kommen.
Abends war ich dann noch im Hotel Union, wo nach dem Seminar in gewissen Zeitabständen die sogenannte „Kutscherkneipe“ stattzufinden pflegt, wobei eine literarische Persönlichkeit als Vortragender mitwirkt. Gestern las Wedekind seinen „Totentanz“ vor. Er leitete die Vorlesung mit ein paar Worten ein, die in ihrer Unbeholfenheit recht sympathisch wirkten. W. beschwerte sich bitter über die Polizei, die ihm die Aufführung und selbst die öffentliche Rezitation des Werks unmöglich mache. Was er über den Inhalt selbst sagte, war nur geeignet, zu verwirren. Er behauptete, sich den Casti Piani als Mephisto vorgestellt zu haben, und es habe ihm gereizt, den sterben zu lassen. So ein Blödsinn! Es ist schon komisch, daß die besten Künstler, sobald sie ihre Werke erklären wollen, immer ins Quatschen geraten. – Die Vorlesung selbst war sehr schön. Ich liebe das Stück ganz besonders, und ich möchte es mir gern als Vorbild nehmen für meinen Wunsch, handelnd, kämpfend zu theoretisieren. Wundervoll ist der Gedanke, das Liebespaar in Versen sprechen zu lassen. Dadurch wird der Vorwurf der Übertreibung in der Gestalt der Hure von vornherein abgeschnitten. – Nachher dankte Kutscher in denkbar tölpelhaftester Privatdozentenmanier für Wedekinds Bemühung. B. v. Jacobi und Frau waren da. Frau Lucie meinte zu Wedekind: „Ja, aber die Elfriede kann ich nicht verstehn!“ – Sie erhielt die Antwort: „Da gratuliere ich Ihnen, gnädige Frau!“ ...
Als ich einmal den Lokus aufsuchte, kam mir einer von den Studenten nach, derselbe peinliche Kerl, der vor Monaten, als ich – am Tage von Emmys Ankunft – im „Gambrinus“ sprach – mit seiner Kastratenstimme die saudumme Rede gehalten hatte (der „Individualist bis ins dritte und vierte Glied“), und entschuldigte sich mit tiefen Verbeugungen. Ich war gnädig. – Gegen ½ 12 Uhr ging ich dann noch in die Torggelstube. Die Gesellschaft (Eyssler, Muhr, Strauß) ging bald. Ich blieb allein und verzog mich gegen ½ 1 Uhr in den „Simpl.“, wo ich zu meinem Bedauern erfuhr, daß Mary Irber dagewesen und schon weg sei. Als Emmy mit ihren Vorträgen fertig war, begleitete ich sie und Schwirzer noch und kam gegen 2 Uhr nach Hause.
Pierre Ramus, Wien, schickt mir die Jahrbücher der „Freien Generation“ von 1910 und 1911 und die letzte Nummer des „Wohlstands für Alle“.
München, Sonntag, d. 14. Mai 1911.
Ich bin erst wieder um 1 Uhr aufgestanden, obwohl das herrlichste Wetter ist. Der Tripper lähmt mich vollständig. Vielleicht ist ja das lange Im Bett Liegen gut, denn Hauschild hat mir in erster Linie Ruhe verordnet. Aber im Laufe des Tages laufe ich ja doch wieder viel zu viel herum und strenge mich bei allen möglichen Dingen überflüssig an. – Heut wäre ich vielleicht früher aufgestanden. Aber um 11 Uhr kam Herr Otto Singer an, um mir die Adresse des Versicherungsagenten zu bringen, den er mir zum Anpumpen empfohlen hat. Der Mann blieb geschlagene 2 Stunden sitzen. Mein Verdacht, daß er Spitzel sein könnte, ist unbedingt falsch. Er war lange in Rom und erzählte von dem versoffenen Dr. Sydow, mit dem er dort zusammen war, ferner von Fritz Klein und Ehrhardt, die dort – wie in Ascona – den Deutschen den Kredit verdorben hätten. Der Herr war mir heute ganz sympathisch. Aeußerlich erinnert er an Meßthaler. Er scheint aber ein sehr anständiger Mensch zu sein. Sein unruhiges Auge deutet auf schwere Neurasthenie oder Anlage zur Geisteskrankheit.
Gestern suchte mich der Herr Boéhm (nicht Böhm), der mich vorgestern im Hofgarten angesprochen hatte, im Café Bauer auf. Er ist bei Toni Meier gewesen, und der hat erklärt, daß er sich nicht mehr viel um „Kain“ kümmern kann. Nun will Boéhm den Kram übernehmen. Zunächst will er nach Inseratenagenten annoncieren. Hoffentlich falle ich mit dem Menschen nicht herein. Geld darf er mir jedenfalls nicht verwalten. Ich bin sehr neugierig, wie sich die Sache anlassen wird.
Nach Tisch war ich wieder mit Lotte und Uli im Hofgarten zusammen, die viel netter waren als vorgestern. Zuerst waren noch Seewald, Strich und der Zeichner Bolz dabei. Die beiden Mädels haben eine schreckliche Angst vor dem Dickwerden, und das Puma neigt wirklich dazu. Ich mußte mit ihnen zur Automatenwage des Café Luitpold gehn, die sie, weil sie zu hohes Gewicht anzeigte, als unzuverlässig ablehnten. Uli erzählte mir aus Ascona eine köstliche Geschichte: Lotte hatte ein Gewicht von 118 Pfund konstatiert, und war vor Verzweiflung darüber tagelang unsichtbar. Als Uli endlich zu ihr ging, stand sie nackt im Zimmer und maß mit einem Zentimetermaß den Bauchumfang. Schließlich stellte sich heraus, das die Wage 6 Pfund zugelogen hatte und Uli forderte und erhielt für jedes Pfund 1 Franken Freudengeld.
Die Lasker-Schüler-Geschichte nimmt allmählich die Formen einer komischen Groteske an. Meinen Brief, in dem ich ihr die Freundschaft kündigte, schickte sie mir zerrissen zurück, mit der Aufschrift, sie verbitte sich strengstens (dick unterstrichen) jede weitere Belästigung. Morax übergab mir die Fetzen und bestellte mir zugleich die spätere Mitteilung der Dame an mich, sie habe es nicht so gemeint. Und nun beteiligt sich auch die Ichenhäuser – Emmy nennt sie unhöflich Frl. Siechenhäuser – an der Korrespondenz. Gestern bekam ich einen total verstiegenen Brief von ihr. Wenn ihr Diener Jehovah ermittle, daß ich ein Hurerich sei, so müsse ich Millionen Meilen weit von ihrem Lande fortgehn. Scheißtrommel! – Inzwischen hat Emmy selbständig Schritte unternommen, um die Dichterin Tino loszuwerden. Sie hat veranlaßt, daß ihr von Berlin aus ein Telegramm ins Café Bauer geschickt wurde, wonach sie sofort nachhause zurückkommen möge. Natürlich ist sie darauf nicht hereingefallen und hat angeblich das ganze Material der Polizei übergeben. Wenn das wahr ist, wäre sie als Käsehändlerin entlarvt. Die Zeit ihres Münchner Aufenthalts kann immerhin noch recht unterhaltende Intermezzi bringen.
München, Montag, d. 15. Mai 1911.
Heut abend gehe ich in die Uraufführung von Dauthendeys „Spielereien einer Kaiserin“. Ein Freibillet habe ich nicht kriegen können, da der Neue Verein, der die Geschichte veranstaltet, die Auswahl der in sehr beschränkter Zahl bewilligten Freikarten dem Presseverein überlassen hat, der mich selbstverständlich ablehnt. Nun wollte ich trotzdem aus meinem Dalles drei Mark anwenden. Als ich aber zu Schmidts Konzertbüro kam, stellte sich heraus, daß der billigste noch freie Platz 6 Mk 20 kostet. Zum Glück war Victor Mannheimer grade dort, der sich erbot, die fehlenden 3 Mk für mich zu zahlen. Ich freue mich sehr auf die Aufführung. Die Durieux spielt die Hauptrolle.
Aber nun bin ich ganz pleite, zumal ich eben auch noch gebadet habe, was jetzt wöchentlich 3–4 Mark verschlingt. Ich will jetzt sofort zu Fuhrmann und versuchen, ob ich ein Goldstück von ihm heraushole. Die Deutschen Montags-Schweine haben selbstredend nichts von sich hören lassen.
München, Dienstag, d. 16. Mai 1911.
Von Fuhrmann bekam ich 19 Mk 50 und den Auftrag, über die Vorstellung des Neuen Vereins für den „Komet“ zu schreiben. Ich werde sie sehr rühmen können. Die „Spielereien einer Kaiserin“ sind eine sehr schöne Dichtung, wenn auch eigentlich kein Drama: Bilder aus dem Leben Katharinas I. von Rußland. Prachtvolle Verse (Jamben), eine sehr reiche Sprache, starke Charakteristik der Kaiserin und der andern Figuren. Die Durieux war fabelhaft. Es ist undenkbar, sich die Figur Katharinas besser gestaltet zu denken. Eine Leidenschaft in Wort und Gebärde, die unerhört war, dabei von strahlender Schönheit. Diese Frau hat sich allmählich zu einer Künstlerin entwickelt, neben der alle andern völlig verschwinden. Die Eysoldt hat wohl noch mehr eigentliche Genialität, nicht aber diese überlegte Kraft, vor allem nicht die äußeren Wirkungsmittel, die die Durieux raffiniert bändigt. (Trotz allem: meine Liebe gehört der Eysoldt. Die Durieux verehre und bewundere ich). Ihr Partner, Steinrück als Feldmarschall Menschikoff, versagte gestern leider vielfach. Er stand garnicht auf seiner sonstigen Höhe. Ob das nur damit zusammenhing, daß er seine Rolle nicht genügend studiert hatte, oder ob sie ihm nicht lag, entscheide ich nicht. Er hatte große, prächtige Momente, aber eben blos Momente, und oft genug war es qualvoll, ihn agieren zu sehn. Dagegen war Basil als Peter I. sehr gut, und vorzüglich das Mockerl, das die Zofe Katharinas, Sascha, zu spielen hatte. Auf dem Zettel stand die Nicoletti, aber wenn ich auch nichts vorher gehört hätte, im ersten Moment hätte ich die Terwin erkannt, die nun zum ersten Mal neben der großen Durieux auf der Bühne stehn durfte. Sie machte ihre Sache ausgezeichnet. (Heute schickt mir Jacobsohn meinen Artikel über Johanna Terwin zurück. Ich bin wütend, und vor dem Mockerl ist mir die Sache schrecklich unangenehm. Auch der Geldausfall ist peinlich). Nach dem Theater Torggelstube. Der Tisch war wieder voll besetzt, sodaß leider die wichtigsten Persönlichkeiten, die etwas später kamen, keinen Platz mehr fanden. Wedekinds, die Durieux u.s.w. saßen draußen. Dauthendey war zuerst bei uns, wurde dann aber hinübergeholt, ebenso das Mockerl, Steinrück und Basil. Ich war traurig, die Durieux nicht begrüßen zu können. Aber ich mochte nicht an den Tisch drängen in meiner dürftigen Equipierung. Roda Roda und Frau fuhren mich in einem Auto heim, in dem auch Scharfs mitgenommen wurden.
Nachmittags war ich bei Emmy im Atelier gewesen, um dort für eine Ballade, die ich neulich Morax aus dem Handgelenk diktiert hatte, einen Bilderbogen zu zeichnen. Morax, Engert und Keller waren da. Emmy lag im Bett. Das arme Mädel kriegt viel zu wenig Schlaf. Jeder will mit ihr schlafen, und da sie sehr gefällig ist, kommt sie nie zur Ruhe. Bis drei muß sie bei der Kathi sein, die sie scheußlich ausnutzt, und morgens um 9 Uhr sitzt sie dann schon in der Malschule. Ich wollte, ich wäre erst gesund. Dann würde ich sie oft mit zu mir nehmen und einfach nicht fortlassen, ehe sie nicht gründlich ausgeschlafen ist. Aber Hauschildt, der sich gestern wieder den Sünder ansah, vertröstet mich immer noch auf 14 Tage. Diese Zeit hatte er vor 3 Wochen, als ich zuerst zu ihm ging, schon als Dauer der Krankheit prophezeit. Mich macht die Sauerei schon ganz melancholisch.
Ich habe in den letzten Tagen Landauers „Aufruf zum Sozialismus“ gelesen, und habe nun begonnen, das Buch sofort zum zweiten Mal durchzugehn. Mein Urteil will ich bis zur Vollendung der zweiten Lektüre zurückstellen. – Ich muß an die Kain-Arbeit! Es ist hohe Zeit.
München, Mittwoch, d. 17. Mai 1911.
Vor genau einem Monat kam die Gonorrhöe zum Ausbruch. Heute kann ich sagen, daß es etwas besser geht. Aber noch ist Ausfluß da, und der kleinste alkoholische oder sexuelle Exzess kann mich wieder ganz herunterbringen. Dabei sehne ich mich maßlos nach Umarmungen. Es ist so viel Kraft aufgespeichert, dabei das ganze Interesse so auf den Genus konzentriert, daß ich mich mitunter vor Geilheit kaum zu lassen weiß. Gestern nachmittag kam ich zu Emmy. Sie stand splitternackt in ihrem Atelier und wusch sich. Trotz meines Zustands küßte ich sie wie ein Rasender. Das gute Kind freut sich auch auf die erste Nacht, wo es wieder gehn wird.
Jaffé, (der Professor) hat mir auf meinen Wunsch den Rest der „Wüste“ geschickt. Nun liegt die ganze Auflage meines ersten Gedichtbuchs in einem großen Packet in meinem Zimmer. Ich werde etliche Exemplare herausnehmen und den Rest an den Verlag des Sozialistischen Bundes schicken. Ich werde das Buch, das ursprünglich 2 Mk 40 Pf gekostet hat, für 1 Mk 50 Pf verkaufen lassen.
Der Maler Oppenheim ist wieder in München. Er stellt bei Tannhauser aus. Der Kerl hat eine unverschämte Schnauze. Das Urbild eines Prager Judenbengels. Aber sachverständige Leute erklären ihn für sehr talentiert, und Heinrich Mann ist anscheinend immer noch mit ihm befreundet. Kokoschka behauptete allerdings, als ich ihn hier zuletzt sprach, Oppenheim plagiiere ihn. – Er kam abends ins Café Bauer. Wir gingen dann in die Torggelstube, wo die Herren Rößler, Strauß, Meßthaler und noch einer, dessen Name mir nicht einfällt, pokerten. Ich kibitzte bei Rößler, der mir aus jedem größeren Pott, den er zog, eine Mark abgab. Ich kam um 6 Mark bereichert heim. Rößler wohnt jetzt hier in der Pension. Heute früh hatte ich schon seinen Besuch.
München, Donnerstag, d. 18. Mai 1911.
Von meinem Bruder Hans kam dieser Tage ein längerer Brief, in dem er die zweite Nummer des „Kain“ kritisiert. Er läßt nichts Gutes daran. Die erste Nummer sei überall viel besser gewesen, und dann folgt der Ratschlag für die dritte und alle folgenden Nummern, ich solle regelmäßig ein größeres Gedicht wie im Heft 1 bringen. Der Mann glaubt, unsereins kann der Muse Gedichte abzapfen wie er seinen Meerschweinchen. Außerdem wäre die Befolgung seines Vorschlags der Mord des Blatts. Gedichte müssen Festtagsspeise sein – und gar lange Ergüsse höchstens im Jahre einmal. Das Tagebuch aus dem Gefängnis findet Hans langweilig, die Notiz vom Witzblatt-Humor hat er sowenig wie einer seiner Freunde verstanden, die „alle keine Esel“ sind. – Wenn die Zeitschrift nicht wieder besser wird, findet er, wird sie niemand lesen wollen. Merkwürdig, daß ich hier fast überall das Gegenteil gehört habe. Die meisten Leute – und ich verkehre hier schließlich mit literaturkundigeren Persönlichkeiten als mein Bruder Hans einer ist – urteilen, daß die zweite Nummer bedeutend klarer und fertiger aussieht als die erste. Ich werde die dritte so schreiben, wie es mir behagt. Wem’s nicht paßt, soll mich am Arsche lecken.
Meine Beziehung zu Emmy wird immer herzlicher. Wir mögen uns beide sehr gern leiden. Gestern, als ich von der Kegelbahn (allein) in den Simpl kam, traf ich dort bei Emmy Lotte und Strich. Wir gingen dann alle zusammen – auch Anny Trautner ist wieder vorhanden und kam mit – ins Stefanie, und Herr v. Sörgel schloß sich uns an. Emmy poussierte mit ihm und da ich den Kerl nicht leiden kann – er ist ein Flaps – litt ich darunter. Nachher ging ich mit Emmy fort und Sörgel schloß sich uns in der Hoffnung an, mit Emmy schlafen gehn zu können. Er trottete immer neben uns her und tätschelte Emmys Hand. Endlich erklärte Emmy, sie werde mich noch ein Stück begleiten, da sie mich noch allein sprechen wolle. Jetzt ging der Herr. Ich bin überzeugt, sie tat das, weil sie merkte, daß ich den Menschen nicht mag. Ich hätte natürlich mir nichts merken lassen und hätte mich schon vor Emmys Haustür gedrückt. Wir gingen dann noch durch die Nacht spazieren und küßten uns sehr viel und innig. Ich litt schrecklich, daß ich nicht zu ihr konnte. Ach, wie mich dieser Tripper peinigt! – Lotte meinte gestern, als ich sie fragte, warum sie sich garnicht mehr bei mir zeige, sobald ich gesund bin, werde sie kommen. Ich faßte das als Piacere-Versprechen auf. Wer weiß? – Erst um 4 Uhr in der Frühe, als es schon hell wurde, trennte ich mich unter Küssen von Emmy und ging im wundervollen Gesang der Vögel heim.
Die Marie in der Torggelstube schenkte mir vorgestern zwei Kartenspiele. Ich glaube wenig an Kartenprophezeiungen. Aber ich fühlte Neigung, irgendetwas zu wissen. So nahm ich aus dem ersten Kartenspiel eine Karte heraus: es war der Kreuz-König. Darauf zog ich aus dem andern eine: es war die Herzdame. Es wurde mir merkwürdig zu Mute und ich dachte wild an Friedel. Dann zog ich noch einmal und griff aus dem ersten Spiel den Herzkönig und aus dem zweiten die Kreuz-Dame. – Und es gibt Leute, die behaupten, nicht abergläubisch zu sein! Ich weiß mit dem sonderbaren Ergebnis meines Versuchs intellektuell garnichts anzufangen, aber um ein Ahnen tiefer symbolischer Bedeutungen komme ich nicht herum, und daß Frieda der Sinn des Spiels ist, das ist mir keine Frage.
München, Freitag, d. 19. Mai 1911.
Mit dem Tripper geht es jetzt merklich besser. Nur noch ganz geringer Ausfluß und fast keine Schmerzen mehr beim Schiffen. Natürlich werde ich noch sehr vorsichtig sein, bis ich völlig geheilt und dessen sicher bin: weder saufen noch vögeln. Aber in einer, längstens in zwei Wochen hoffe ich gründlich nachholen zu können. Wenn nur Emmy verfügbar bleibt! Bei ihrem umfänglichen Liebesleben scheint sie sich auch etwas zugezogen [zu] haben. Mehrere ihrer letzten Männer haben Beschwerden bemerkt, und nun habe ich veranlaßt, daß sie heute zum Arzt geht, damit sie falls nötig sogleich etwas für ihre Gesundheit tun kann. Aber für mich wäre es scheußlich, wenn ich gleich wieder nicht wüßte, wo ich mit meiner überschüssigen Kraft bleiben soll.
Mit dem „Kain“ bin ich noch immer völlig im Rückstand. Ich muß endlich mal mit Steinebach sprechen, um zu erfahren, ob die nächste Nummer überhaupt sicher herauskommen kann. An Julius Muhr in Wien habe ich geschrieben und ihn um eine Unterstützung für das Blatt gebeten. Aber es scheint sehr fraglich, ob er schicken wird. Vielleicht gibt Steinebach selbst Kredit, sodaß es weiter gehn kann. Jedenfalls bin ich sehr in Sorge. – Daß Papa sich nicht rührt, ärgert mich schwer. Ich habe es ihm wirklich nahe genug gelegt, mir zu helfen, und er brauchte sich, wenn er mir schon 3000 Mk vorstreckte, deshalb auch nicht einen Schnaps entgehn zu lassen. Ich begreife den alten Mann nicht. Er muß sich doch sagen, daß der Wunsch, er möchte sterben, nachgrade Leidenschaft in mir werden muß. Ich habe keinen Anzug am Leibe, mit dem ich mich in einträglicherer Gesellschaft sehn lassen kann. Ich trage zerrissene Stiefel, weil mich die 4 Mk 50 reuen, die das Besohlen kostet. Ich habe viel zu wenig Wäsche, und überall haperts und fehlts. Sobald der Vater stirbt, bin ich ein begüterter Mann. Warum macht er mir das so fühlbar? Sehr merkwürdig!
München, Sonnabend, d. 20. Mai 1911.
Johannes lädt mich in einem unendlich lieben und sehr drängenden Brief ein, ich soll zu ihm nach Bern kommen. Alle Einwände, Geldmangel, Kain u.s.w. sucht er zu zerstreuen und erinnert mich an seine Liebe und Freundschaft. Sogar für mein sexuelles Wohlergehen glaubt er sorgen zu können. Da sei ein Mädel, die bisherige Geliebte Siegfried Langs, der nicht mehr in Bern ist, die sei ganz nach meinem Geschmack und werde gewiß alles erwidern. (?!)
München, Sonntag, d. 21. Mai 1911.
Wieder allerlei Unterbrechungen. – Ich fahre fort, wo ich gestern abbrach: Besonders wünscht Johannes, daß ich meine Gonorrhöe in Bern bei einer berühmten dermatologischen Kapazität, Dr. Jadassohn, kurieren lasse. Iza schließt sich der Einladung herzlich an, – und ich bin so gut wie entschlossen, anfang Juni nach Bern zu reisen. Ich habe – bei jedem Brief wird es mir von neuem klar, – doch große Sehnsucht nach Johannes, nach seinen klugen Gesprächen und nach seinen guten Zärtlichkeiten. – Ich bin, seit ich den Plan gefaßt habe, ganz fröhlich. Wenn mir nur der Dalles nicht in die Quere kommt. Wenn die D.M.Z. schickt, geht’s. Gleich heute werde ich Johannes schreiben, daß ich kommen möchte.
Von vorgestern ist zu berichten: ich war wieder im Kutscher-Kolleg. Herr Schulz trug noch einiges zu seinem Vortrag nach. Dann redete Kutscher einiges dummes Zeug zu demselben Thema. Er definierte den Begriff „Volk“, indem er meinte: Unter Volk verstehn wir etwa die Bewohner Deutschlands. Saudumm. Dann folgte der Vortrag eines Dr. Borchardt über die Aufführung des zweiten Teils „Faust“ im Deutschen Theater in Berlin. Im Kutscher-Seminar hat man gegen Reinhardt zu sein. Es war also ein recht unerquickliches Gerede, das der Herr von sich gab. Schließlich machte Kutscher im Anschluß an seine Freilicht-Theater-Vorträge die Mitteilung von den Peter Hille-Waldspielen in Schlachtensee, im Jahre 1903, die unter meiner Leitung stattgefunden hätten ... Ich habe bei den verschiedenen Besuchen im Kutscher-Kolleg – ich war auch früher schon manchmal dort gewesen – nicht den Eindruck gewonnen, als ob dort ergiebige Kulturarbeit geleistet würde. Kutschers Absichten sind gewiß gute, aber er selbst ist beschränkt, und bei den Versuchen, schon jetzt Stellung zu gewinnen zu den Literaturströmungen der Gegenwart, kommt kein Erleben der fließenden Wirklichkeit heraus, sondern ein philologisches Einschachteln von Dingen, die noch garnicht fertig sind.
Gestern war ich bei Steinebach, nachdem ich vorgestern nachmittag mit Toni Maier eine ziemlich ergebnislose Konferenz hatte. Nummer drei ist gesichert, denn es sind etwa 8o Mark in der Kasse, und das übrige will Steinebach kreditieren. Ich machte ihm den Vorschlag, selbst als stiller Teilhaber in den Verlag einzutreten, d.h. das Risiko zu übernehmen und dafür am Gewinn teilzunehmen. Ihm war der Gedanke sympathisch, und er sagte halb und halb zu, will sich die Sache aber noch überschlafen. Es wäre für mich sehr erfreulich, wenn was daraus würde. Dann wäre das Blatt als ständige Institution gesichert, und die ewige Schnorrerei wäre überstanden. Andrerseits bedeutet es natürlich im Falle eines Geschäfts einen bedeutenden Ausfall für mich, insofern Steinebach vermutlich den Hauptrebbach machen würde. Gleichviel, mir ist die Hauptsache, daß ich weiterarbeiten kann. Heute gehe ich daran.
Eine peinliche Affäre gab es gestern nachmittag mit Uli. Ich kam mit Emmy ins Café Stefanie, wo Lotte mit Strich und Uli mit Seewald saßen. Wir setzten uns dazu. Nachher berichtete mir Emmy unter Tränen, daß Uli schon, als wir kamen, abfällige Bemerkungen, wie „Um Gotteswillen“ oder ähnliche gemacht hätte, und sich sehr ablehnend gegen sie verhalten habe. Wir sollten zu Tannhauser, wo Oppenheimer seine Kollektivausstellung hat. Alle hatten die Absicht zu gehn, dann aber zeigte Lotte keine Lust mehr, und versprach ein andres Mal auf die Ehrenkarte, die ich von Oppenheimer habe, mitzukommen. So ging ich mit Emmy und Morax, der inzwischen gekommen war. Die Ausstellung war recht interessant. Der Mensch, so übel er sich benimmt, kann viel, wenn auch Wedekinds Einwand gegen manche seiner Porträts (besonders das von Heinrich Mann) berechtigt ist: sie gehn bei der Sucht, im Einzelnen zu charakterisieren, ins Karrikaturistische. Originell ist seine „Kreuzabnahme“. Um Christus bemühen sich die porträtähnlichen Herrn Peter Altenberg, Karl Kraus und Heinrich Mann. Aber ein sehr schön komponiertes Bild. Auch landschaftlich bietet die Ausstellung sehr Gutes (besonders fand ich eine Schneelandschaft ausgezeichnet). Unter den Porträts war wohl das beste das von Adolf Loos. Aber auch Franz Blei und Arthur Schnitzler und das Selbstbildnis sind gut. Ob Kokoschka mit seiner Behauptung, Oppenheimer plagiiere ihn, recht hat, kann ich nicht entscheiden. Möglich wär’ s schon. – Als wir aus der Modernen Galerie herauskamen, liefen wir grade Uli und Seewald in die Arme, die hineingingen. Es war offenbar, daß sie vorher nur grade mit uns, d.h. mit Emmy, nicht gehn wollten. Das arme Kind war ganz verzweifelt über die schlechte Behandlung. Ich werde mit Uli darüber reden, und sollte das zum Bruch zwischen uns führen.
Gestern abend kam Herr Schulze zu mir und blieb zum Abendbrot. Nachts war ich bei Kathi Kobus, wo ich, wie schon vorgestern, zu der von mir gedichteten und gemalten Moritat mit einem Stock die Bilder zeigte, während Morax und Emmy sie sangen. Àpropos Emmy: Geschlechtskrank ist sie nicht. Vorgestern war sie beim Frauenarzt, der ihr die Reste der letzten Fehlgeburt auskratzte und eine Blinddarmentzündung konstatierte. Dabei singt das Mädel jeden Abend, läuft tags über herum und vögelt des Nachts. Zäh wie Leder – aber hysterisch! hysterisch!
Der Verlag Engl, München 1911, ediert ein Buch von Johannes Eckardt „Karl Schönherrs Glaube und Heimat“, das er mir zur Rezension schickt, offenbar auf den Artikel im „Kain“ hin, „Schönherrs Plagiat“. Wie mir Steinebach erzählte, war der Pater Expeditus Schmidt bei ihm, um sich den „Kain“ zu holen. – Eine lustige Postkarte: Ein Genosse in Cöln-Merheim fragt mich um freiheitliche männliche und weibliche Vornamen an, da ihm seine Gefährtin demnächst ein Kind schenken werde: Ich will ihm gleich antworten.
München, Montag, d. 22. Mai 1911.
Donnerwetter, der 22te! – Von der neuen Kain-Nummer ist noch garnichts da. Ich muß wirklich diese Blätter etwas vernachlässigen, will ich das meinige für das Blatt tun. Ich weiß noch nicht einmal, was alles hineinkommt. Über den Hauptartikel bin ich noch ganz im Unklaren. Gestern, als ich an die Arbeit wollte, rief mich Emmy aus dem Café Bauer an, ich möchte hinkommen. Dort kam nach einiger Zeit Wilhelm Michel und Frau, und wir gingen ins Stefanie, wo ich mit Michel Billard spielte. Nachher zu Emmy aufs Atelier. Das ist eine wüste Bude. Ein mächtiger Raum, dessen ganzes Mobiliar in einem dürftigen Lager, einem Ecktisch, einer primitiven Waschvorrichtung, ein paar unterschiedlichen Sitzgelegenheiten und einer Staffelei besteht. Alles unglaublich verschmiert, ein wüstes Durcheinander von Abfällen, Papier, kleiderähnlichen Stoffen und Malgerätschaften. An den Wänden Zeichnungen von allen Bekannten und Heiligenbilder, Kreuze und ähnliches. Denn Emmy ist katholisch-fromm und trägt sich mit der Absicht, zum Katholizismus überzutreten. Morax und Ida und Engert lagerten in dem Atelier, in dem Emmy, angetan oberhalb mit einem verschlissenen Herrengehrock, unten mit feinen batistenen Höschen herumsprang und den schmierigen Engert karessierte. Morax besaß eine Familienkarte für die Blumensäle, und wir beschlossen, allesamt dorthin zu gehn. Wir nahmen vor dem Café Bauer eine Droschke, aus dem Café kamen noch Keller und Otten, die sich mit Morax in eine zweite Droschke setzten und nun fuhr die ganze groteske Kavalkade unter dem erstaunten Grinsen des zusammengelaufenen Publikums davon. Wir sahen wüst genug aus. Ich auf dem Rücksitz, nach vorn Engert, dessen Abgeschabtheit nachgrade beängstigend wirkt, und der in seiner unerhörten Länge, mit dem gewaltigen Maul, der schwarzgeränderten Brille, den wilden Haaren und den dürren Bewegungen unerhört auffällig wirkt. Neben ihm die kleine, verhutzelte, proletarische, kränkliche, unsagbar häßliche Ida Weber, und dann Emmy mit dem goldigen kurzen Jungenhaar und dem schwarzen Käppi drauf, dem verschlissenen Gehrock, den sie jetzt als Paletot trug und dem grünseidenen Fetzen, den sie zur Verdeckung des weißglänzenden Kragens darüber gewickelt hatte, und den violetten Strümpfen, die sie leger auf die gegenüberliegende Bank legte, damit ich ihre Beine streicheln konnte. So fuhren wir durch alle Hauptstraßen, was an dem schönen Sonntagnachmittag erhebliches Aufsehen machte, zumal ich oft erkannt wurde.
In den Blumensälen selbst war es ziemlich fad. Am besten gefiel mir eine Kinematographen-Nummer, wo ich zum ersten Mal einen bewegten Film auf dem Film dargestellt sah, der von den Zuschauern (in effigie) zertrümmert wurde. Emmy juchzte wie ein kleines Kind und klatschte bei jedem Reklame-Lichtbild in die Hände. Wir haben allesamt all unser Geld ausgegeben und fuhren nachher mit den letzten Groschen per Straßenbahn zurück. Auch die Fahrt war noch recht fidel. – Dann begleitete ich Emmy und Morax bis vor den Simpl. und ging ins Stefanie, wo ich Schach spielte. Nach kurzer Zeit rief Emmy mich telefonisch an. Ich solle sofort hinkommen, es sei etwas Dringendes. Morax hatte mich rufen lassen, weil vier Kriminaler, darunter die, die ihn seinerzeit verhaftet hatten, da waren. Nun fürchtete er, daß die Polizei wieder etwas gegen ihn im Schilde führe. Da die unsympathischen Gäste bald gingen, ging auch ich ins Stefanie zurück, wo ich Heinrich Mann und Oppenheimer traf. Mann scheint mit der Benatzky auseinander zu sein. – Er erzählte, daß die Lasker-Schüler – sie treibt sich immer noch in München herum – ihm aus heiler Haut Krach gemacht habe, weil er angeblich ihren Mann – Herwarth Walden ausgerechnet! – einmal nicht ehrerbietig genug gegrüßt habe. Sie beschimpfte ihn ganz unglaublich: Das Bild, das Oppenheimer von ihm gemalt habe, sei viel zu bedeutend. Er sei nur der Text zu Oppenheimers Musik etc. Mann sagte, er habe sie dabei die ganze Zeit freundlich angelächelt, denn er glaube, sie sei irrsinnig. Das glaube ich auch.
Heut früh kam eine Karte von Rechenberg mit der Mitteilung, daß heute geheiratet wird. Gleichzeitig eine Postanweisung von 4 Frcs (3 Mark 25 Pf) als „Trinkgeld“ für meine Dienste. Ich werde davon ein Glückwunschtelegramm schicken. Ich freue mich sehr, daß aus der Geschichte etwas geworden ist. Wenn nun die Gräfin nur bald zu dem Geld des Schwiegervaters käme!
München, Dienstag, d. 23. Mai 1911.
Der Tripper läuft wieder stärker. Ich bin schon ganz verzagt. Schlapp und energielos bis zum Stumpfsinn. Keinen Tag komme ich vor 1 Uhr Mittag aus dem Bett, und dabei tue ich nichts am „Kain“, der in 8 Tagen erscheinen soll. Steinebach hat sich bereit erklärt, den Verlag de facto zu übernehmen, wenn ich ihn auch nominell behalte. Ich bin sehr glücklich über diese Lösung der Schwierigkeiten. Jetzt ist das Blatt wenigstens bis zum Winter gesichert. Hoffentlich macht Maier keine Schwierigkeiten, dem ich noch nichts mitgeteilt habe. Ich glaube, ich habe Steinebach zu günstige Bedingungen eingeräumt: 25% vom Reingewinn, wobei er seine Druckarbeit voll rechnen soll. Immerhin: Maier hätte 50% gekriegt, und wenn nur erst Reingewinn da ist, will ich gern mit ¾ der Einkünfte zufrieden sein. Begaunern wird mich der Mann jawohl nicht.
Abends war ich im Hoftheater, weil Bernhard v. Jacobi wünschte, daß ich ihn als Golo sehn sollte. Hebbels „Genoveva“ ist ein quälendes Stück, unendlich anstrengend, weil es wegen der großen Schönheiten zwingt, die ganzen 3½ Stunden aufmerksam auf jedes Wort des viel zu breiten, psychologisch konstruierten, in ungeschicktem Romantizismus dilettierenden Dramas hinzuhören. Jacobis Golo war in der Tat sehenswert, graziös, sicher, leidenschaftlich und – so soll es sein – in jeder Schlechtigkeit sympathisch und mitleiderweckend. Im übrigen war das Spiel ganz farblos. Die Berndl als Genoveva war weder schlecht noch gut, Lützenkirchen als Siegfried verwaschen, die Swoboda als Hexe Margarete wenig überzeugend; die ganze Regie Kilians ging mehr aufs Dekorative als aufs Künstlerische aus. – Ich hielt nur mühsam bis zum Schluß aus und ging dann mit total benommenem Schädel in die Torggelstube. Dort traf ich die große Gesellschaft: Steinrück, Waldau, Goldschmidt, Strauß, Ergas und die Schaffer, Dr. Jessnitzer, v. Jacobi und Direktor Victor Barnowsky. Waldau war sehr lustig. Ich mag ihn furchtbar gern leiden. Mit Barnowsky sprach ich über die „Freivermählten“. Er versicherte, daß ich das Stück vom Kleinen Theater nur deshalb nicht zurückbekommen habe, weil es zur engeren Wahl steht, also noch Aussicht auf Annahme hat. – Dr. Strauß bat mich zu einer privaten Unterredung an einen andern Tisch. Die Lasker-Schüler war bei ihm, um evtl. Emmy zu verklagen. Sie hat natürlich alles entstellt und stellt die empörende Behauptung auf, Emmy laufe ihr nach. – Ich war dann noch im „Simpl.“, und hatte Gelegenheit, auf dem Heimweg mit Emmy noch viele Küsse zu wechseln.
Heut hatte ich Besuch von Herrn Haussmann. Das ist der Student, der die unverschämte Rede in jener Versammlung hielt und sich neulich bei der „Kutscher-Kneipe“ entschuldigte. Er wollte die „Prämissen“ zu meinem Vorgehen kennen lernen. Der arme Teufel scheint mir total in sich zerrissen zu sein. Er fügt die gescheitesten Sätze und Einfälle zu den blödesten und dümmsten Gedankenkörpern zusammen. Übrigens: Typischer Selbstmordkandidat.
Mein alter Schulkamerad Gustav Radbruch, Heidelberg, gratuliert zum „Kain“. Er ist noch Extraordinarius, sonst hätte er Geld geschickt für das Blatt. Nicht mehr nötig.
München, Mittwoch, d. 24. Mai 1911.
Von dem, was gestern geschah, wüßte ich nichts, was mir wichtig genug wäre, um mich von der Arbeit am „Kain“ zurückzuhalten. An meiner Faulheit soll das Unternehmen denn doch nicht scheitern.
München, Donnerstag, d. 25. Mai 1911.
Die Tagebuch-Abstinenz hat genützt. Ich habe gestern ein tüchtiges Stück geschrieben, den ganzen Hauptartikel: über Landauers „Aufruf zum Sozialismus“. Abends war ich in der Torggelstube: Roda Roda und Frau, Rößler, Heinrich Mann und Oppenheimer (die bald gingen), Tante Meyer, Frau Etzel – und nachher Steinrück und die Terwin. Das arme Mockerl war totunglücklich. In diesen Tagen hat sie in Berlin die Lulu in der „Büchse der Pandora“ gespielt, und die Berliner Presse, hauptsächlich Jacobsohn und Schlenther, hat sie furchtbar verrissen. Sie weinte und sah entzückend aus. Plötzlich erschien Etzel mit etwa 7 oder 8 Herren von der „Lese“. Rößler, Steinrück und ich brachen mit dem Mockerl fluchtartig auf. Auf der Straße trafen wir Lulu Strauß. Steinrück ging heim, wir andern ins Hoftheater-Café. Das Mockerl berichtete, daß sie sich in Berlin in einen sehr reichen Schriftsteller verliebt habe. Ich wußte sofort, daß sie Hatvany meinte, was sie mir, als wir allein waren, bestätigte. Das liebe Kind schimpfte mordsmäßig auf die „Scheißbande“ in Berlin. Ich redete ihr Mut zu und machte ihr Liebeserklärungen. Nachher brachte mich Rößler noch per Auto bis vor den „Simplizissimus“. Lotte, Uli, Strich und Seewald waren da. Ferner meine alte Freundin und Cabaret-Kollegin, Jenny Hummel. Um Emmy bin ich recht besorgt. Sie ist, fürchte ich, ernstlich krank. Dabei singt und vögelt sie auf Teufel komm raus.
Von Albert R. kam ein neuer Brief. Die Hallunken, denen er vertraut hatte, haben ihn nicht nur betrogen, sondern ihm auch noch den ganzen Kredit versaut und verdächtigen ihn jetzt obendrein noch als Spitzel. Wenn ich nur wüßte, wie man dem armen anständigen Kameraden helfen könnte.
Eben kommt ein Brief von Dr. Felix Muhr, der mir aus Wien mitteilt, daß sein Bruder mir auf meinen Anpumpungsversuch negativ antworten lasse. Na, für den „Kain“ brauche ich ja das Geld nicht mehr. Aber ich hatte gehofft, damit die Berner Reise machen zu können.
München, Sonnabend, d. 27. Mai 1911.
Von vorgestern ist einiges zu notieren, vor allem eine arge Sünde. Emmy verführte mich zum Koitus. Ich warnte sie, ich sträubte mich, ich kämpfte gegen mich, aber ich war schwach. Nun werde ich sie wohl angesteckt haben, und Kätchens Tripper wird die Runde durch München machen. Gestern ging, wie mir schien, Emmy mit Bolz nach Hause, – und auch auf Oppenheimer scheint sie es abgesehn zu haben. – An mir rächte sich die Überanstrengung sehr unangenehm. Nachmittags saß ich mit Emmy im Café und spielte grade mit Morax Schach. Da kam Engert herein, die gewaltige Mähne bis auf die Haut weggeschoren. Er sah scheußlich aus, und ich machte eine entsprechende Bemerkung. Da schlug er mir – ganz ohne feindselige Absicht – seinen Hut auf den Kopf, und muß dabei eine sehr empfindliche Stelle, wohl das Ende des Rückenmarks getroffen haben. Ich glaubte, ich müsse sterben. Das Blut schlug erst in den Kopf, dann zum Herzen, ich tastete umher, und Emmy erzählte, ich hätte furchtbar ausgesehn, mit verdrehten Augen und grünen Lippen. Wer weiß, was für ein bedenkliches Symptom das ist. Ich will doch für alle Fälle meine Bestimmungen für den Todesfall treffen. Eines Tages sterbe ich, und dann fällt womöglich der Ertrag meiner Arbeiten statt Johannes Nohl meiner Familie zu. Und das will ich wahrhaftig nicht verantworten. –
Mit dem „Kain“ geht es langsam vorwärts. Am 3.ten Juni soll die dritte Nummer erscheinen. Ich denke, morgen werde ich das ganze Heft fertig haben. Aber der Dalles ist scheußlich. Ich bin ganz und gar abgebrannt. Doch fand ich eben ganz zufällig in den Abgründen einer zerrissenen Westentasche, tief im Futter vergraben, ein 50 Pfennig-Stück. Es ist doch etwas mit dem Unterbewußtsein. Ich habe nicht etwa nach der Münze gesucht, aber ich bin überzeugt, wenn ich’s nicht ganz nötig gebraucht hätte, hätte ich sie auch nicht gefunden. Jetzt wieder an die Arbeit!
München, Sonntag, d. 28. Mai 1911
Heut früh kam ich erst um ½ 8 Uhr nach Hause. Ich war vom „Simpl.“ aus mit Uli und Seewald, Strich und Lotte, Emmy, Morax und Alwa (Schwirzer) zu Uli aufs Atelier gegangen, wo die andren sehr viel Schnaps tranken und dadurch in eine Stimmung kamen, die ich durch Zusehen und Mitreden künstlich in mir erzeugen mußte. Lotte und Emmy küßten sich maßlos. Dadurch wurde eine angenehme erotische Atmosphäre geschaffen. Dann wurde Uli lebhaft und tanzte zum Wahnsinnigwerden schön. Wenn ich Uli so sehe, dann vergesse ich alles in der Welt und vergehe vor Liebe zu ihr. – Um 6 Uhr langten wir in Café Bauer an, nachdem Lotte und Emmy (Uli war mit Seewald zu Hause geblieben ) auf der Straße den unglaublichsten Unsinn getrieben hatten. – –
Von Johannes kam ein Brief. Er rechnet bestimmt damit, daß ich im Juni nach Bern komme. Ob es gelingen wird, Jaffé für den Zweck anzupumpen? – Ferner schreibt L. Hirsch, er stehe mit Frowein wegen Ankauf meines „Kraters“ in Unterhandlung. Ich werde es mir noch sehr überlegen, ob ich meine Einwilligung zu der Transaktion gebe. – Heute muß ich unbedingt die dritte „Kain“-Nummer zu Ende schreiben. Morgen werde ich wohl den Kontrakt mit Steinebach unterzeichnen, in dem ich mich zur Arbeit, falls ein Geschäft aus dem Blatt wird, für 10 Jahre verpflichte, allermindestens aber für 3. Vorher steht mir kein Kündigungsrecht zu. Doch darf Steinebach zurücktreten, falls bis zum Oktober mit Verlust gearbeitet wird.
München, Dienstag, d. 30. Mai 1911
Die Heilung meiner Krankheit scheint endlich wirklich im Gange zu sein. Gestern hatte ich garkeinen Ausfluß mehr und ging zum Arzt. Hauschildt sah sich die Sache an und war sehr befriedigt. Er riet mir, weiterhin garnicht zu behandeln, sondern nur Diät zu üben. Heute ist wieder geringer Ausfluß da, aber ich denke, das hat nichts mehr auf sich, und ich gebe mich der schwachen Hoffnung hin, daß Emmy trotz unserer Sündhaftigkeit gesund geblieben ist.
Der Dalles in den letzten Tagen war scheußlich. Ich mußte mich buchstäblich 50 Pfennigweise durchpumpen. Gestern gingen wir nun – Emmy, Bolz, Morax, Ida, Engert und ich ins Colosseum (Bolz zahlte meinen Verbrauch). Es war ganz lustig. Besonders machten mir zwei musikalische Clowns, ein Jongleur-Humorist und eine prächtige Akrobatentruppe viel Freude. Dann ging ich in die Torggelstube, wo ich Lulu Strauß, Lina Woiwode, Grünbaum und Frau nebst einigen andern Damen und einem Herrn, die mir aus der Wiener „Nachtlicht“-Zeit noch irgendwie bekannt waren, antraf. Es gab sich, daß vier der Anwesenden den „Kain“ abonnierten und mir die 12 Mk dafür gleich aushändigten. Eigentlich müßte ich sie ja nun an Steinebach abliefern, aber ich betrüge mich drum. Dieser Dalles war zu scheußlich. – Ich begleitete nachher die Woiwode nach Hause. Sie ist ein reizendes Mädel, hübsch, lieb, offen, dabei klug und ehrgeizig. – Als ich sie vor ihrer Tür abgesetzt hatte, ging ich noch in den „Simpl.“, wo u. a. Uli und Lotte waren, mit denen ich neuerdings wieder engere Fühlung gewinne.
Nachmittags hatte ich im Café Stefanie Dr. Wolfskehl gesprochen. Er äußerte sich sehr entzückt über Nohls George-Artikel im „Sozialist“.
München, Sonnabend, d. 3. Juni 1911
Zwei Tage lang habe ich keine Eintragung gemacht. Der „Kain“ muß fertig werden, und es kam noch sonst allerlei dazwischen, wovon ich einiges nachholen will. – Ich lese eben durch, was ich Dienstag einschrieb und sehe, daß ich unter denen, die ich in der Torggelstube vorfand, den wichtigsten nicht nannte: Sobotka. Mit dem sprach ich über Operettentexte und er meinte, man müsse mal statt dieser ewigen faden Wiener Liebesgeschichten eine Kriminalsache zum Vorwurf eines Librettos machen. Ich kam auf den Gedanken, das zu tun und beschloß zugleich, Sobotka für die Berner Reise anzupumpen. Am Dienstag war ich bei ihm. Er forderte mich auf für die Operette ein Szenarium zu verfassen und es ihm (für den Neuen Verlag) vorzulegen. Die 100 Mk, die ich haben wollte, gab er mir nicht, wohl aber fünfzig und 20 für 5 Wiener Abonnenten. Die 20 Mk habe ich an Steinebach abgeliefert. Mit dem habe ich inzwischen einen Vertrag abgeschlossen, der mich für mindestens 4 Jahre bindet. Wenn nur bis zum Oktober Überschüsse da sind, damit das Blatt dann weiter geht! Um das übrige Geld, das ich zur Reise gebraucht hätte, zu kriegen, wandte ich mich an Jaffé, den ich energisch an die 150 Mk-Geschichte erinnerte, und bat ihn um 100 Mk. Natürlich verweigerte er sie und kam schließlich mit dem schäbigen Versprechen, er werde, falls es mir gelingt, die übrigen 80 Mk zusammen zu bringen, 20 Mk geben. Vieh! – Ich werde mir heute von Fuhrmann Geld holen, und dann zu Jaffé, dem ich die 20 Mk natürlich nicht ersparen will. – Von der Gräfin kam inzwischen ein amüsanter Brief. Sie hat geheiratet und schreibt sehr lustig von ihrer Beziehung zu Rechenberg und zu ihrem Schwiegervater. Auf Jaffé schimpft auch sie immer noch. Über die Eheschließung und das, was ihr voranging, meint sie, daß immer nur aus den verrücktesten Plänen etwas werde, aus den vernünftigen nie ...
Im Café Stefanie wurde mir Mittwoch ein Trauerbrief übergeben. Er war von Gertrud Fehl. Sie sei für kurze Zeit in München und möchte mich sehn. Ich hatte sie zuletzt vor etwa 4 Jahren in Berlin gesehn, als ich ihr ein Engagement nach Zürich verschafft hatte, und freute mich, wieder ein Lebenszeichen von ihr zu bekommen. Ich schrieb ihr also und lud sie zum nächsten Mittagessen zu mir ein. Sie kam, ganz in schwarz, etwas schlanker, als sie gewesen war, und erzählte mir von ihrem Schicksal. Sie war damals in Zürich durch einen gewissenlosen Kerl krank gemacht worden und hatte fürchterliche Krankheiten hinter sich. Jetzt sei sie mit einem Manne verheiratet, der auch in München sei, einem Rumänen, dem es sehr seltsam gehe. Er hat mit ihrer (Gertas) Schwester zusammengelebt und sollte sie jetzt heiraten. Inzwischen hat er sich aber in Gerta verliebt und die beiden haben sich verständigt. Jetzt ist sein reicher Vater gestorben; auf diesen Tod hatte er alle seine Hoffnungen gesetzt gehabt, da er über 80000 Fr. erben sollte. Er und seine Brüder sind aber von der Stiefmutter um den letzten Pfennig geprellt worden. Daher hat er seinen Verwandten und Freunden mitgeteilt, er werde sich erschießen, und ist nun für alle Welt tot. Inzwischen hat er sich mit Gertrud getroffen und die beiden haben geheiratet. Im Hause Fehl weint also die eine Schwester um den gestorbenen Geliebten, während die andre mit ihm auf der Hochzeitsreise ist. Nun sitze sie hier in einer heillosen Angst, von Bekannten entdeckt zu werden, er noch dazu als ungarischer Deserteur, und ohne einen Pfennig Geld. Ich half mit einer geringen Kleinigkeit aus und befürchte jetzt, da ich auch gestern wieder angepumpt wurde, daß dieser Roman, in den ich da aus Versehen mit hineinspiele, noch recht kostspielig für mich werden kann. Aber ich überlege schon, ob ich nicht die ganze Geschichte dramatisieren soll. Jedenfalls habe ich viele Küsse von Gerta eingeheimst.
Leider ist es mit dem Tripper wieder viel ärger geworden. Ich bin sehr unglücklich deswegen. Jetzt schleppe ich mich schon sieben Wochen damit. Wie soll das werden!
München, Dienstag, d. 6. Juni 1911.
Schon wieder habe ich zwei Tage unausgefüllt gelassen. Es waren die Pfingstfeiertage und ich war inzwischen in Tegernsee. — Am Sonnabend nachmittag traf ich im Caféhause Rößler und Weissgerber und wir beschlossen, einen kleinen Poker zu machen, zu dem sich auch Meyer noch einfand. Ich gewann 42 Mark, von denen ich 10 Mark gleich Emmy schenkte. Rößler hatte mich eingeladen, mit ihm am Sonntag früh nach Tegernsee zu fahren. Ich holte ihn also ab, und wir fuhren um ¾ 12 Uhr ab. Vorher hatte das Moggerl (ich hatte sie immer Mockerl geschrieben und erfuhr erst jetzt, wie die Orthographie sein muß) antelefonieren lassen, daß sie und Moissi dort wären und uns erwarteten. Moissi soll hier am Volkstheater gastieren. Wir hatten schon korrespondiert miteinander. Im Hotel Steinmetz in Tegernsee saßen sie beim Mittagstisch, als wir kamen. Moissi lief uns mit ausgebreiteten Armen entgegen und umarmte und küßte uns beide. Auch das Moggerl ließ sich einige Zärtlichkeiten gefallen und hielt mir die Wange zum Kuß hin. In Moissis Gesellschaft war auch Berneis. Nach Tisch gab es natürlich einen Poker, bei dem ich nahezu 10 Mk verlor. Nachher fuhren wir im Boot (Berneis ruderte) ans andre Ufer nach Rottach, wo Rößlers „Witwe“ mit seinen Kindern zur Zeit wohnt. Die Kinder sind reizend. „Genossin Lotte“, die ich schon in Friedrichshagen im Kinderwagen schob, ist 9 Jahre alt. Zuerst war sie etwas scheu, freundete sich aber nach und nach sehr mit mir an und turnte mir dann immerzu auf dem Schoß herum. Sie wird mal sehr hübsch werden. – Die ganz kleine heißt Gwendelin und sieht Rößler frappant ähnlich. Ein sehr lustiges, niedliches und furchtbar komisches Kind. Moissi, Moggerl und Berneis ruderten wieder nach Tegernsee hinüber, wir andern blieben in Rottach, wo ich für die Nacht im alten Schulhause ein Zimmer nahm, dessen Fenster unmittelbar auf dem Kirchhof ging, an den das Haus direkt angrenzt. – Am Abend kam Thoma, Emilio Ganghofer und Thomas Bruder Peter, ein wilder Jägerskerl mit zerrissenem Bauerngesicht, der kein Wort spricht. Ganghofer erzählte aus seiner Seemannszeit haarsträubende Geschichten und log das Blaue vom Himmel herunter. Grade erzählte er, wie er während einer Revolution vor Peru lag. Die Kugeln flogen um das Schiff herum. Ein Kriegsschiff fuhr heran, dessen Kapitän sich über den Rand beugte und rief: – – Da unterbrach Peter Thoma den Erzähler und ergänzte: „Obst net an Radi host“. Wir lachten furchtbar über diese einzige Bemerkung, die der Jäger den ganzen Abend von sich gab. Schon frühzeitig – gegen ½ 11 – brachen wir auf und ich ging zu den guten Bauersleuten im alten Schulhause schlafen, nachdem mich Thoma sehr herzlich zum Frühstück eingeladen hatte. Ich schlief prachtvoll und stand früh um 7 Uhr auf.
Es regnete stark, während ich den See entlangging und dann den Weg zu Thoma hinauf suchte. Er wohnt prachtvoll. Das bayerische Vorgebirge ist wunderschön, die Berge sind nicht zu nahe und nicht zu hoch. Thomas Haus liegt ziemlich hoch. Man hat einen prächtigen Ausblick. Es ist völlig bäuerisch gehalten. Ich wurde in ein Zimmer geführt, dessen Wände ganz von Geweihen bedeckt sind, auf denen überall Ort und Datum der Jagd steht. Ein großes Bild Ludwigs II. hängt an der Wand, das Thomas Vater von dem König bekommen hat. Die Möbel sind einfach und stilecht, der Ofen ist eine Nachbildung nach einen alten oberbayerischen Muster. Thoma bewirtete mich zunächst mit ausgezeichnetem Kaffee, zu dem es Brot mit Butter und Schnittlauch und wundervollen geräucherten Speck gab. Außerdem zwei Eier. Dann zeigte er mir das ganze Haus und Anwesen. Der Bauernstil ist ganz durchgeführt, und er erläuterte mit großer Liebe jedes Stück. Der Garten ist groß, sehr gut angelegt und trägt an Obst und Gemüse mehr als Thoma braucht. Am Hause die Vogelnester machen ihm besondere Freude, und er war glücklich, als er bemerkte, daß grad ein neues Schwalbenpaar anzubauen begann. Sein größter Stolz ist ein Kuhstall, in dem sein mächtiges, preisgekröntes Vieh lag. Dieser Thoma ist ein ganz prächtiger Mensch, unglaublich beruhigend und wohltuend. Marietta scheint endgiltig von ihm fortzusein. Er erwähnte sie nicht und ich fragte natürlich auch nicht. Nachher kam sein Bruder Peter und ein Jäger und wir beobachteten durchs Fernglas ein Reh, das am Waldrand graste, ein reizendes, graziöses Tier, das sich weit vorwagte. Thoma stopfte mich mit Zigarren voll und ich ging gegen 10 Uhr nach Rottach zurück, wo ich Rößler mit Witwe und Kindern beim Frühstück traf. Das Wetter war sehr merkwürdig: eine Viertelstunde wunderschön, und urplötzlich Wolkenbruch, Hagel und Gewitter. Immer abwechselnd. Eine längere Sonnenzeit benutzten wir zu einer prachtvollen einstündigen Kahnfahrt. Um Mittag telefonierte das Moggerl an, Basil sei in Tegernsee, wir sollten doch kommen. Ich fuhr dann nach Tisch hinüber und pokerte mit Berneis, Moissi und Basil: 6–8 Mk Verluste. Um 5 Uhr sollten wir alle bei Thoma Kaffee trinken. Da aber Moissi nicht gut zu ihm steht (Marietta!) und Basil abends spielen, also früh nach München abfahren mußte, und da das verliebte Moggerl sich von Moissi nicht trennen wollte und Berneis Thoma noch garnicht kannte, fuhr ich allein ab. Rößler und Familie war schon da. Es gab wieder Kaffee und das herrliche Geräucherte, und die Gespräche gingen um Politisches: Thoma ist gegen Harden. Ich mochte mich nicht auf ernsthaft streitbare Diskussionen einlassen. Auch drängte die Zeit, da wir 7’26 fahren wollten. Morgens hatte ich mich mit Thoma über Dinge des Sozialistischen Bundes unterhalten, für die er viel Interesse und Verständnis zeigte. Ich lasse ihm Material schicken. – Ich ging nun mit Rößler an den Bahnhof, nachdem wir uns unterwegs von seinem Anhang getrennt hatten und in der Erwartung, daß auch die andern nobel sein würden, nahmen wir Billets zweiter Klasse. Der Zug, der endlos lang war, war dicht besetzt, sodaß uns der Koupeur sagte, wenn wir nicht Platz fänden, sollten wir nur I. Klasse einsteigen. Das taten wir und trafen in einem Koupee erster Güte Moissi, das Moggerl und Berneis. Große Freude. Es war eine ungeheuer vergnügte Fahrt nach München. Rößler war in großer Form. Er hielt vom Fenster aus pathetische Reden an die Vorübergehenden, sodaß wir vor Lachen fast geborsten wären. Am amüsantesten wurde er, als der Zug zwischen Solln und München etwa eine Stunde lang auf dem Geleise stehn blieb. Der ganze Zug war in der größten Nervosität. Die Leute schimpften. Rößler aber stand am Fenster und rief den Menschen die komischsten Dinge zu. Etwa: „Ich habe den Lokomotivführer im Verdacht, ein Melancholiker zu sein“. – Wir trennten uns, als der Zug mit einer Verspätung von mehr als fünf viertel Stunden in München ankam, von den übrigen und gingen noch in die Torggelstube, wo wir Kutscher, Peppler und Frau und einen Hamburger Theatermenschen trafen. Nachdem wir etwas gegessen hatten, fuhren wir in der Elektrischen heim. Ich war noch etwas oben bei Rößler und ging dann schlafen. Es ist eine Ewigkeit her, daß ich nicht mehr in der Elektrischen abends nach Hause gefahren bin.
Ich will morgen abend noch Moissi im Theater sehn; es findet die Uraufführung eines Dramas „Unterwegs“ statt, von einem Polen Thaddeus Rittner, den ich, glaube ich, aus dem Kraus-Kreis kenne. Übermorgen früh fahre ich dann nach Bern zu Johannes. Das Reisegeld werde ich von Fuhrmann im Vorschuß kriegen.
München, Mittwoch, d. 7. Juni 1911.
Fuhrmann hat mir 100 Mk Vorschuß gegeben, 20 Mk hatte ich noch, und mit diesem Vermögen will ich morgen nach Bern reisen. Lange reichen wird es ja nicht, aber irgendwie wird’s nachher schon weiter gehn. – Wenn ich nur erst die nötigste Korrespondenz erledigt hätte! Kürzlich kam schon ein Telegramm von Hans, warum ich nicht schreibe, auch Onkel Leopold sei beunruhigt. Nun muß ich heute noch eine Menge Briefe besorgen. – Auch der Tripper macht mir schwere Sorgen. Immer, wenn mal ein Tag der Ausfluß aufgehört hat, setzt er am nächsten wieder ein. Jetzt leide ich schon fast 8 Wochen darunter. In Bern werde ich mich sofort in sehr sorgfältige Behandlung geben. Ich sehe schon ein: ohne zu spritzen wird die Geschichte nicht aufhören. Aber der Zustand ist nachgrad unerträglich.
Gestern traf ich im Hofgarten Heinrich Mann mit Hertzog und Oppenheimer. Ich ging mit ihnen noch einmal in die Ausstellung der Oppenheimerschen Gemälde bei Thannhauser. Er hat ein neues Porträt von H. Mann fertiggestellt, das in vielem besser ist als das erste, doch aber auch stark karrikaturistisch wirkt. Im ganzen hatte ich von der Ausstellung einen noch stärkeren Eindruck als beim ersten Besuch. In den oberen Räumen sind Kollektivausstellungen von Hodler und Uhde. Zu Uhde habe ich wenig Beziehung. Hodler ist für mein Gefühl der tiefste aller lebenden Maler. Er ist der einzige, der Ekstasen gestalten kann.
Im Stefanie sitzt jetzt täglich ein wunderschönes Mädchen, in das ich mich beim ersten Sehen verliebt habe. Ich habe mich erkundigt: es ist ein Fräulein von Bach, eine Schülerin von Weissgerber. Emmy erzählte mir neulich, daß mich einige Damen der Weissgerber-Schule gern malen möchten. Wenn ich diese prachtvolle Blondine dadurch kennen lernen könnte, täte ich’s. Nur muß ich erst gesund sein, ehe ich mich wieder auf irgendwelche erotische Ausflüge begebe. –
Bing ist wieder da. Ich spielte eine Partie Billard mit ihm.
Abends Torggelstube: Steinrück, v. Jacobi und Frau, Muhr, Dr. Goldschmidt und Feuchtwanger. Die Diskussion über Jagow und Kerr reißt immer noch nicht ab. Ich kämpfte allein gegen Jagow. Alle andren fanden ihn völlig im Recht. Cassirer als Mensch, Kunsthändler und Ehemann. Zum Schluß blieben Steinrück, Feuchtwanger und ich allein. Steinrück findet es ungerecht, daß ich ihn als Menschikoff verrissen habe. Mein Lob der Durieux (im „Kometen“) findet er übertrieben. Langes Gespräch über die Terwin, ihr Können und ihre Grenzen. – Übrigens: das Moggerl schenkte mir in Tegernsee ein Bild von sich mit nackten Beinen: ganz entzückend, ganz reizend.
Uli sprach ich im Stefanie, Lotte traf ich auf dem Wege zur Torggelstube auf der Straße. Wir gingen noch eine Viertelstunde miteinander ins Café Odeon. Das Puma hatte mir allerlei zu beichten. Sie war sehr nett und zutraulich: Es hilft alles nicht: wir beide können soviel Krach miteinander haben wie wir wollen. Wir gehören doch zusammen. Das ist mein Trost in allen meinen Freundschaften, daß die Freunde, wenn sie jemand ganz Verläßliches suchen, immer wieder zu mir kommen.
Bern, Freitag, d. 9. Juni 1911.
Also ich bin wirklich nach Bern gefahren, und muß mich hier vorläufig erst mal in die andre Umgebung finden, um zu wissen, wie ich mich zu Stadt und Menschen einzustellen habe.
Mittwoch abend war im „Volkstheater“ das Moissi-Gastspiel in der Uraufführung des fünfaktigen „Don-Juan-Dramas“ „Unterwegs“ von Thaddeus Rittner. Das Stück taugt nicht viel. Viel zu lange Dialoge, fatale psychologische Schwächen und ungeschickter dramatischer Aufbau. Die Don Juan-Figur des Barons ist gewiß in mancher Hinsicht interessant und ich verstehe Moissi, daß er sich die Rolle herausgesucht hat. Er hat gezeigt, was für eine Bravourleistung daraus zu machen war. Das war dann auch das Erfreuliche des Abends: Moissi, der ganz ausgezeichnet, ganz ergreifend und von unglaublicher Lebendigkeit war. – Wie eigentlich die Qualitäten des Stückes sind, darüber läßt sich nach der Aufführung im Volkstheater sehr wenig sagen. Was gutes daran sein mag, das haben die unsäglichen Schmieranten dieser Bühne kaputgeschludert. Unter dieser Erbärmlichkeit litt natürlich auch Moissis Spiel, das, da es allein in den Regionen der Kunst trieb, virtuosenhaft wirkte. Es war sehr schade, so ohne Befriedigung fortgehn zu müssen, und es ist mir kaum je vorgekommen, daß ich nach dem Theater so ohne Ahnung war, wieviel das Stück, das ich gesehn habe, wert war. – Und doch freue ich mich, nicht abgereist zu sein, ehe ich Moissi nicht auf der Bühne sah. Nachmittags hatte ich ihn – mit seiner Frau und mit Berneis im Hofgarten gesprochen. Er erzählte, daß er nächste Woche in Zürich den Ödipus spielt. Könnte ich doch hinfahren! – – Nach der Vorstellung ging ich mit Rößler im Pilsner Bierhaus Abendbrot essen, dann in die Torggelstube. Das Moggerl wollte grade fortgehn, als wir kamen. Sie kletterte zum Fenster zu uns auf die Straße hinaus, und Rößler holte dann auch noch die Woiwode. Die beiden waren heimlich entflohn, da die Terwin bei der Woiwode übernachten wollte, statt, wie es Basils Hoffnung war, mit dem schlafen zu gehn. Ich begleitete die Mädels zur Kanalstraße vor die Wohnung der Woiwode. Sie waren beide sehr nett und lieb. Zum Adjö küßten mich beide auf den Mund. – Dann ging ich zurück, ging aber, obwohl Wedekind kam, den ich lange nicht gesprochen habe, mit Rößler sehr bald fort, um zur Reise frisch zu sein.
Gestern früh kam um 8 Uhr schon Albert R. zu mir, der Mittwoch abend, als ich grade ins Theater wollte, im Café Stefanie aufgetaucht war. Er erzählt mir ausführlich von den gräßlichen Niederträchtigkeiten der „Kameraden“, auf die er vertraut hatte. Der arme Teufel ist ganz niedergedrückt von den Schweinereien und den für ihn ganz scheußlichen Folgen. – Er begleitete mich zur Bahn, und um 10 Uhr 20 fuhr ich ab.
Die Reise verlief ganz gut. Die meiste Zeit bis Lindau brachte ich im Speisewagen zu. Die Fahrt über den Bodensee war trotz der sehr großen Hitze recht schön. Zwischen Romanshorn und Zürich machte ich ein Gedicht für die „D. M .Z.“, das ich in Zürich, wo ich genügend Zeit hatte, im Wartesaal des Bahnhofs niederschrieb und mit einem energischen Mahnbrief absandte, in dem ich mit dem Anwalt drohte. Wenn es doch hülfe! Dann fahre ich nächste Woche mit Johannes nach Zürich zum „König Ödipus“.
Am Bahnhof hier erwarteten mich Johannes und Iza. Beide sehn wohl aus. Wir gingen Abendbrot essen und inzwischen erzählten wir uns wild durcheinander unsre Erlebnisse. Ich hörte absonderliche Geschichten über Margrit, die ich aber nur zum Teil glaube. Johannes’ Art zu kombinieren aus Tatsachen und Psychologie ist ungeheuer bestechend, aber man darf sich doch nicht immer davon überzeugen lassen. Sonst – sähe es um Margrits Charakter traurig aus. Ich bin in der Wohnung, in der Johannes und Iza wohnen, einquartiert und soll hier von morgen ab auch ganze Pension haben. Ich habe ein hübsches Zimmer bekommen, das bisher Iza bewohnt hat, Ausblick auf Berge und wohnlich eingerichtet. Spät abends war ich mit Johannes noch am Bahnhof. Wir hatten sehr viel zu erzählen. – Er und Iza sind noch sehr glücklich miteinander. Eine richtige Ehe, wenn auch der ewige Dalles manche Unbequemlichkeiten mit sich bringt.
Heut früh kam Johannes zu mir ins Zimmer und seitdem waren wir fast ununterbrochen beisammen. Unsre Freundschaft hat in den 7½ Jahren ihres Bestandes nichts an Zärtlichkeit und Vertrauen eingebüßt. Ich bin froh, wieder bei ihm zu sein und ihn froh zu sehn, mich bei sich zu haben. Am Bahnhof frühstückten wir zu dreien, Dann ging ich mit Johannes zu Margrit. Die Kinder begrüßten mich voll Zärtlichkeit. Margrit selbst tat, obwohl sie sicher schon von meinem Dasein orientiert war – wir hatten eine Viertelstunde warten müssen – ganz erschrocken und sehr überrascht, lief, ehe sie ein Wort zum Gruß gesagt hatte, nervös aus der Stube, um einen Brief, der eben an mich abgegangen sei, von der Post zurückholen zu lassen, und erzähle dann von ihrem Schicksal. Damit steht es schlecht genug. Der Fey, den ich in vorigem Jahr bei ihr kennen lernte, hat sie wüst betrogen. Er hat ihr eine Menge unersetzliche Bücher, die der Landesbibliothek gehören, gestohlen, und sie muß sie erstens ersetzen (sie schätzt den Schaden auf 4–500 Franken) und hat noch sonst unendliche Scherereien, die sie womöglich die Fortsetzung des Studiums kosten können. Sie tat mir in ihrer hysterischen Haltungslosigkeit leid, zumal sie sehr gealtert ist. Herrgott, was war das vor zwei Jahren, als sie in München mit mir Meinungen und Lager teilte, für ein blühendes, begehrenswertes Weib! – Ich bin gespannt, wie sich unser Verhältnis jetzt hier anlassen wird. –
Wir aßen in einer Pension, hier in der Schwarzthorstrasse, dann gingen wir – wieder mit Iza in ein Caféhaus, dann ich mit Hans allein zu der mir zugedachten Geliebten. Sie war nicht daheim. Ihre Mutter war da: ein richtiger Kupplerinnentypus. Die Frau – sie heißt Gugger – soll insgeheim in dem Haus einen Puff betreiben, bei dem auch die Tochter gelegentlich aushelfen muß. Auch ein Bruder, der als Zuhälter geschildert wird, war nicht zuhause. Aber nach den Bildern, die ich sah, muß das Mädel – Lene mit Namen, wirklich nett sein. Auch soll die Familie nach außen hin jede Form wahren, und ihre merkwürdige Existenz vor allen persönlichen Bekannten mit viel sittlichem Aufwand verleugnen. Ich bin neugierig.
Draußen kühlt ein Gewitterregen die Luft aus, die tagsüber wahnsinnig glühte. Und jetzt gehe ich zu Johannes hinüber, um ihm einiges aus diesen Tagebüchern vorzulesen.
Bern, Sonntag, d. 11. Juni 1911.
Die Vorlesung aus den Tagebüchern, die ich vorgestern und gestern vornahm, hat mich in eigentümliche Stimmung versetzt. Es ist doch ein selten reiches Erleben um mich und also wohl auch in mir. Eins ist mir wieder besonders heiß lebendig geworden bei der Durchsicht dieser Blätter: meine Liebe zu Frieda, und das deutliche Bewußtsein, das sie und niemals eine andre mein Schicksal ist.
Gestern war ich beim Arzt, einem Professor Jadassohn, der ein berühmter Dermatologe sein soll. Er konstatierte, daß ich noch immer einen „ganz floriden Tripper“ habe und verordnete mir eine Ichthargan-Einspritzung, die ich viermal täglich machen muß. Es ist eine Höllenqual damit, aber ich hoffe, daß es nun endlich wirklich schnell helfen wird. Der Mann selbst gefiel mir gut. Er macht einen vertrauenerweckenden Eindruck, ist witzig und anscheinend etwas boshaft. Wie wird es blos mit meiner Rechnung werden? Das Geld schmilzt zusehends zusammen, und ich sehe garnicht, wo bis zum Ersten wieder etwas her soll. Dann aber soll von dem, was einläuft, hier die Pension und die Reise bezahlt werden, und außerdem die Rechnung in München. Ich mag nicht daran denken. Es wird sehr arg kommen, fürchte ich.
In das Verhältnis Johannes-Iza habe ich jetzt einigen Einblick. Die Hauptsache ist: die beiden lieben sich fraglos sehr und kommen hier jetzt ausgezeichnet miteinander aus. Johannes’ Nerven sind in der Zeit dieser Ehe so ruhig geworden, daß er sich die Nervositäten Izas, die vor dem Doktor-Examen steht und eben eine Angina überstanden hat, mit rührender Geduld gefallen läßt.
Heut waren wir bei Lene Gugger, die mir ausnehmend gut gefällt. Der Typus ist ein wenig Schwabing, doch erinnert mich das Mädel irgendwie ein bißchen an Kätchen in ihrem Wesen. Hätt ich doch das Geld, das Kind mit nach München zu nehmen. Ich glaube, sie käme gerne mit. Denn ihre kupplerische Mutter scheint sie zu hassen, und ich hatte den Eindruck, daß ich ihr nicht übel gefalle. Aber, da ihr die Mutter schwerlich die Existenzmittel geben wird, wird aus dem schönen Plan wohl nichts werden. – Wie beneide ich Rößler! Der hat sich kürzlich in ein Mädchen verliebt und hat ihr vorgeschlagen, auf seine Kosten in der Pension zu wohnen. Jetzt wird sie wohl inzwischen angekommen sein und schon bei ihm hausen. Eine Inderin, Schauspielerin und angeblich große Schönheit.
In den Zeitungen fand ich den Aufruf eines Komitees, das sich zum Schutz der Wedekindschen Werke gegen die Polizei konstituiert hat. Man soll, wenn man Interesse für die Sache hat, seine Adresse bei Georg Müller abgeben. Ich werde das tun und auch im „Kain“ auf die Geschichte eingehn. Ob das das Resultat des Gespräches zwischen Halbe und Wedekind ist, dessen Zeuge ich kürzlich war? – Damals schlug Wedekind vor, man solle eine Aktion unternehmen, um Stücke wie Halbes „Mutter Erde“ oder Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“ dagegen zu schützen, daß sie zu schnell einfach vom Repertoire der Bühnen verschwinden. – Sehr auffallend ist, wie geheimnisvoll die Wedekind-Demonstration arrangiert zu sein scheint. Ich hatte kein andeutendes Wort gehört, bis ich, erst hier, den Aufruf las.
Die Stadt Bern ist wunder-wunderschön. – Aber ständig hier leben – nein!
Bern, Dienstag. d. 13. Juni 1911.
Lene Gugger war gestern zum Abendbrot bei uns. Ich muß mir gestehn, daß mir das Mädchen einen ungeheuer starken Eindruck macht. Ich habe den Verdacht, daß dieses Weib in meinem Leben eine entscheidende Rolle spielen könnte. Ein sehr merkwürdiges, sehr eigenartiges Geschöpf. Dunkle, brennende, tiefe, verlittene Augen, ein sehnsüchtiger, klassisch schön geformter Mund, gebogene, ausdrucksvolle Nase, dunkle weiche Haare, schneeweiße Stirn. Der Wuchs schlank und ziemlich lange grade Beine – soweit man durch die Kleider unterscheiden kann, knabenhafte Schultern und Arme – und ganz sicher ein zarter schöner Akt. – Nein, mit Kätchen hat sie im Wesen garkeine Ähnlichkeit. Ich kam wohl darauf, weil mich einige Bewegungen in ihrer Häuslichkeit an Kätchens hausfrauliche Betulichkeit erinnerten. Lene ist die verschlossenste Frau, die mir noch begegnet ist. Wir – auch Margrit Faas war da – sprachen über alles mögliche, über moralische und gesellschaftliche Dinge. Lene hörte aufmerksam zu. Ihre klugen Augen beobachteten jeden mit viel lebendigem Interesse. Aber sie sprach kein Wort. Richtete man direkte Fragen an sie, so wich sie aus. – Ich war sehr ergriffen von ihrer Art und schlug ihr vor, nach München zu kommen. Sie lehnte ab, obwohl sie zugab, daß sie sich in Bern nicht wohlfühlt und obwohl sie versicherte, daß ich ihr nicht antipathisch sei. Wir gingen später mit ihr in ein Cinema-Theater, und dann ins Café Bubenberg. Sie hatte sich erst sehr gesträubt, ein Caféhaus aufzusuchen. Es war klar, daß sie sich vor den Leuten geniert. Tatsächlich beglotzten diese Berner Schweine, von denen gewiß soundsoviele das wirklich zuinnerst reine Mädchen schon für ein Goldstück umarmt hatten, das arme Kind mit unverschämten verachtenden Blicken, auf die Lenes Augen drohend antworteten. – Ich will, solange ich hier bin, möglichst oft mit ihr zusammen sein. Das wird dem mißhandelten Wesen gewiß wohltun, wenn man sie als Menschen behandelt und achtet. Ich fühle, daß ich hier sehr, sehr lieben könnte, wenn nur die Möglichkeit bestände, ihr die Existenz zu sichern.
Diese Möglichkeit zeigt sich allerdings plötzlich, wenn auch bis jetzt nur in schwachen Illusionen. Margarete Faas, die wir gestern besucht haben, steht mit einem Wucherer in Verbindung. Johannes ist überzeugt, das sei ihr Vater. Sie hält es für möglich, daß der gegen hohe Prozente 5000 Mk für mich herausrücken würde, deren Verzinsung erst bei der Rückzahlung nach der Fälligkeit meiner Erbschaft zu entrichten wäre. Heut abend werd ich vielleicht noch Bescheid haben über meine Aussichten. Es wäre herrlich. Ich würde, falls ich das Mädel doch noch dazu herumbrächte, dann in München mit ihr eine kleine Atelierwohnung einrichten. Vielleicht hätte der Himmel ein Einsehen und ließ den großen Reichtum nachfolgen, ehe der kleine verzehrt wäre. Nur ein Ungemach scheint wieder dabei zu sein, über das erst Gewißheit sein müßte. Lene hat sich jetzt operieren lassen, der Blinddarm wurde ihr herausgenommen. Aber der Professor, der sie behandelt, will nun auch die Basedowsche Krankheit bei ihr entdeckt haben. Das wäre furchtbar: wenn dieses reizende Geschöpf einst mit gestielten Augen und Kropf herumlaufen müßte. Es wäre nicht auszudenken grauenhaft.
Mit Margrit hatte ich mancherlei Gespräche, die mich recht interessierten. Eine sonderbare Frau. Verlogen bis zur Manie, und dabei doch von einer prächtigen ehrlichen Menschlichkeit. Wie das Schicksal dieser armen Hysterikerin mal ausgehn wird, das wird, scheint mir, noch von vielen grotesken Überraschungen abhängen.
Johannes bekam gestern ein Paket mit Wäsche und Anzügen von seinem Bruder. Er schenkte mir eine Hose und eine schöne doppelreihige Phantasieweste. Das ist mir sehr erfreulich. Denn meine Garderobe ist mir schon lange eine rechte Sorge.
Bern, Freitag, d. 16. Juni 1911.
Es ist eigentümlich, wie faul ich hier bin. Ich tue garnichts und komme darüber nicht einmal zu den Einzeichnungen in dies Tagebuch. Dabei merke ich beim Durchlesen der alten Eintragungen, wieviel ich dadurch, daß ich mal ein paar Tage aussetze, vergesse. Die wenigen Male, die ich in München überschlug, vermißte ich nachträglich einige ganz wichtige Dinge, z.B., daß mir das Kleine Theater die „Freivermählten“ mit der Begründung zurückgegeben hat, das Stück eigne sich mehr zur Lektüre als zur Aufführung. Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die Herrschaften zu diesem Resultat gekommen sind. – Ferner will ich doch nicht ganz wortlos übergehn, daß kürzlich der kleine verwachsene Herr Nassauer gestorben ist, Geschäftsführer der „Münchner Zeitung“. Ich war häufig mit ihm in der Torggelstube beisammen und hatte ihn ganz gern.
Hier in Bern habe ich mich inzwischen leidlich eingewöhnt. Die Wirtin kocht einigermaßen. Das Geld reicht noch bis morgen – und der Herr wird weiterhelfen. Wird er? Eine Aussicht hat sich leuchtend aufgetan, während zugleich eine Quelle verstopft ist. Da die „Deutsche Montagszeitung“ absolut nichts schickte, sandte ich ihr gestern einen Beitrag unter Nachnahme von 100 Mk und zugleich einen Brief, in dem ich mitteilte, bei Ablehnung des Nachnahmebriefes gehe meine Forderung an einen Rechtsanwalt. Mit meiner Sendung kreuzte sich nun ein Brief des Blattes, den ich heute erhielt. Man schreibt mir, daß die Zeitung in Liquidation gehe, ich müsse, wenn ich überhaupt etwas von meiner Forderung retten wolle, warten. Ginge das Blatt pleite, so bekämen die Gläubiger überhaupt nichts. Ich danke. Mit den 50 Mk monatlich ist’s jetzt Essig. Nun hat aber Margarete Faas einen Wucherer an der Hand (Johannes hat sie in Verdacht, daß ihr eigner Vater solche Geschäfte macht), von dem sie versuchen will, für mich bis zum Tode des Vaters etwa 5000 Franken (oder Mark) zu leihen. Morgen soll sich die Sache entscheiden. Ich bin äußerst gespannt, zumal ich blos noch etwa 5 Franken habe, und außer den 20 Mk, um die ich Jaffé von hier aus gemahnt habe, bis zum Monatsersten kein Pfennig zu erwarten ist. Das wird noch nett werden, falls Margrits Halsabschneider nicht funktioniert.
Mit Lene Gugger komme ich täglich zusammen. Ich bin jetzt völlig überzeugt, daß ihre Mutter sie für Geld verkuppelt. Aber ich habe sie von Tag zu Tag lieber. – Sie spielt die Rolle des gesellschaftsfähigen Mädchens (keineswegs eine gansige Jungfrauenrolle) ungeheuer geschickt. Sie ist klug, auch boshaft und hat gewiß die tiefe Sehnsucht, aus dem Milieu, in dem sie gehalten wird, herauszukommen. Ich hatte mehrere ernste gute Gespräche mit ihr. Ich erklärte ihr, wenn ich zu meinem Gelde komme, wolle ich sie nach München einladen, sie solle dort auf meine Kosten in einer eignen Wohnung leben und durchaus tun und lassen was sie will. Sie lehnte das entschieden ab, meinte aber, wenn ich sie als Haushälterin engagierte, würde sie gern kommen. Wäre ich doch bald soweit, daß ich einen eignen Hausstand hätte! Das Mädel könnte mir viel Glück geben. Ich habe ein recht gutes Gedicht für sie gemacht („Seltsames Wesen du an meiner Seite“). Ein liebes, tiefes und im Herzen reines Geschöpf.
Mit Iza habe ich öfters kleine Reibereien. Sie nimmt meine Witzeleien über alles mögliche dann, wenn sie mal davon betroffen wird, schwer übel und rächt sich dann durch gewollte Bösartigkeiten. So meinte sie gestern, als ich sie mit einem Nußknacker verglichen hatte (wirklich ganz ohne kränkende Absicht, blos weil sie so komisch auf dem Sofa saß), ich solle nur gehn und mich in meinem Tagebuch idealisieren. Tu ich das? Sie hat nicht viel daraus gehört, aber ich war doch bestürzt über den Ausdruck. Ich fragte Johannes, der nicht fand, daß ich mir vor der Nachwelt Gloriolen umhänge. Den armen Johannes peinigt sie mit kleinlichen Eifersüchteleien. Er hat die Gewohnheit, jedes Mädchen in sich verliebt zu machen und tut dann so, als sei auch er verliebt. Ich habe das immer als kleine Koketterien aus seiner Homosexualität betrachtet und nicht wichtig genommen. Aber Iza macht ihm damit das Leben schwer. Er läßt sich ihre Nörgeleien mit rührender Sanftmut gefallen. Das sollte meine Frau sein! – Immerhin: ich freue mich trotz allem sehr über das Verhältnis, da ich sehe, daß die Nerven des Freundes unendlich ruhiger und sein Allgemeinbefinden unvergleichlich gesünder geworden ist, seit er diese Ehe führt. Allzu lange Dauer prophezeie ich allerdings der Liebe nicht mehr.
Meine Münchner Wirtin schickt mir trotz vielfacher Mahnungen meine Briefe nicht nach. Ich bin sehr beunruhigt darüber und habe jetzt an Rößler geschrieben, er möchte dafür sorgen. – Heute muß ich wieder zu Professor Jadassohn. Bis jetzt hat auch die Spritzerei nicht sehr viel geholfen. Ich möchte blos wissen, wie lange ich mich noch mit diesem elenden Tripper herumschlagen soll. Jetzt ist er 2 Monate alt.
Bern, Sonnabend, d. 17. Juni 1911.
Der Professor hat mir die tröstliche Versicherung gegeben, daß der Tripper genau so zu bewerten und zu behandeln sei wie ein ganz frischer. Die ganzen 8 Wochen vorher betrachtet er als verloren. – Er hat mir eine etwas stärkere Injektion verschrieben und mich für den Freitag der nächsten Woche wiederbestellt.
Ich war auch gestern wieder lange bei Lene. Mein Gedicht hat sie erfreut, aber wohl etwas ängstlich gemacht. Durch die Zeilen: „Acht auf den dunkeln Weg. Er liegt voll Schlamm“ und „ – – Ich glaube deinen Lügen, erkenn’ dich gern als was du scheinen willst“ fühlt sie sich wohl etwas durchschaut, aber ich muß zugeben, sie verstellt sich meisterhaft. Ich sprach lange mit ihr über Huren, sie ging ganz unbefangen auf das Thema ein und erklärte mit der ruhigsten Sicherheit, daß sie für Geld sich nie verkaufen würde. Ich wurde ganz schwankend, ob wir sie nicht doch vielleicht falsch taxieren. Später aber, nach dem Abendbrot, holten Johannes und ich sie ab. Da sie allein nicht mit uns gehn sollte, nahmen wir auch die alte Kuppelmutter mit und gingen in ein italienisches Weinlokal mit den beiden. Ich sprach viel mit Lene, und sie machte allerlei Bemerkungen, die uns unsern Verdacht doch wieder stark bestätigten. Vor allem waren auch die Blicke der Leute auf der Straße und die getuschelten Bemerkungen der infamen Berner Spießer überführend. Nun, ich habe es ihr am Nachmittage deutlich genug gesagt, daß mir eine Hure ein ebenso wertvoller Mensch schiene wie jeder andre. – Leider ist sie in Johannes arg verliebt, und den auszustechen wird mir wohl schwer werden. Auch jetzt wieder behindert mich der Bart in meinen Plänen. Lene hat mir deutlich gesagt, sie könne bärtige Leute nicht leiden. Wann ich mich wohl entschließen werde, mich rasieren zu lassen?
Von München ist endlich einige Post nachgesandt worden: eine Karte von Ewers, der die – inzwischen ja Tatsache gewordene – Liquidation der D. M. Z. in eventuelle Aussicht stellt, dann eine ganz verrückte Karte von Rechenberg; der will einen Roman schreiben, „Schnaps“ von dem jeder, der ihn liest, besoffen werden muß. Und schließlich ein Dankbrief von Dr. Georg Hirth für meine Notiz über seine Person in der Nr. 3 des „Kain“. Er abonniert zugleich und bestellt „Wüste“, „Krater“ und „Hochstapler“. Ob das eine Einleitung ist zu einer Aufforderung zur ferneren Mitarbeit an der „Jugend“?
Jetzt erwarte ich Lenes Besuch. Nachher soll ich von Margrit erfahren, ob der Wucherer – jetzt vermutet man einen sozialdemokratischen Abgeordneten oder Gemeinderat, namens Mohr in dem Kerl – die Tausende herausrückt. Mein Kapital beträgt noch 1,10 Fr. – und vielleicht werde ich heute reicher sein als je zuvor. – Gott geb’s!
Und dann muß ich endlich an die Arbeit und Nr. 4 herstellen.
Bern, Montag, d. 19. Juni 1911.
Natürlich ist das Geld, das Margrit beschaffen will, immer noch nicht da. Jeden Tag mußte ich zu ihr laufen oder sie irgendwo sonst treffen. Aber regelmäßig hatte sich der Wucherer noch nicht entschlossen. Morgen früh muß sie nun nach Zürich abreisen und vorher – um ½ 10 Uhr – soll ich noch mal zu ihr kommen. Sie hofft, mir bis dahin irgendwo 200 Franken besorgen zu können. Hoffentlich gelingt es ihr. Der Dalles – wir haben garnichts mehr, und ich muß morgen neue Ichthargan-Lösung haben – geht mir schon schauderhaft auf die Nerven.
Sonnabend abend hatte ich sehr ausführliche Gespräche mit Margrit: über Landauer, mich, sie und den Sozialistischen Bund. Sie klagte sehr über die Lieblosigkeit, die sich vor einem Jahr (genau!) bei dem Geheimbund-Prozeß Morax gegenüber gezeigt habe. Wir alle seien noch nicht die richtigen neuen Menschen. Sie weinte viel, und ihre Art ging mir recht nahe. Ganz klug werde ich aus der Frau nicht. Hinter all ihren hysterischen Verlogenheiten sehe ich doch so viel wahre schöne Menschlichkeit in ihr, daß sie mich immer wieder rührt und ergreift und daß manchmal ganz echte Zärtlichkeit für sie in mir aufsteigt. Und doch: irgendetwas Wahrscheinliches haben die Behauptungen und Combinationen, die Johannes und Iza über sie aufstellen. Sie muß in sich sehr zerrissen sein.
Bei Lene waren wir – Johannes und ich – bis jetzt außer heute täglich. Sie ist ein liebes Mädel. Sie macht doch manchmal schon Andeutungen. So meinte sie gestern, sie stecke ihr Gesicht, wenn sie ausgehe, am liebsten in einen Schleier und ziehe den Hut möglichst tief darüber. Auf meine Frage, warum sie sich denn nicht frei zeigen möge, antwortete sie: „Wir haben doch einen sehr schlechten Ruf.“ Sie tut mir sehr leid, zumal das infame Weib, daß sie geboren hat, sie in schrecklicher Gefangenschaft hält. Ich möchte dem armen Kind sehr gern heraushelfen.
Der neue „Sozialist“ enthält einen Artikel Landauers „Gott und der Sozialismus“, der in der nächsten Nummer fortgesetzt werden soll. Es ist eine sehr schroffe Polemik gegen Johannes Nohls Artikel in der vorigen Nummer: „Fichtes Reden an die deutsche Nation und Landauers Aufruf zum Sozialismus“. Darin hatte Johannes Landauers Buch eingehend besprochen, es – besonders im Gefühlsmäßigen sehr gelobt und nur im Hinblick auf Landauers religiöse Anschauungen abweichend kritisiert. Es war ein schöner, starker, klarer Aufsatz, dazu der erste, den der Freund mit Unterzeichnung seines ganzen Namens veröffentlicht hat. Ich war recht glücklich über die gelungene Arbeit. Landauer hatte ihm gleich nach Einlauf sehr erfreut geschrieben, ihm aber angekündigt, er werde antworten und hoffe, Johannes zu „erschüttern“. Der hatte entgegnet, das sei nicht seine Absicht gewesen. Er sei Anfänger in der schriftstellerischen Laufbahn, wolle sich auf Polemik nicht gern einlassen und bitte Landauer, den Artikel lieber ungedruckt zu lassen. Nach freundschaftlicher Verständigung zwischen beiden, war er dann also doch erschienen. – Und nun legt Landauer in einer Weise los, daß ich tief empört bin. Er wirft Johannes durch die Blume Pose, Mache, Abhängigkeit von George, Empfindungslosigkeit und selbst Unehrlichkeit vor und polemisiert in einem Ton, den ich nur gehässig nennen kann. Der arme Freund ist ganz deprimiert, daß ihm so häßlich begegnet wird und ich fühle so stark mit ihm wie ich nur mit einem Menschen fühlen kann. Es ist, als bekäme ein Kind an seinem Geburtstag unverdiente Schläge. – Ich bin wütend über Landauer. Das war wirklich nicht nötig, und wenn Johannes ihn jetzt heimtückisch, untreu, wortbrüchig nennt, so weiß ich kaum, wie ich ihm widersprechen kann. Ich erkläre mir Landauers Vorgehn psychologisch mit einer gewissen Eitelkeit. Er will unbestechlich sein, auch einem Lobe gegenüber, in dem er mit Fichte verglichen wird. Dadurch wird er ungerecht bis zur Gemeinheit. Hätte ich nicht infolge meiner zehnjährigen Freundschaft mit Landauer soviele Gründe, die mir seine Haltung wenigstens menschlich begreiflich machen, so würde ich kaum anders können, als mit ihm zu brechen. Jedenfalls will ich ihm meine Meinung brieflich sagen. Ich hoffe, er wird bei all seiner Empfindlichkeit daraus keine unfreundschaftlichen Konsequenzen ziehn. – – Johannes gegenüber verteidige ich Landauer so gut es gehn will. Darin werde ich durch Iza, die entsetzlich hart und intolerant über Menschen und Taten urteilt, weiter getrieben als ich eigentlich will. Ihre Liebe zu Johannes führt sie zu gehässiger Verblendung gegenüber Landauer. Sie ist ein sehr schwer umgänglicher Mensch. Der arme Freund ist sehr traurig. Ich auch.
Heut abend las ich ein Plakat des Inhalts, daß Moissi am Donnerstag und Sonnabend hier am Stadttheater spielen wird. Ich habe ihn gebeten, mir seine Ankunft mitzuteilen, da ich ihn von der Bahn abholen will. Das wird sehr nett werden. Und jetzt – es ist gegen Mitternacht – will ich schlafen gehn.
Bern, Mittwoch, d. 21. Juni 1911.
Große Pleite und allerlei Sorgen. Ob ich die 5000 Franken, die Margrit beschaffen will, kriege ist immer noch zweifelhaft, wenn es auch allmählich wahrscheinlich geworden ist. Die Bedingungen werden sein: Ausstellung eines Schuldscheins über 8000 Franken und Rückzahlungsverpflichtung in 3 Jahren. Immerhin ziemlich happig. Ich rechne 20 Prozent Verzinsung heraus. Aber wenn schon. 5000 Franken, das sind etwa 4000 Mark können schon tüchtig weiterhelfen. Freilich werden jedenfalls an 1000 Franken gleich fortgehn. Johannes muß etwas kriegen, Margrit wird selbst ein paar hundert Franken pumpen wollen, Reitze möchte ich gern 100 Franken schenken, dann muß ich nötigst Garderobe und Wäsche komplettieren, Izas Examen muß bezahlt werden und etliche kleine Gläubiger werden sich wohl auch einfinden, wenn man Geld bei mir riecht. – Macht alles nichts. Ich werde maßlos froh sein, wenn es endlich, endlich gelingt. – Was dann in drei Jahren wird, das will ich getrost dem Schicksal überlassen. Entweder ich habe dann schon geerbt, oder Margrits Vater hat das Zeitliche gesegnet, oder ich habe mit dem „Kain“ oder mit einem Drama oder sonst einem Buch große finanzielle Erfolge, oder ich stopfe das Loch mit der Wolle eines andern Wucherers zu oder es findet sich sonst ein Rat. Drei lange Jahre Zeit! Und inzwischen wenigstens ein Jahr lang genügend zu leben, anzuziehen, auszugeben und zu helfen, wenn es mir Spaß macht. – Morgen soll sich alles entscheiden. Wäre nur erst morgen. Dieser 21. Juni ist wirklich der längste Tag im Jahr.
Die gute Lene sitzt mir fortwährend im Kopf. Ich glaube ernstlich, ich liebe das Mädchen, wiewohl ich gut weiß, daß meine Gefühle für Frieda von dieser Liebe, die garnicht so arg begehrend ist sondern vielmehr mitfühlend, verstehend, streichelnd nie verdrängt werden könnten. Aber diese tiefen dunkeln traurigen ausdrucksvollen und doch so ganz unerforschlichen Augen und der rührende, süße, verlangende, sehnsüchtige, küßliche Mund ergreifen mich im Allerinnersten. Dabei sehe ich täglich, wie die entsetzliche Hexe, die ihre Mutter ist, sie quält, vergewaltigt, unterdrückt und habe das tiefe Verlangen, ihr zu helfen und sie womöglich mit mir nach München zu nehmen, auf die Gefahr hin, ihre Liebe nie erringen zu können. Gestern waren wir – Johannes und ich – wieder bei ihr. Abends wollten wir sie ins Café haben und Johannes rief sie telefonisch an. Sie sagte zu. Als wir sie auf der Straße erwarteten, kam sie plötzlich rennend an, in heilloser Angst, da ihre Mutter hinterher sei. Sie habe sie durchaus nicht fortlassen wollen, und so sei sie einfach davongelaufen. Sie war ganz aufgelöst und zitterte, dabei aber doch vergnügt und verhöhnte die Mutter, deren rechtes Ohr in der Wut immer ganz rot werde. Sie fürchtete großen Krach zuhause. Nachmittags schon hatte sie uns von wüsten Familiengeschichten erzählt. Wie ihr Bruder – Johannes behauptet, er sei Zuhälter, und den Typus hat er wirklich – sie verprügele und schon Versuche gemacht habe, sie umzubringen, wie sie sich mit der Mutter schlage etc. Schauderhafte Zustände. – Heut wollten wir wieder hin. Sie war nicht da. Die Alte erzählte, sie sei mittags davongelaufen. Eben komme ich vom Café und Spaziergang heim, und Iza erzählt mir, Lene sei vor einer Stunde dagewesen, habe aber nicht warten wollen. Ich bin recht traurig, sie verfehlt zu haben. Aber ich denke ernsthaft daran, sie, wenn das Wucherergeld wirklich ausgezahlt wird, sehr zu bitten, mit uns zu kommen. Aus diesem Schandhause muß sie befreit werden. Ich denke jetzt viel an alte Geschichten: wie ich erst Bianca Colani und drei Wochen später Gerta Melchers aus den Klauen ihrer Mütter befreite. Und an die Verse der Beutler an Bianca denke ich:
„Soll deine Mutter im Jammer enden!
Was gilt die Mutter?! – Wir sind das Neue!“
Aus der Korrespondenz: ein Brief von Rößler als Antwort auf meinen. Die Inderin ist bei ihm, aber er möchte sie schon wieder los sein, da sie „anständig“ ist. Hardekopf sei in München. Er sitze mit Bolz und Emmy im Caféhause, die sich bestrebe, ein kordiales Verhältnis zwischen ihren Liebhabern herzustellen. Eine Nummer des „Zwiebelfischs“ sei angekommen für mich und Halbes Roman „Die Tat des Dietrich Stobäus“. Aus dem Zwiebelfisch hat er eine Seite herausgenommen und beigelegt, auf der ich mit dem „Kain“ ekelhaft angepöbelt werde „Der beliebte Anarchist E. M. ...“ Die beiden ersten Nummern werden wohl auch die letzten bleiben. Die Empfehlung Ganghofers im Inseratenteil wird angerempelt, die ganze Zeitschrift als Kuriosum für Sammler hingestellt. Das Blatt gebe heraus „Kain“ Verlag. Der Inhalt der ersten Nummern wird angegeben, ohne daß irgend ein Beitrag näher behandelt würde außer der Notiz „An die Leser“, die auf dem Deckel steht. Das ganze ist eine Gemeinheit. Und wenn ich bedenke, daß der Macher des Blatts Herr Dr. Kurt Martens ist, der sich immer höchst liebenswürdig gegen mich gestellt hat und für den S.B. einst so viel Interesse zu haben vorgab, daß er sogar einmal zu einer Versammlung in den „Gambrinus“ kam, dann bin ich von neuem verblüfft über die Doppelseelenhaftigkeit vieler Menschen, die im privaten Verkehr so ganz andres tun als sie nachher vor der Öffentlichkeit dokumentieren. Ich ärgere mich sehr über die gesinnungslose Viecherei.
Ferner erhielt ich durch Margrit einen Brief von R., der schon wieder großes Pech hatte. Seine Kameraden sind in Konstanz eingesperrt worden und haben seinen ganzen „Zinck“ bei sich. Der arme Teufel! In Wien hat er allerhand für den “Kain“ getan. – In Zürich soll demnächst eine Konferenz stattfinden zwischen ihm und seinen führenden Genossen, die ihn so schwer hineingelegt haben. Ich soll womöglich dran teilnehmen. Neulich habe ich schon mit Peter Fr. deswegen telefoniert.
Heute kam von Bayros eine Postkarte aus Österreich mit einer Handzeichnung, die moderne bayerische Kunstinquisition darstellend. Der Text ist nicht sehr geistreich. Als Dank für meine „Kain“-Notiz: „Der unzüchtige Marquis“. Vielleicht kann ich mal die Originalzeichnung von Bayros gut verkaufen. – – Als ich eben nach Hause kam, wurde mir mitgeteilt, daß inzwischen der Geldbriefträger mit 25 Franken für mich dagewesen sei. Von Jaffé offenbar, dem ich von hier aus noch deswegen geschrieben hatte. Also doch!
Etwas, was ich neulich auf der Straße sah und was mich abscheulich bewegte, will ich notieren. Ich ging zu Margrit. In der Länggasse kam mir mit Musik und Getrommel eine Abteilung Soldaten entgegen. Als sie näher kamen, sah ich, daß in den Uniformen lauter Knaben steckten, eine langer Zug, Gewehre über den Schultern. Ich war tief empört und angewidert von dieser „Jugendwehr“. Kinder mit Mordwaffen umgehn zu lehren, sie zur Massenmörderei zu erziehen, ehe sie noch ausgewachsen sind. Pfui Teufel! Aber echt schweizerisch-demokratisch!
Bern, Freitag, d. 23. Juni 1911.
Der Besitz einer Summe, wie ich sie nie besessen habe (ich habe in meinem ganzen bisherigen Leben noch nicht ein einziges Mal über eine Summe von auch nur 300 Mark auf einmal verfügen können), ist nun in greifbare Nähe gerückt – und zugleich auch die Möglichkeit, daß Lene ihrer Mutter durchgeht und mit mir nach München kommt. – 5000 Franken werde ich zwar nicht kriegen, wohl aber – falls nicht wieder ganz ausgefallene Geschichten dazwischen kommen, 3000 – und zwar zu verhältnismäßig günstigen Bedingungen: Ich muß 3500 Franken quittieren und diese Summe mit 5% verzinsen. Das ist nicht übermäßig wucherisch. Beinahe wäre die Sache noch zuletzt schiefgegangen, da der Notar den Einwand machte, daß Margrit, deren Scheidung noch nicht perfekt ist, garkeine Rechtsgeschäfte machen darf nach Berner „Recht“. Der Mann selbst, der natürlich keine Ahnung hat, daß 500 Fr. weniger gezahlt werden als ich auf dem von ihm zu beglaubigenden Schuldschein bestätigen muß, hat sich nun zur Verfügung gestellt, daß er seinen Namen für den Handel vorschieben will. Das ist wirklich sehr anständig, und nun werde ich wohl morgen mit Margrit zu ihm gehn und vielleicht auch morgen abend schon das Geld in Händen haben. Es wäre ein rechter Segen. Johannes und Iza habe ich auf Margrits Wunsch erzählen müssen, ich kriege blos 1500 Fr. – Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie von dem Mehr nichts wissen. Ich werde dann auch ihnen, da sie sparsamer drauf rechnen werden, länger damit helfen können. – Der Lene habe ich noch einmal allen Ernstes vorgeschlagen, sie solle mit nach München kommen, und sie hat gestern sehr mit sich gekämpft deswegen. Ich sehe jetzt ziemlich ein, daß ich ihre Liebe nicht haben werde. Aber sie hat die meine – und so meine ich doch, daß für mich – und zwar nur für mich – Verpflichtungen bestehn. Als ich vorgestern bei ihr war, erzählte ich ihr in aller Ausführlichkeit die Bianca- und Gerta-Geschichten. Sie hörte sehr aufmerksam zu, und ich war nicht wenig überrascht, als sie mir nachher beiläufig erzählte, sie werde in zwei Tagen (das wäre heute) für 14 Tage nach Basel zu einer Kusine reisen, von da aus nach Zürich und dann noch nach Genf. Mir schoß sofort der Gedanke durch den Kopf, sie erfinde diese Reise, um sich für den Rest meines Berner Aufenthalts vor mir verbergen zu können. Mit Johannes erwog ich nachher diese Möglichkeit, sowie auch die, die Johannes aufstellte, die Alte zwinge sie, mit einem Herrn, der sehr viel dafür zahle, die Reise zu machen. Ich dachte schließlich, die Alte schicke sie auf Reisen, um sie unserer, speziell meiner Gesellschaft zu entziehen. Denn das Weib haßt mich tödlich, soviel ist ganz sicher. Sie wittert, daß ich gegen sie zu Lenes Gunsten Pläne mache. Das bestätigte mir Lene gestern noch dadurch, daß sie erzählte, Margrit Faas besuche jetzt die Alte oft und habe ihr gesagt, sie müsse sie in einer sehr dringlichen Angelegenheit sprechen. Als wir fragten, woher denn Margrits Freundschaft zu der Kuppelmutter kommen mag, meinte Lene: „Der Weg zur Tochter führt an der Mutter vorbei.“ Sie nimmt also an, Margrit sei lesbisch in sie verliebt, und mir bestätigt sich dieser Verdacht durch die Aufregung, in die Margrit kürzlich geriet, als ich ihr sagte, ich hätte Lene gern und ginge mit dem Gedanken um, sie mit nach München zu nehmen. Es ist bei Margrits kompliziertem Charakter garnicht ausgeschlossen, daß sie jetzt gegen den Entführungsplan, den auch sie nur im Gefühl wittert, intrigiert. Trotz allem: ich bin ernst mit mir zu Rat gegangen. Lene ist ein wertvolles Geschöpf. Ich habe sie gern. Hier im Hause Gugger verkommt sie mindestens körperlich. Das Leben, daß sie führt, ist entsetzlich, zumal an Johannes Vermutung, daß sie mit ihrem Leibe dem völlig untätigen Bruder, der sie prügelt und bedroht, den Lebensunterhalt verschaffen muß, doch manches Wahrscheinliche ist. Ist sie in München, so kann ich ihr mit dem Geld, das ich jetzt bekomme, leicht über die ersten Wochen hinweghelfen und ihr, da sie sehr willig und zu jeder Arbeit bereit ist, wohl auch eine Möglichkeit zum Geldverdienen besorgen. Ich will das tun, auch wenn ich nie einen Kuß dafür bekommen sollte. Ich habe ihr das deutlich gesagt, aber sie ist noch unschlüssig, und sehr interessant war mir ihr Einwand, der Bruder werde kommen und sie zurückholen. Mich werde er sogar vielleicht erschießen. Ich fürchte ihn nicht. Die Reise, gab sie zu, sei Schwindel.
So stehe ich also jetzt vor Entscheidungen, die weite Folgen in meinem Leben haben können. Leider ist meine Energie noch immer nicht so rege, wie in normalen Zeiten. Denn der elende Tripper ist immer noch nicht ausgeheilt. Heute war ich wieder beim Professor Jadassohn, der mir erklärte, ich werde ihn auch noch in München ärztlich weiter behandeln müssen. Eine teure Geschichte.
Ein Brief kam heute an, der seine Vorgeschichte hat. Vor etwa zwei Jahren schon schrieb mir mal ein Herr Eckert, den ich von Ascona und Zürich her kannte, er habe einen Verlag begründet, oder wolle es tun, und möchte von mir ein Buch herausbringen. Ich schrieb damals sofort zurück und bot „Glaube, Liebe, Hoffnung“ an, bekam aber dann von der Geschichte nichts mehr zu hören. Heut schickt mir Frl. Seidenbeck einen Brief nach, dessen Absender „Eckert u. Co. G. m. b. H. Verlag, Berlin, Burgstrasse 29“ heißt. Ich werde aufgefordert, das Stück dort einzusenden. Man wolle es evtl. als Subskriptionswerk verlegen. Ich bin sehr froh, auch darüber, daß mich das unsympathische Benehmen des Herrn Borngräber, den ich in Berlin deswegen besuchte, abgeschreckt hat, ihm das Stück zu senden. Ich habe starke Hoffnung, daß daraus was wird, und wenn aus der Geldsache erst positiv etwas geworden ist, verlasse ich mich auch im Glücksfall auf meine alte Theorie von der Duplizität der Vorgänge.
Bern, Sonnabend, d. 24. Juni 1911.
Das Geld ist da! Wirklich und wahrhaftig: ich bin reicher, als ich es je im Leben war, und nun werde ich mich erst an die gewaltige Tatsache gewöhnen müssen, daß ich – mindestens für einige Monate – in garkeiner Sorge um gelegentliche dringliche Erfordernisse zu sein brauche. Zwar: daß eine Lüge gegen Johannes dabei ist, verstimmt mich ein bischen. Aber ich habe Margrit das heilige Versprechen geben müssen, ihm und Iza nur 1500 Franken zuzugeben. Die übrigen 1500 brachten wir gleich, nachdem die Geschichte beim Notar erledigt war, zur Kantonalbank, die sie an die Münchner Filiale der Deutschen Bank überweist. Aber es war doch große Freude, als ich nachhause kam und einen richtigen echten rosafarbenen Tausendfrankenschein schwenkte und Iza 120 Fr. für ihr Doktorexamen und noch 80 für Extra-Ausgaben aushändigte. Johannes soll außerdem noch 50 Fr. kriegen, von denen Iza nichts wissen soll. Er soll sich mal eine Privatfreude gönnen können, über die er – wenigstens vorher – keine Rechenschaft ablegen muß. Ach, bin ich froh über das Geld. Ich will mich bemühen, den Tausendfrankenschein heil von Bern fortzubringen – nur fürchte ich, es wird nicht gelingen. Die Wirtin muß bezahlt werden. Wer weiß was Jadassohn fordert?, und Margrit habe ich schon 115 Fr. Schulden gezahlt, von denen sie 50 seinerzeit bei einer Verhaftung des Freundes für den Anwalt ausgelegt hat, 50 bei einer andern Gelegenheit Johannes und Iza geliehen und mit den übrigen 15 jetzt während meines Aufenthalts hier mir ausgelegt hatte. – Und drei volle Jahre durch wird mich kein Mensch um das Geld mahnen. Zum 24. Juni 1914 aber ist’s noch lange hin. Wenn die Rückzahlungspflicht akut wird, dann wird der „liebe Gott“ – ach, daß ich diesen Allverantwortlichen einmal loben darf! – schon wieder weiter helfen, da er ja jetzt gezeigt hat, daß er auch anders kann, als immer blos chikanieren und ängstigen. – In Zürich wird dann der Tausender gewechselt. Reitze kriegt 50 Fränkli und außerdem will ich versuchen, von dem Spediteur Kuoni die beiden Reisekörbe wiederzukriegen, die fast sieben Jahre dort liegen, mit allen alten Briefen und Andenken, Peter Hille-Manuskripten und Bildern, deren Verlust mich so oft schmerzt. – Dann in München will ich Uli und Lotte meine Schulden zahlen, sie und Emmy beschenken – alles ohne von meinem wahren Reichtum etwas merken zu lassen, und wenn womöglich die liebe Lene mit mir kommt – das sehe ich wohl ein – wird es jawohl nicht allzulange dauern mit dem Geld. Aber ein paar Wochen froh sein damit und ohne Angst für mich allen andern helfen können, das lohnt schon den Schmerz, nachher vor einem leeren Scheckbuch stehn und guten Tagen nachträumen zu müssen. – Soll ich noch aufschreiben, was außerdem mein Herz bewegt? Ach was! Ich bin so voll von Freude über den Ausgang dieser Aktion, an der ich zweifelte, bis das viele Geld wirklich in meinen Händen war, daß die heutige Einzeichnung von nichts anderm handeln soll. Heut ist ein guter Tag. Selbst das Regenwetter sehe ich mit liebenden Augen an. Mir ist, als wären die grauen Regenwolken, die den Himmel verhängen, Banknoten und die Regentropfen an den Telefondrähten blanke Silbermünzen.
Bern, Sonntag, d. 25. Juni 1911.
Die Erfahrung jeder Minute, daß im Caféhaus, beim Zigarrenhändler auf der Straße bei einem aufsteigenden Wunsch niemals die Erwägung kommt: Geht das noch mit der Kasse zusammen? Das Durchzählen des Geldes im Kopf und das Subtrahieren, das jetzt ganz wegfällt, giebt ein nie gekanntes ungeheures Gefühl weltmännischer Sicherheit. Ich erlebe jetzt und werde wohl in den kommenden Wochen noch viel mehr ein Vorgefühl dessen erleben, was mir vom Moment des Erbfalls an bleibend bevorsteht: eine innerliche Befreitheit, die sich ganz gewiß auch in meinen künftigen Erfahrungen geltend machen wird, die ganz besonders – davon bin ich tief überzeugt – mich auch für erotische Erfolge viel mehr prädestinieren wird als bisher die stetigen Sorgen, Ängste und damit im Zusammenhang die Dürftigkeit der äußeren Erscheinung. Jetzt werde ich ja zunächst nicht gleich an eine völlige Renovierung meiner ganzen äußeren Aufmachung gehn. Aber einen neuen Anzug und etwas Wäsche werde ich mir immerhin leisten. Das wird schon Wunder wirken. Nur muß ich erst die Gonorrhöe los sein. Bis dahin will ich sehr sparsam sein, damit ich dann, wenn ich wieder alles darf, auch imstande bin, einmal mit Sekt und Unbedacht alles zu tun.
Daß Lene mit mir nach München kommt, hoffe ich kaum mehr. Wir haben ihr gestern ganz menschlich und sehr eindringlich zugeredet, aber, wiewohl ihr manchmal die Lust, radikal mit der Vergangenheit zu brechen, flammend aus den Augen strömte, blieb sie bei der Weigerung. Gestern hat sie nun Johannes und mir gebeichtet, wie es eigentlich um die Familie steht. Johannes Kombinationen sind, wie so oft, viel zu weit geschossen. Aber, wie immer haben sie manches Richtige gefunden. Die Alte ist keine Puffmutter, wiewohl sie ihre Hände arg beschmutzt hat. Vor allem: Lene wird von ihr nicht verkuppelt und ist es nie geworden. Im Gegenteil glaubt die Mutter heute noch – natürlich fälschlich – daß sie unberührte Jungfrau sei. Das Geheimnis des Hauses Keßlergasse 15 ist folgendes: Hier in Bern lebt eine Frau, die in verschiedenen Stadtteilen geheime Bordelle unterhält und daraus kolossale Einnahmen bezieht. Nach dem Tode des Vaters Gugger, der ein ordentlicher Kerl gewesen zu sein scheint, geriet die Familie in Not, und da trat die erwähnte Huren-Exploiteuse mit dem Ersuchen an Frau Gugger heran, für sie das Haus Keßlergasse 15, in dem sie (die Gugger) damals schon ein Geschäft mit künstlichen Blumen, Spiegeln, Linoleum und dergleichen betrieb, das heute noch ihre Existenz ist, zu kaufen, da die Frau, die es haben wollte, selbst in zu schlechtem Ruf stand, als daß man es an sie weggegeben hätte. Lenes Mutter verdiente an den Scheinkauf 5000 Franken. Da das Haus nun natürlich in ein übles Renommee geriet, bat die tatsächliche Besitzerin Frau Gugger, der es ja nach dem Rechtsverhältnis gehörte, selbst hineinzuziehen. Die Miete wurde billig angesetzt und dadurch eigentlich ganz erspart, daß das Kuppelweib sich verpflichtete, den ganzen Bedarf für ihre Unternehmung im Guggerschen Geschäft zu beziehen. Außerdem erhielten Guggers die Erlaubnis zur Benutzung des ganzen Bodens und Kellers, und haben dadurch, daß eine Etage überhaupt nicht bewohnt ist, eigentlich Verfügung über das ganze Haus außer dem ersten Stock, wo ein einziges – angeblich sehr hübsches und liebenswürdiges Mädchen – allen anklopfenden Herren ihre Gefälligkeiten zu erweisen hat. Dabei wird viel Sekt vergossen und Lene meint, daß das junge Mädchen jedes Jahr an 50 000 Franken einbringt, wovon sie selbst fast garnichts behält, wohl aber sich schandmiserabel behandeln lassen muß. Natürlich ist in Bern das Gerücht entstanden und wird allenthalben verbreitet und geglaubt, Guggers unterhielten den Puff, und Lene macht es ihrer Mutter zum bitteren Vorwurf, daß sie sie zwingt, in diesem Hause zu wohnen und sich vor den schadenfrohen gemeinen Blicken aller Berner Klatschtanten zu schämen. – Sie erzählte uns das sehr ruhig und sicher, nachdem sie offenbar sehr schwer gekämpft hatte und versicherte, daß sie noch niemals vorher die Wahrheit über diese Dinge gesagt hätte. Ihre Worte waren so klar, eindeutig und ehrlich, daß jeder geringste Zweifel an der vollkommenen Wahrheit jeder Einzelheit ihres Berichtes eine Niederträchtigkeit gegen das sonst so undurchdringliche und gradezu schauerlich verschlossene Mädchen wäre. – Johannes war ebenso ergriffen und ebenso von der absoluten Zuverlässigkeit ihrer Worte überzeugt wie ich. Sie war in Augenblicken, während sie sprach, wenn sie einmal Atem schöpfte und mit den großen düsteren Augen entschlossen und stark vor sich hin blickte, begeisternd schön. – Warum sie nicht mit mir will, darüber war der letzte Grund nicht aus ihr herauszuholen. Ich erkläre es mir mit einer Fülle von Einzelmomenten, die sich ihr, ohne daß ihr Urteil eigentlich darüber klar wäre, zu einem bestimmten Gefühl gefestigt haben. Dazu gehört einmal die Rücksicht auf mich. Sie kann mich nicht lieben (alle ihre bisherigen Liebhaber waren homosexuell, und ihre Knabenhaftigkeit, die mich grade so sehr anzieht, mag es sein, die sie hemmt, mich zu lieben. Ich bin ihr wohl zu männlich.) Sich von einem Mann, dem sie sich in garkeiner Hinsicht erkenntlich zeigen kann,
Bern, Dienstag, d. 26. Juni 1911.
Meine psychologischen Spekulationen über Lenes Gründe, nicht mit mir nach München zu gehn, wurden auf ziemlich merkwürdige Art unterbrochen. Eine etwa fünfjährige Nichte der Lene, ein Töchterchen von Lenes älterem Bruder, der in der gleichen (Schwarzthor-) Straße wie wir wohnt, trat ein, steckte den Finger in den Mund und sagte: „Abi chumme“. Ich glaubte, Lene sei unten, nahm Hut und Stock – und wurde wortlos und ohne Gruß von – der alten Guggerin empfangen. Ich sprach sie an; sie erklärte darauf, Herrn Nohl sprechen zu wollen, der grade schlief. Da sie darauf bestand und sich entschieden weigerte, zu uns heraufzukommen, rief ich den Freund und nun legte die Alte los. – Wir hatten nämlich – soweit war ich bei der letzten Eintragung nicht gekommen – den Abend, an dem Lene uns gebeichtet hatte, mit ihr gebummelt, und sie war bis 3 Uhr nachts mit uns im Bahnhofsrestaurant gewesen. Frau Gugger hält mich für ihren Verführer, beschimpft sie – das hatte uns Lene schon erzählt, da sie meint, das Mädel sei in mich verliebt und haßt mich nun tötlich. Ich sei ein Mormone, hat sie der Tochter bereits gesagt, um damit ihrem tiefsten Abscheu Ausdruck zu geben. Uns erklärte sie, sie würde es nicht länger mehr ansehn, wie „das Kind“ in schlechten Ruf (sic!) gebracht würde, und drohend kündigte sie an, sie wolle Lene von einem Arzt untersuchen lassen, ob sie noch „heil“ sei. Sie habe die Macht über die Tochter und werde ihr nicht mehr gestatten, das Haus zu verlassen. Während sie also in ihrem berndütschen Kauderwelsch schimpfte, kam Lene die Straße daher, die uns versprochen hatte, uns um jene Zeit zu besuchen. Die Mutter befahl ihr, gleich mitzukommen. „I geh nit“ sagte Lene ruhig und trotz der aufgeregten Bemühungen der Alten, die endlich mit derben Schritten und voll finsterer Entschlossenheit abging, schloß sich Lene uns an und blieb eine Weile da. Dann begleitete Johannes und ich sie in die Stadt hinunter. – Da die Wut der Alten sehr groß war, und Lene offenbar eine Klärung der Lage sehr wünschte, bat sie uns, wir möchten abends zu ihr kommen. Inzwischen war es Abendbrotzeit geworden, und wir kamen erst gegen ½ 8 Uhr heim – um 7 Uhr pflegen wir sonst zu essen. Zu unserer Überraschung war Iza nicht zu Hause. Die Wirtin, Frl. Görg, erklärte, sie sei erst vor kurzem fortgegangen, und Johannes riet gleich, sie werde wohl in hysterischer Eifersucht fortgelaufen sein. Wir warteten eine Weile, aßen dann ohne sie und gingen, da Lene wartete, fort. Auf der Straße kam uns Iza entgegen, und Johannes ging mit ihr noch einmal ins Haus. Ich wartete sehr lange unten. Endlich kam der Freund, ganz außer sich vor Anstrengung und Aufregung. Iza hatte ihm eine schreckliche Szene gemacht, gedroht aus dem Fenster zu springen u.s.w. Als wir ein paar Schritte gegangen waren, rief sie ihn vom Fenster aus wieder an und machte wieder eine Gebärde, als ob sie hinunter springen wollte. Jetzt gingen wir beide hinauf. Neue Auseinandersetzungen. Ich redete ihr sehr ins Gewissen. Inzwischen war es aber mit der Kraft des Freundes zu Ende, der plötzlich in Tränen ausbrach. Es dauerte eine ziemliche Zeit, bis alles wieder soweit ruhig war, daß wir gehn konnten. Iza kam mit, und war nun natürlich sehr brav und nett. Aber ihre Hysterie ist gräßlich. Sie quält den armen Johannes grenzenlos. Sonst ist er das ganze Jahr hindurch fast jede Minute bei ihr. Jetzt, seit ich hier bin, geht er ziemlich viel aus, bleibt dann auch nachts länger im Café, und inzwischen geht sie nicht zu Bett und ist, wenn er heimkommt, beleidigt. Ich hatte, da ich doch sehe, daß ich die eigentliche Ursache aller seiner Verstimmungen bin, mehrmals die Absicht, vor der anfangs beabsichtigten Frist abzureisen. Doch hat es der Freund mir immer wieder ausgeredet. – – Am Abend also waren wir vorgestern alle bei Lene. Johannes und Iza gingen zur alten Gugger in die Küche, um mit der ein menschliches Wort zu reden. Ich war inzwischen mit dem süßen Ding allein, und sie war netter zu mir als je. Sie ließ mich sogar, ohne sich zu sträuben, Haare und Nacken von mir küssen. – Gestern früh kam sie dann wieder bei uns an – sie hatte sich von einer Besorgung in der Stadt weggestohlen, und gestern abend kam sie noch einmal per Fahrrad. Heute haben wir sie in den Zirkus eingeladen, und morgen will sie in aller Frühe herkommen und uns ihre Freundin vorstellen, mit der sie verabredet ist. Das soll ein ganz prachtvoll gutes Mädchen sein, das Lene abgöttisch und ganz selbstlos liebt. Ich bin neugierig auf den Besuch.
Gestern nachmittag waren wir im Café Bubenberg mit Margrit zusammen. Ich lernte bei der Gelegenheit einen früheren Gewerkschaftssekretär, namens Erdmann, kennen, einen ganz netten Menschen, mit dem ich Billard spielte. Er lud mich ein, in Zürich sein Gast zu sein. – Ferner traf ich im Café den Architekten Haller aus Zürich, mit dem ich im vorigen Jahr in der Cabaret-Zeit viel zusammen war. Er ist mit der Schwester von Emanuel Benda aus Lübeck verheiratet.
Von dem Gelde schmilzt die oberste Kruste allmählich fort. Noch ist der Tausendfrankenschein unversehrt in meiner Brieftasche. Aber ich sehe die Stunde, da ich ihn wechseln muß, deutlich kommen. Gestern haben wir – Johannes und ich – uns je einen Panamahut gekauft. Das hat 42 Franken gekostet. Es wird eine schmerzliche Stunde werden.
Ich las hier die Lebensgeschichte Eduard Mörikes, die die Gesamtausgabe seiner Werke, wie sie im Hesseschen Verlag von Rudolf Krauß herausgegeben sind, einleitet. Die Briefe, die da abgedruckt sind, sind wunderbar schön. So etwas lebendiges, frisches, persönliches, natürliches kenne ich in der ganzen Briefliteratur nicht wieder. Ich beneide Mörike oft um die Zeit, in der er leben konnte. Da war doch noch Beziehung zwischen den Geistern. Heute überall nur Neid, Konkurrenz, Schmälerung, Geschäft.
Als ich gestern abend zu Bett ging – Johannes leistete mir Gesellschaft – kam das Gespräch auf Frick und Frieda. Ich mußte sehr weinen.
München, Montag, d. 3. Juli 1911.
Eben bin ich (früh um 7 Uhr: jetzt ist’s ½ 9) mit dem Schnellzug von Zürich angekommen. Und nun heißt es nachtragen. Fünf volle Tage liegen zwischen der letzten Notiz und heute, und in diesen fünf Tagen habe ich mehr erlebt als gewöhnlich, sodaß ich alles Einzelne wohl nicht mit der Ausführlichkeit behandeln kann, die ich mir wünschte. Ich will nach der Reihe die Erinnerungen festzuhalten versuchen.
Mittwoch: Ich war bei Jadassohn, der mich untersuchte, mir eine verschärfte Injektion verschrieb und mir Fortsetzung der Behandlung bei einem Münchner Spezialisten empfahl, dem er einen Orientierungszettel aufschrieb, aus dem ich entnahm, daß keine Kokken mehr vorhanden seien. Ob der eitrige Ausfluß, der immer noch vorhanden ist, und seit gestern wieder heftiger eingesetzt hat, ein Anzeichen für neu belebte Kulturen ist oder eine unbedenkliche Erscheinung, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, daß jedes Tröpfchen Eiter, das mir aus der Harnröhre fließt, mich unendlich deprimiert und mir die zehn Wochen, die der Tripper jetzt schon alt ist, sehr empfindlich zum Bewußtsein bringt. Jadassohn verlangte für die Behandlung 40 Franken. Ich zahlte 20, versprach, ihm den Rest von hier aus zu schicken und ging von ihm aus zur Bank, wo ich 500 Mark an die Münchner Filiale der Deutschen Bank überweisen ließ und das übrige Geld des gewechselten Tausendfrankenscheins als Taschengeld zu mir nahm: Jetzt bestehn davon noch einige 40 Mark. Ich will Jadassohn statt der 20 Mark ein Kain-Gratis-Abonnement zuweisen. – Mittwochabend Zusammensein mit Lene und Margrit, die mich bat, ihr von hier aus 200 Franken zu pumpen für 2 Monate. Ich werde sie ihr durch die Bank überweisen lassen. Da ich Donnerstag fahren sollte, nahmen wir gerührten Abschied. Mit Lene hingegen wurde verabredet, daß Johannes Donnerstag früh noch einmal zu ihrer Mutter gehn sollte, um sie zu überreden, die Tochter abreisen zu lassen – wenigstens bis Zürich.
Donnerstag früh, als ich noch im Bett lag, klopfte es energisch an die Tür. Lene trat ein und berichtete, unten warte noch das Mädel aus dem ersten Stock Keßlergasse 15.
München, Dienstag, d. 4. Juli 1911.
Eine Reihe von Störungen, Unterbrechungen, neuen Eindrücken und plötzlichen Entschließungen ließ mich gestern nicht mehr zum Schreiben kommen. Ich fahre nach der Reihe fort:
Ich ließ also die beiden Mädchen unten warten, und als ich auf die Schwarzthorstrasse kam, lernte ich das arme Ding kennen, das im Gugger-Hause für schlechten Ruf sorgt: eine harmlose, keineswegs hübsche, verlebte und durchaus typische Hure. Man war per Droschke gekommen, und ich mußte nolens volens miteinsteigen und mit den beiden eine Spazierfahrt, die an einer kleinen Ausflugskneipe im Freien unterbrochen wurde, unternehmen. Ich merkte schnell die Absicht. Es handelte sich offenbar um den Plan einer romantischen Flucht aus der Keßlergasse. Beide Frauen wollten mit mir fort. Ich überlegte: die kleine Schneppe (Anny Galli mit Namen) wäre für alle Münchner Bekannten ein unmöglicher Verkehr. So lustig sie war – das ungewöhnliche Erlebnis hatte ihre Stimmung offensichtlich sehr gesteigert –, sie schwätzte doch recht törichtes Zeug zusammen. Ihr Intellekt und ihr Interessenkreis war sehr beschränkt; ihre Sehnsucht war, wie sie selbst sagte, wieder zu werden, was sie früher war: Verkäuferin in einem Delikatessengeschäft. Und nur, weil sie Hure war, weil sie sich in dem Puff unglücklich fühlte, und weil anscheinend Lene eine Bekannte in München haben wollte, mir einen solchen Verkehr, der eine schwere Nervenbelastung für mich geworden wäre und mir den Verkehr mit meinen wertvollen Freundinnen, Uli, Lotte, Emmy versperrt hätte – nicht aus Moralgründen, sondern weil eine gewisse Differenziertheit doch Vorbedingung eines freundschaftlichen Zusammenhangs in unserem Kreise ist – nur aus mildtätigem Mitleid mir eine Last aufhalsen – ich erkannte, daß ich dazu nicht imstande sei. So schlug ich vor, beide Mädchen sollen mit mir abreisen. Anny solle in Zürich bleiben, wo sie gewiß schnell ein Unterkommen fände und Lene und ich sollen miteinander nach München. Als Anny einmal in jener Kneipe uns allein gelassen habe [hatte], und mich Lene nach meiner Meinung fragte, sagte ich ihr offen darüber bescheid. Von der Minute an war Lene verändert: sie sagte, sie hasse mich, sie wolle sofort nach Hause zurückfahren, und ich hatte große Mühe – denn einen häßlichen Abschied von ihr wollte ich durchaus nicht –, die beiden zu bewegen, wieder mit mir heimzufahren. Johannes stand inzwischen auf, und nun war in Lene von Minute zu Minute ein Wechsel der Entschlüsse sichtbar. Wir merkten schließlich, daß sie ohne die Freundin nicht mit mir mochte, und nachdem Johannes, Iza und ich ihr vergebens zugeredet hatten, entschied sie sich negativ. Oft kämpfte sie, während wir sprachen, mit Tränen und auch mir war es heiß hinter den Augen. Die kleine Hure schwätzte inzwischen immer weiter, und als es zum Abschied ging, sagte sie mir bedeutungsvoll: „Auf Wiedersehen – hoffentlich bald.“ Lene dagegen brachte vor Erregung kein Wort des Abschieds heraus. Sie drückte mir die Hand und sah mir ins Auge, daß ich wußte: diese Liebe zu erringen wäre keine Unmöglichkeit, – in dem Moment mindestens hatte ich sie schon. Inzwischen war die Zeit, wo wir zum Bahnhof aufbrechen mußten, herangekommen. Johannes und Iza begleiteten mich, und wir fuhren mit der Straßenbahn ab. Kurz vorm Ziel sahen wir, wie die beiden Mädel Arm in Arm zum Bahnhof einbogen. Sie waren also noch immer im Zweifel, hofften noch immer, ihr Wunsch werde erfüllt werden. Als sie eben in den Bahnhof hineingehn wollten, wir betraten ihn grade in einem andern Portal, holte ein junger Mann sie ein, sprach sie an, und wir beobachteten, daß sie mit ihm wieder abbogen. Wir bestellten jetzt im Bahnrestaurant Mittag für uns drei. Johannes aber brach auf, um noch einmal mit Lene zu reden. Es dauerte lange, bis er wieder kam. Dann berichtete er, er habe sie eingeholt, und sie noch einmal zu überreden gesucht. Sie sei aber in großer Aufregung weiter und nachhause gegangen. Jetzt erst – eine Viertelstunde vor Abgang des Zuges – war entschieden, daß ich allein fahren sollte. Der Abschied von Johannes war sehr schwer für uns beide. – Als der Zug sich in Bewegung setzte, sah ich, wie er an Izas Arm, ohne noch einmal umzublicken, die Treppe des Bahnsteigs hinabging. Ich wußte, daß er weinte, und ich blieb lange außerhalb des Kupees stehn, damit die Mitreisenden meine Augen nicht sähen. Mein Freund! Mein lieber, teurer, reiner Freund! Diese Tage in Bern haben uns wieder so eng aneinander geführt, daß wir einen Bruch dieser Freundschaft gewiß nicht mehr zu fürchten haben. Die Küsse, die wir diesmal getauscht haben, waren rein und frei von all der Verstohlenheit und Gier, die uns früher so oft den guten Bund gestört hat.
Auf der Reise geschah mir etwas Eigentümliches. Während der Zug in Olten hielt, stand gegenüber auf dem Gleis ein andrer Schnellzug, auf dessen Wagenschildern ich las, daß er von Berlin nach Mailand fuhr. An einem Fenster zweiter Klasse erblickte ich plötzlich einen alten Herrn, dessen frappante Ähnlichkeit mit meinem Vater mich verschreckte. Auch er sah mich an, und der Zweifel: Ist er’s? Ist er’s nicht? ängstigte mich nachgrade ungeheuer. Er kam mir gealtert vor, auch wollte mir scheinen, daß der Übergang von den Backen zum Hals ein andrer war als bei Papa, zudem sagte ich mir: es ist doch ganz ausgeschlossen, daß er, ohne daß ich etwas wüßte, plötzlich nach Italien fährt: und doch war mir abscheulich zu Mute und ich war froh, als der Zug mit dem Doppelgänger losfuhr.
Am Züricher Bahnhof erwartete mich der brave Reitze, der mich zum Hotel Bären am Limmatquai führte. Von da ging’s Einkäufe machen. Ich erstand einen hellen Waschanzug, da es sehr heiß war. Außerdem, da meine Uhr – die ich vor Jahren von einem Genossen für 1,50 Mark gekauft hatte, kaput war, – eine alte silberne für 3,50 Fr. Sie ist sehr hübsch und scheint ausgezeichnet zu gehn. Die alte Nickeluhr schenkte ich Reitze – außerdem gab ich ihm 50 Fr. –, ließ sie aber noch auf meine Kosten reparieren. In seinem Hause sah ich die Frau und die beiden Töchter, von denen die älteste – jetzt 15jährig – sehr anmutig ist und bald sehr begehrenswert sein wird. Reitze hatte mir zu meiner freudigen Überraschung gesagt, daß Otto Gross in Zürich sei, und während ich beim Schneider war – einem tschechischen Genossen, der mir Taschen in den neuen Anzug nähte, kamen die beiden an. Ich war dann die meiste Zeit meines Züricher Aufenthalts mit Gross beisammen, und wir vertrugen uns sehr gut. Zwar wars das erste, daß er mir das Versprechen abpreßte, ich müsse für eine Zeitschrift die er gründen wolle, 100 Franken hergeben. Auch war er zuerst etwas argwöhnisch und wollte vor allen Dingen nichts von meinem Vorschlag wissen, er müsse Johannes Nohl zur Mitarbeit heranziehn. Dem nimmt er den Artikel über Landauers Buch übel, worin er seinen Gottbegriff erläutert. Aber allmählich gewann ich ihn und wir wurden wirklich Freunde. – Sofie Benz‘ Tod frißt furchtbar an dem armen Menschen. Er hat alles verloren mit ihr, was ein Mensch überhaupt verlieren kann und oft sah ich ihn in diesen Tagen um die Geliebte weinen. Schrecklich ist auch die Kokainsüchtigkeit bei ihm. Ewig auf dem Sprung zur Apotheke, ewig mit der Schachtel in der Hand und mit dem Kiel in der Nase, die immer verletzt und mit Salbe verschmiert ist. Dabei halluziniert er neuerdings viel, hört Beschimpfungen gegen sich, er sei ein Feigling etc. Ich ging sehr auf seine Art ein und bemühte mich, seine psycho-analytische Methode an ihm selbst unmerklich anzuwenden. Es gelang mir auch allmählich die Selbstvorwürfe, die er sich wegen Sofie macht, zu entkräften. Jedenfalls bin ich jetzt darüber sicher orientiert, daß er sich nicht blos nicht die Anregung zu dem Selbstmord gegeben hat, sondern seit langer Zeit bei Sofie gegen die Tendenz gearbeitet hat, ihn zu begehn. Sehr lange Gespräche – ich antizipiere hier schon die folgenden Tage – hatte ich mit ihm über Frick. Der hat zuletzt noch mit Sofie Verhältnis gehabt. Er hat dann nach ihrem Tode Gross, der von Schmerz völlig zerrissen war, die Schuld gegeben, und Gross hat infolgedessen eine sehr abweisende Stimmung jetzt gegen Frick. Auch über Frieda sprachen wir viel, die – ich Pechvogel! – zwei Tage vor meiner Ankunft in Zürich gewesen war. Ich ließ Gross recht tief in mich hineinschauen und habe die Gewißheit, daß er in günstigem Sinne über mich an Frieda berichten wird. Das muß mir um so wichtiger sein, als doch vielleicht damals, als ich die Geliebte verlor, seine Gehässigkeiten auf ihre Stellung zu mir eingewirkt haben mögen. Er hat mich beim Abschied vorgestern wegen all dieser Dinge sehr um Verzeihung gebeten. Dieses häufige Erinnern an Frieda in dieser Zeit des Zusammenseins mit Gross hat mich furchtbar ergriffen, grade weil er seinerzeit die glücklichste Periode meines armen Lebens so nah mitangesehn hatte, und da er der war, der nachher am hitzigsten gegen mich bei Frieda gewühlt hat.
Am Freitag besuchte ich mit Reitze etliche Genossen, die wir einluden, abends zu einer Zusammenkunft in den Stüssihof zu kommen. Darunter war ein italienischer Schuster, bei dem ich das Bild von Caprista sah, für das er 9 Jahre Zuchthaus bekommen hat. Es ist eine Lithographie, auf der allegorisch die Kämpfe in Spanien mit Ferrer dargestellt sind. Künstlerisch nicht sehr bedeutend, doch aber kräftig komponiert und hingestellt. Der erste Abdruck ist von Bertoni ausgelost worden, und dieser Schuster hat ihn bekommen. Noch ein andres antiklerikales Bild des unglücklichen Künstlers hängt in dem Zimmer; doch ist das eine mindere Reproduktion. – Auch Paula Steininger besuchte ich. Eine liebe, gute Frau, die mich freundlich begrüßte. Wir sprachen hauptsächlich über Beatrice Pallon. – Abends war dann nun die Genossenzusammenkunft: 15–18 Personen, darunter Winkler und Cilla, die beiden von München Ausgewiesenen, letztere mit Herrn Itschner, der mir schauderhaft unsympathisch ist. Ich sprach über den Autoritätsbegriff und untersuchte die Gründe, aus denen die Versuche in Zürich und anderswo – ich hätte getrost München nennen dürfen – keine anarchistischen Gruppen sich halten können, weil eben die Losgelöstheit von der Autorität bei den Anarchisten noch nicht so selbstverständlich sei, daß der natürliche Ersatz, die Kameradschaft notwendig entstehn müsse. Als ich grade mit dem 1½stündigen Vortrag fertig war, kam Gross, der sich jetzt auch offen zum Anarchismus bekennt (sein Blatt soll heißen „Psychologische Zeitschrift für Anarchismus“). In der Diskussion redete Itschner, der den Parlamentarismus verteidigte, dann auch Gross über Vaterautorität etc., gegen das Familienprinzip. Leider machte ihn Cilla dadurch, daß sie sich zwischendurch unterhielt nervös, sodaß er stecken blieb und mitten in der Rede abbrach. Ich fertigte nachher den Itschner so gründlich ab, daß Gross mir nachher etwas übertrieben Glück wünschte und behauptete, eine so vorzügliche polemische Rede habe er noch nie gehört. Übrigens hatte sich an diesem Tage im Café Terrasse Herr v. Zuppan eingefunden, der aus dem österreichischen Offizierskorps geflüchtet ist. Ich führte ihn in den Anarchistenkreis ein. Keine intellektuelle Kapazität, aber, wie es scheint, ein sehr anständiger Kerl. Ich habe den Wunsch, daß Gross sich mit ihm anfreunde. Zuppan kann im Verkehr mit dem genialen Menschen unendliches profitieren, und Gross braucht Anschluß wie das liebe Brot. An sonstigen Bekannten traf ich in Zürich den (jungen) Schauspieler Dannegger und Gstaller. Brupbacher und Tobler sah ich nicht. Sonnabend hatte Gross einen sehr schlechten Tag. Reitze und ich zwangen ihn, sich völlig umzuziehn. Er hatte seit 14 Tagen das Hemd nicht vom Leibe gezogen gehabt. Er hatte viel Halluzinationen und war sehr unglücklich und gedrückt. Abends vorher wollte er nicht schlafen gehn, und so blieb ich mit ihm bis ½ 10 Uhr morgens beisammen. Wir hatten sehr ernste und gute Gespräche, und diese Nacht war es eigentlich, die uns zur Freundschaft zusammenführte. Morgens um ½ 8 erschien zu meiner Freude im Bahnhofsrestaurant, wo wir Café tranken, Gustel Waldau. Merkwürdigerweise duzten wir beide uns, als ob es so sein mußte. Das Auftauchen dieses charmanten Kerls tat mir sehr wohl, da ich von den schwierigen Gedankengängen, in die das Gespräch mit Gross fortwährend zwingt, sehr angegriffen war. Man hielt mich dann noch, eigentlich gegen meinen Willen, den ganzen Sonnabend und Sonntag in Zürich fest. Als ich Sonntag abend, begleitet von Reitze, Gross und noch einem alten braven Genossen zur Bahn ging und dann abfuhr, stand Gross am Zuge und weinte.
Ich muß abbrechen, da Steinebachs Druckerei auf mich wartet.
München, Mittwoch, d. 5. Juli 1911.
Über die Begegnungen seit meiner Rückkunft nach München nur einiges, was mir einfällt. – Zuhause fand ich einen dicken Stoß Drucksachen vor: Halbes „Tat des Dietrich Stobäus“ (bei Albert Langen), ein sehr dickleibiger Roman, den ich zu lesen begonnen habe. Ferner eine Schrift von Friedrich Stieve: „Kampf unserem Jahrhundert“ bei Haupt und Hammer, Leipzig 1909. Die neue Nummer des „Sozialist“, in der Landauer seine Frechheiten gegen Johannes fortsetzt und Berndl einen unverfrorenen seichten Aufsatz über Psychoanalyse ausschleimt. Eine Landauersche Fußnote, in der er private Mitteilungen über Otto Gross’ Art, in Gesten Symbole zu suchen, öffentlich ausbreitet, vervollständigt die Berndlsche Unflätigkeit. Die erste Juli-Nummer des „Pan“, in der sich Kerr in einem Artikel „Caprichos“ mit Karl Kraus auseinandersetzt. Es ist ziemlich das gröbste was ich noch gedruckt gesehn habe, aber es war notwendig, den größenwahnsinnigen Wiener einmal gründlich zu stäupen. Kerr trifft ihn an den wundesten Stellen. – Der „Wohlstand für alle“ war da und „Neue Bahnen“ ein sozial-ethisches Blättchen, das in Heilbronn erscheint mit einem recht dummen Artikel gegen Landauers „Aufruf zum Sozialismus“. Ferner die „Karpathen“.
Schon Montag in der Frühe war ich in der Druckerei, und lieferte die Korrekturen ab. Es stellte sich heraus, daß noch Platz war in der neuen Nummer und so schrieb ich noch eine Notiz über den Dr. Orterer, der als Rektor des Luitpoldgymnasiums ganz bodenlose Chikanen gegen seine Schüler treibt. Leider erfuhr ich gestern, daß noch mehr Platz gewesen wäre, den ich, wenn mir Steinebach die Korrekturen rechtzeitig geschickt hätte, leicht und gern hätte füllen können. So mußten wir eine ganze Seite geschäftliche Mitteilungen in den Text hineinnehmen. – Von näheren Bekannten traf ich zuerst Thesing, den Maler, den ich von Ascona her kannte, und der mit Bolz befreundet ist.
Nachher kam das Puma ins Stefanie. Sie war sehr lieb und erzählte mir viel. Von ihr erfuhr ich, daß Lisa Sensburg in Berlin plötzlich an galoppierender Schwindsucht gestorben sei. Ich sprach sie noch im April im Café des Westens. Von sich selbst und von Uli berichtete sie einiges (Uli traf ich noch nicht). Sie (Lotte) hat ein paar kleine Ehebrüche hinter sich, und dann fragte sie mich geheimnisvoll etwas, was mich sehr entsetzte: ob ich ihr nicht Cocain besorgen könne. Ein Herr, den sie nicht nennen wolle, habe ihr mal etwas gegeben, was sie eingeatmet habe, und das sei sehr angenehm gewesen. Ich lehnte sehr energisch ab, ihr etwas zu besorgen, und machte ihr durch Schilderung der möglichen Folgen die Hölle heiß. Als ich ihr erzählte, wie Gross infolge des ewigen Cocain-Schnupfens stets mit lädierter und besalbter Nase herumläuft, verlor sie ganz die Lust zu der Vergiftung, und ich hoffe, sie wird nicht darauf zurückkommen. Ich ging dann mit ihr in die Kaulbachstraße zu ihrer Premiere, wo ich ihr Hände, Hals und Haare küßte, dann zu Strich in die Seestraße, der sich von Berlin John Höxter mit hergebracht hat. Alle drei aßen bei mir Abendbrot. Nachher gingen wir ins Luitpold, wo wir Strichs Bruder und Herrn v. Sörgel trafen, dann alle zusammen in die Torggelstube. Am Stammtisch saß mit einigen Schauspielern, von denen ich nur Weigert kannte, Professor Anthes, und als Lotte mit ihrer Gesellschaft gegangen war, schloß ich mich dem Stammtisch an und zog mit Anthes und den andern ins Orlando di Lasso. – Auch gestern war Anthes, der ein sehr netter Kerl ist, wieder in der Torggelstube. Wir unterhielten uns, da er Professor an der Lübecker Ernestinenschule ist, ausgiebig über Lübecker Angelegenheiten, über die Familie Fehling, Emanuel Benda und viele andre, dann über Mieze Wichmann, die katholisch geworden und ins Kloster gegangen ist. Heute vormittag war Anthes bei mir, um das Manuskript der „Freivermählten“ auszuleihen und sich die bisher erschienenen Kain-Nummern zu holen.
Gestern abend kam ein galizisch-jüdischer Student zu mir, dem es schlecht ging. Dr. Ludwig hatte ihn mir rekommandiert. Ich half ihm mit ein paar Groschen aus und lud ihn zum Abendbrot ein. Der Kerl interessierte mich erst nachträglich wegen einer Äußerung. Er meinte, Juden mit progressiven Ansichten müßten ihre Meinung unterdrücken, weil sie sonst dem Judentum insgesamt schadeten. Ich antwortete ihm, ich würde meine Meinung stets offen heraussagen, auf die Gefahr hin, daß ich sogar mir selbst damit schadete. Er verstand den Komparativ nicht. – Heut wurde ich schon wieder angeschnorrt, was 2 Mark kostete. Wenn die Menschen wenigstens nicht so demütig dabei wären! Wie die Hunde, die geprügelt werden. Widerlich.
Ich erwarte jetzt jeden Augenblick den neuen „Kain“. Schade, daß ich den Artikel über Mottls Tod noch nicht schreiben konnte. Der berühmte Dirigent bekam auf eine Anrüpelung der Münchner Post hin, die ihm bei seiner Verlobung die uneheliche Herkunft aufmutzte, abends bei der Tristan-Aufführung einen Herzkrampf und starb vorgestern. Jetzt will ich für die August-Nummer einen vernichtenden Angriff gegen die schmierige Gesellschaft schreiben, die damit, daß sie vor aller Welt schmutzige Wäsche – oder was sie dafür hält – ausbreitet, und jeden verdienteren Menschen persönlich bedreckt, sozialistische Aufklärung zu schaffen meint. Seht euch vor, Schweinehunde!
München, Donnerstag, d. 6. Juli 1911.
Gestern habe ich viel Geld ausgegeben, und in wenigen Tagen – das sehe ich voraus – werde ich wohl von den 1400 Mark, die ich bei der Deutschen Bank deponiert habe, von denen keiner nichts weiß, ein Bätzlein herunternehmen müssen. Die Checks für Gross (100 Fr.) und Margrit (195 Fr.) habe ich schon in der Tasche. – Gestern zahlte ich nun – da inzwischen auch das Geld von Onkel L. gekommen ist, an Uli 5 Mk meiner Domino-Schulden und an Lotte 25 Mk, die ich ihr von Weihnachten her noch schuldig bin. Außerdem leistete ich mir mal wieder das Vergnügen, mit dem Puma Einkäufe zu machen. Ich schenkte ihr eine neue Handtasche, einen Unterrock und etliche Paare Strümpfe, was gegen 25 Mk kostete, und kaufte mir selbst für etwa 12–15 Mk Hemden und Strümpfe, die ich notwendigst gebrauche. Das Puma war wieder ganz süß – und hat mir ein Piacere versprochen, das sich allerdings, da meine infame Krankheit immer noch vorhanden ist, in Formen wird bewegen müssen, bei denen ich nicht ganz auf meine Kosten werde kommen können. Aber – wenn ich nur ein paar Küsse bekomme! Dann will ich zufrieden sein.
Zum Abendbrot waren Morax und R. bei mir, der in Geschäften hier zu tun hatte und morgen wieder da sein wird. Er erzählte, daß Otto Gr. fortwährend von mir spricht und sehr überlegt habe, ob er nicht mit nach München fahren soll. Er arbeite an einem Brief an Frieda über mich und über seine Irrtümer in seinem Verhalten gegen mich. Das ist mir natürlich lieb, aber daß Frieda deswegen ihre Gefühle zu mir revidieren sollte, will ich weder erwarten noch wünschen. Meine Liebe zu ihr ist golden und stark und dauerhaft genug, um warten zu können, bis ihre eigne Kraft die Erwiderung erzwingt.
Der neue „Kain“ ist da. Leider hatte sich im letzten Moment noch herausgestellt, daß ich nicht genügend Manuskript geliefert hatte. Durch die Bummelei des Druckers – eine Unterbrechung: ein alter weißhaariger Schauspieler, der ohne Engagement herumläuft und Hunger hat – 2 Mark. – – Durch die Bummelei des Druckers also hatte ich die Korrekturen erst am Sonntag nach Zürich gekriegt. Ich hatte extra weniger Manuskript geschickt, weil sonst jedesmal die Schwierigkeit gewesen war, den Übersatz herauszustreichen. Das evtl. Fehlende hoffte ich sehr schnell nachliefern zu können. Montag hatte mir der Setzer nun gesagt, 1½ Seiten fehlten, worauf ich anordnete, daß das Gedicht „Widmung“, das schon in die erste Nummer hätte hineinsollen, auf die erste Seite gesetzt werden sollte, und den Artikel „Der Herr Rektor“ noch schrieb. Zu guterletzt stellte sich dann heraus, daß noch eine ganze Seite Platz war. Wäre ich erst heimgelaufen, etwas schreiben, so wäre das Erscheinen noch um mindestens einen Tag verschoben worden. So gab ich die Correspondenz an die Leser, die sonst meist auf den Umschlagdeckel kommt, und das Inhaltsverzeichnis der ersten Hefte auf die letzte Seite, und dadurch sieht das ganze etwas gereckt und künstlich ausgefüllt aus, was um so fataler ist, als ich mich in der Notiz an die Leser beweglich entschuldige, ich fände für literarische Beiträge, die man von mir erwartete, durchaus keinen Platz. Ich sehe jedenfalls, daß ich fürs erste nicht mehr verreisen darf.
Abends Kegelbahn. Voll besetzt: Halbe, Roda Roda, Georg Queri, Meßthaler, Scharf, Anthes, Etzel, Wilm, Lahmeyer, Baas, Stücklen, der Zeichner Schönpflug von der „Muskete “ als Gast, Jodocus Schmitz und ein Herr Brann oder so ähnlich, ein Freund Halbes. Es war sehr lustig, besonders machte Queri unausgesetzt – und zwar hier und da recht gute Witze. Nachher im „Simpl“ mußten wir die geräuschvollen Taktlosigkeiten der Frau Scharf über uns ergehn lassen. Emmy saß an einen Polen, einen Freund Przybyszewskys (der selbst auch Emmy liebt) eng angedrückt, und sang nachher meinen „Gesang der Vegetarier“. Ich hatte sie nachmittags schon mit Hardekopf im Luitpold getroffen. Das Verhältnis zwischen den beiden Menschen gefällt mir garnicht mehr. Hardys krampfige Scheu wirkt immer grauenhafter. Er sieht schuldbeladen aus. Bei nächst passender Gelegenheit will ich mal wieder mit ihm Fraktur reden.
München, Freitag, d. 7. Juli 1911.
Eigentlich hatte ich heute zum Justizpalast gehn wollen, wo im Schwurgericht der Dr. Semerau abgeurteilt werden soll, weil er mit dem Marquis de Bayros zusammen „unzüchtige“ Schriften verbreitet hat. Ich ließ mich deshalb schon um ½ 9 Uhr wecken, stand aber erst gegen 10 Uhr auf und überlegte, daß es gescheiter sei, einige wichtige Correspondenzen zu erledigen. So schrieb ich an Arthur nach Waidmannslust, der morgen Geburtstag hat. Ich schickte ihm die Gedichte von Heinrich v. Reder. Zugleich teilte ich ihm die Themata mit, über die ich evtl. bei den Studenten in Berlin sprechen möchte (Herr Max Rosenthal hatte mich als Vorsitzender der Kunstabteilung der Freien Studentenschaft vor einigen Wochen aufgefordert). – Ferner schickte ich Margrit ihren Scheck über 195 Fr. und dem Verlag Eckert das Manuskript von „Glaube, Liebe, Hoffnung.“ – Der unangenehmste Brief steht mir noch bevor: der an Landauer. Ich will ihm heut oder spätestens morgen schreiben, obwohl ich voraussehe, daß unsere mehr als zehnjährige Freundschaft daran kaputgehn wird.
Gestern traf ich im Hofgarten Lotte, Strich, Uli, Seewald, den widerlichen Sörgel und den kleinen Herrn v. Hörschelmann. Mit dem ging ich zu Thannhauser in die Ausstellung, wo ein Herr – ja wie heißt er nur? Mir scheint: Rippli mit noch einem exotischen Anhängsel – ausgestellt hat. Im „Komet“ hatte man den Mann neben Hodler gestellt. Das ist komplett blödsinnig. Ein wirklicher Künstler ist er schon und eine erfreuliche Erscheinung. Aber ich fand, daß seine Bilder wie brillante angetuschte Zeichnungen aussehn. Ein ganz raffinierter Techniker, der viel mehr kann als er ist. Ihn mit dem Genie Hodler zu vergleichen, ist vollendete Idiotie. Wir gingen dann noch in die oberen Räume, wo sehr viel Dreck und ein Saal voll Hodlers hängt. Das nenne ich Kunst, Erlösung, Überschwang! Wie gebadet kam ich heraus. Dann ging ich mit Hörschelmann ins Stefanie, wo Uli und Lotte waren, und von da aus kamen Lotte und Hörschelmann zu mir, Kaffee trinken. Der Zwerg ist ein sehr interessanter Mensch. Seine kindliche Aufmachung und sein Kinderorgan kontrastieren merkwürdig zu den gescheiten Sachen, die er sagt. – Er erzählte mir von Gumppenbergs „Drittem Testament“, das er in seiner sehr reichen Erstausgaben-Sammlung besitzt und von Wedekinds Parodie darauf „Das neue Vaterunser.“ Er lud mich ein gleich mit ihm zu kommen, um die alte Wedekindsche Schrift, die er unter dem Pseudonym v. Trenck herausgegeben hat, bei ihm zu lesen. Ich tat das. Zuerst das Vorwort von Gumppenbergs „Drittem Testament“, das im Jahre 1891 erschienen ist. Gumppenberg berichtet da allen Ernstes von spiritistischen Sitzungen, in denen ihm von einem jüdischen jungen Mädchen, das im 17ten Jahrhundert in Kleinasien gestorben sei und sich „Gelru“ nannte, Gottes Offenbarung diktiert wurde „wie Moses und Buddha“. Es ist köstlich, diesen pedantischen Phlegmatiker da als neuen Heiland aufmarschieren zu sehn. – Wedekinds Parodie, deren Einleitung Gumppenberg blutig verhöhnt, ist eine sehr freche, aber zugleich sehr schöne Dichtung. Das Vaterunser wird von Zeile zu Zeile mit einem verbindenden Text versehn, der in ausgezeichneten Versen die wilde Schilderung einer orgiastischen Liebesvereinigung giebt. Zum Schluß folgt „die erste Kommunion, Lieschen klettert flink hinauf in die obersten Äste“, von der ich nicht wußte, daß sie überhaupt gedruckt sei. Die frühe Arbeit Wedekinds interessierte mich ungemein, und ich will Wedekind, sobald ich ihn erwische, bitten, mir ein Exemplar des als Privatdruck erschienenen Werkes zu dedizieren ... Abends war ich in der Torggelstube, wo ich lange allein saß, bis Höxter und sein ihm aus Berlin nachgereister Freund kam, der sich van Hoddis nennt und natürlich anagrammatisch Davidsohn heißt. Wir spielten noch im Café Orlando di Lasso Billard und im Stefanie Schach. Nach 3 Uhr kam ich nach Hause.
Der Tripper plagt mich in diesen Tagen wieder sehr. Es ist immer noch und immer wieder Ausfluß da und nach dem Einspritzen brennt die Harnröhre so, daß ich die Wände hochlaufen möchte. Nachher sehe ich mal das Adreßbuch nach einem Tripperspezialisten durch.
München, Sonnabend, d. 8. Juli 1911.
Bis zur Torggelstube geschah nicht viel Vermerkenswertes: höchstens, daß ich mal wieder an Uli 7 Mark im Dominospiel verlor, und daß R. wieder auftauchte. – Auf dem Wege zum Torggelhaus traf ich Roda Roda mit Frau, die eben von dort wieder umkehren wollten, weil niemand da war. Wir gingen zusammen hin. Roda ist in großer Erregung. Er hatte mir schon vor einigen Tagen geheimnisvoll erklärt, er wolle mir einen offenen Brief in den „Kain“ schreiben, der sich gegen Reinhardt richten soll. Damals wollte er mit der Sprache noch nicht heraus. Gestern erschien nun in der „Münchner Zeitung“ eine Protesterklärung von ihm gegen die Aufführung der Operette „Themidor“, deren Text er mit einem Herrn Steffan zusammen verfaßt hat, und die das Künstlertheater zur Aufführung angenommen hat. Man hat ihm da Streichungen von Stellen gemacht, die er für sehr wichtig hält. Mir schien, er sieht die ganze Geschichte sehr durch das Vergrößerungsglas seiner subjektiven Gekränktheit. – Nachher kam Anthes, und später Wedekind. Es gab recht unterhaltende Gespräche, und Roda Roda erzählte sehr Interessantes von den Türken in seiner serbisch-kroatischen Heimat und über den Islam überhaupt. Von einem andern Tisch ließ mich eine schauspielerinhafte jüngere dickliche Dame herüberbitten. Sie stellte sich als Grete Gräf vor und behauptete, wir hätten vor zwei Jahren einmal einen vergnügten Abend mit Orlik zusammen im Dafé in Berlin zugebracht. Ich hatte keine Ahnung mehr davon, bestätigte ihr aber höflich, ich sei sehr erfreut sie wiederzusehn. Auch erinnerte sie mich an eine Nacht bei Bols mit Wegener, deren ich mich recht deutlich entsinne, da ich mich damals heftig in Frl. Kündinger verliebte. Ich glaubte auch, die ganze Zusammensetzung der Gesellschaft rekonstruieren zu können – aber daß auch Frl. Gräf dabei war, hatte ich vollkommen vergessen. Auch ihr Ehemann war gestern da. Er heißt Mewes und erinnerte mich an eine andre Geschichte, wie wir uns schon mal kennen gelernt hatten. Ich sei eines Morgens mit Johannes Nohl ihm auf die Bude gerückt, um ihn anzupumpen. Johannes habe einige dicke Schulbücher von ihm mitgenommen, dann seien wir wieder losgeschoben. Dieser Geschichte erinnere ich mich allerdings sehr deutlich. Das war in den ersten Wochen meiner Freundschaft mit Johannes – also entweder Ende November oder Anfang Dezember 1903, – jedenfalls noch vor dem Tobsuchtsanfall am Weihnachts-Heiligabend. – – Auch der Schauspieler Reisig vom Künstlertheater war in der Torggelstube. Ich hatte ihn lange nicht gesehn.
Nachher ging ich noch mit Anthes ins Orlando di Lasso. Er sagte mir außerordentlich Lobendes über die „Freivermählten“. Er findet es unbegreiflich, daß sie weder gedruckt noch aufgeführt werden. Daß die Vertretung freiheitlicher Ansichten, die nicht demokratisch-liberal sind, in Deutschland bei Bürgern, Sozialdemokraten und Caféhäuslern als halb närrisch, halb verbrecherisch gilt, will durchaus kein Mensch glauben. Heut früh, als ich noch im Bett lag, brachte Anthes das Stück wieder. Wedekind schickt mir eine Visitenkarte mit der Bitte an Stolberg, mir heut abend ein Billet zur Premiere von „So ist das Leben“ zu geben. Ich bin auf den Ersatz für die schwangere Tilly Wedekind recht gespannt. Es wird wieder ein netter Theatermonat werden, dieser Juli.
München, Sonntag, d. 9. Juli 1911.
Ich habe an Landauer geschrieben. Leicht ist mir der Brief – beim Himmel! – nicht geworden, aber grade darum ist er nun frei von allem diplomatischen Einlenken und Brückenbauen. Ich will Klarheit. Ich will eine Antwort, aus der ich wissen kann, ob unsre Freundschaft fortbestehn kann oder nicht. Ach, daß ich doch nicht schon wüßte, wie die Antwort ausfallen wird! Landauer ist kein Mensch, der imstande wäre, sich Unrecht zu geben. Ich kenne seine Art zu gut: er wird alles, was er gegen Johannes hat beschönigen und durch rabulistische Erklärungen mit seinem Privatverhalten in Einklang bringen, und alles, was er gegen Gross und die Psychoanalytiker schrieb, wird er noch einmal dick unterstreichen, um nur nicht Unrecht haben zu müssen. Wie wollte ich froh sein, wenn ich ihn falsch taxierte! Wenn er mir schriebe, er gebe zu, daß er im Schreiben heftiger und polemischer gegen Nohl geworden sei, als seine Absicht war. Er sehe ein, daß er auch den Psychoanalytikern vielleicht nicht gerecht geworden sei. – Seine Abneigung gegen das ganze System sei aber so groß, daß er sich nicht habe beherrschen können – und nun wolle er in der nächsten Nummer des „S.“ wieder gutmachen. Ach, er wird nicht so schreiben. Er wird recht haben wollen – und sei es auf Kosten unserer Freundschaft! – Ich habe von meinem Brief eine Abschrift genommen, die ich Johannes senden will.
Gestern begann das Wedekind-Gastspiel im Schauspielhaus mit „So ist das Leben“. Da Tilly Wedekind ein Kind erwartet, mußte die Prinzessin Alma von einer andern Dame gespielt werden, als die ein Frl. Jenny Vallière gewonnen war, eine leidlich gute Schauspielerin, die hübsch aussieht und angenehm spricht und sich bewegt. Doch störte mich mitunter ein Vokal, mit dem sie sich als Rheinländerin verriet. Den Pietro Folchi spielte Herr Hans Ansfelder recht unbedeutend, den Filipo Herr Ernst Rothermund, der als Gast feierlich angekündigt war, ganz schauderhaft schmierenmäßig. Auch Wedekind selbst stand nicht auf seiner Höhe. Den Prolog sprach er zwar sehr gut, nachher aber wurde seine Aussprache oft undeutlich, auch störte grade in diesem, seinem poëtischsten Stück das häufige Sichversprechen abscheulich; es reißt aus jeder Illusion. Auch das Gewimmer im letzten Akt war qualvoll. – Von den übrigen Schauspielern war keiner überragend. Hans Raabe bei weitem am ausdrucksvollsten. Viel Schuld an der unlebendigen Darstellung hatte das Publikum, das sich von Anfang an langweilte und garnicht mit dem prachtvollen Stück mitging.
Nachher Torggelstube. Als ich kam, war der Haupttisch leer. In seiner Sonnabendecke saß einsam Max Halbe. Ich setzte mich zu ihm, und nun erschienen schnell hintereinander Wedekind und Frau, Albu und Frau, Direktor Stolberg, Weigert, und ein Dr. Ricklinger. Es gab manche recht gute Gespräche, bis einer nach dem andern ging. Zuletzt blieben Halbe und ich allein noch bis 3 Uhr sitzen. Halbe benutzte die Gelegenheit, mich nach meinem Urteil über seinen Roman zu fragen. Gottseidank konnte ich ohne unehrlich zu werden loben. Es ist wirklich viel dran. – Wir gingen dann zu Fuß miteinander fort und unterhielten uns unterwegs über mancherlei: Scharf und Frau, Weinhöppel (Hannes Ruch) und schließlich über Wedekind als Schauspieler, über den wir verschieden urteilten. Es ist merkwürdig, wie gut ich mit Halbe befreundet geworden bin, nach dem wir uns doch früher gegenseitig nicht hatten riechen können. Aber er ist wie eine ewig knurrende Bulldogge. Man haßt die bissige Schnauze, bis sich der Köter an einen, und man sich an den Köter gewöhnt hat. Dann entpuppt sich das Tier als der liebenswürdigste und treueste Kamerad der Welt.
Die Post brachte heute früh einen neuen Schustermann-Ausschnitt, und zwar überraschenderweise über den „Krater“ – aus dem „Türmer“. Ich heiße da ein „Vielgeschmähter“ und „Vielverkannter“. Der Krater wird als „eines der besten Gedichtbücher der letzten Jahre“ gelobt. Die „von poetisch originellen Einfällen, Bildern und Witz übersprudelnden Verse, die wirklich höchst geistvolle Improvisationen zu sein scheinen“ haben den Rezensenten, dessen Namen das Ausschnittbüro mit Bleistift darunter geschrieben hat, und der H. Beurmann zu heißen scheint, „oft aufs tiefste ergriffen“. Schließlich eine anerkennende Bemerkung über die Balladen. Ich freue mich über die Rezension, zumal das Buch nicht viele gekriegt hat. Die liebe Presse war darin einig, mich totzuschweigen, und als der kleine Beermann, der „Eierbecher“, eine günstige Besprechung ans „Berliner Tageblatt“ bringen wollte, wurde ihm doch bedeutet: „Über Mühsam bringen wir nichts, mindestens nichts Lobendes“.
München, Montag, d. 10. Juli 1911.
Heute wäre ich um ein Haar nach Wien gefahren. R. war da und wollte mich mitnehmen. Grossmann (Pierre Ramus) sollte orientiert werden, in aller Eile die Wiener Kameraden herbeizurufen – und ich war schon entschlossen, die kleine Tour zu machen, als mir einfiel, daß meine Geschlechtskrankheit mir in Wien furchtbarer sein müßte als irgendwo. Ach, liebe Wiener Erinnerungen! Sofie Stöckl, Irma Karczewska, Ferry Werner und Paula, holdes Bordellmädchen in der Blutgasse! Nein, nach Wien, wo jeder Pflasterstein vor Erotik zittert, gehe ich nicht mit einem Tripper. Aber bei einem neuen Arzt war ich heut wieder: einem Dr. Kleintjes, Spezialisten für Harn- und Hautkrankheiten, der gleich um die Ecke Ludwigstrasse – Akademiestrasse wohnt. Er ist der Meinung, der eitrige Ausfluß, der immer noch – und grade heute wieder – hier und da erscheint, sei eine Folge der scharfen Ichthargan-Einspritzungen. Daß noch Kokken da seien, glaubt er sowenig wie Jadassohn. Er verschrieb eine Zink-Einspritzung und meint, in 14 Tagen werde ich heil sein. 14 Tage! Die Zeitdauer stimmt mich argwöhnisch. Hauschild prophezeite sie Woche für Woche. – Ach, ich leide schrecklich unter den Folgen der süßen Aprilnächte mit Kätchen in Rixdorf! Stündlich werde ich durch diese häßliche Qual an die Talentlosigkeit der Natur gemahnt, die das einzige Versöhnliche, was sie geschaffen hat, den Menschen mit dem Leben auszusöhnen, durch diese widerliche Drohung vergiftet hat. Es ist unausdenkbar gemein!
Im Stefanie traf ich – mit Gisela Etzel-Bogenhardt, die von mir für eine Anthologie Gedichte in Prosa wollte (ich habe keine geschrieben) – Lu Märten. Sie sah gut aus, scheint aber ein rechter Blaustrumpf zu sein. Ich erzählte ihr, was ich alles von den Münchner Sozialdemokraten für Infamien erduldet habe – und statt sich zu empören darüber, nahm sie an, daß ich schwarzsehe und fand meine ganze soziale Weltanschauung unlogisch und mich selbst inkonsequent. O diese gescheiten Weiber! Vor lauter Gescheitheit geht ihnen alle natürliche Empfindung in die Brüche.
Von Rößler und dem Moggerl eine Ansichtskarte aus Brügge. Rößler macht diesen Vers: „Wir machen uns das Vergnügge – und grüßen Dich aus Brügge.“ Das Moggerl ruft hinter ihrem Gruß her: „O Erich warum bist Du nicht hier!“ Ja, warum nicht? Ich Ochse! Warum nicht?!
München, Dienstag, d. 11. Juli 1911.
Bis ich zu den Dingen komme, die mich erregen und beschäftigen, will ich nüchtern registrieren, nicht ohne auch noch eine wunderschöne Droschkenfahrt mit dem Puma zu erwähnen, die schon vorgestern stattfand, also schon gestern zu vermerken gewesen wäre. Wir fuhren durch den Englischen Garten, dessen sommerliche Pracht unnennbar schön um uns lag, – wir sprachen fast nichts, und wenn ich manchmal ihre Hand an meinen Mund legte, sah Lotte mich tief und ernst an. Es war, als ob wir einen neuen Bund schlössen.
Gestern abend war „Der Marquis von Keith“. Ich habe Wedekind wohl schon vier, fünf Mal in der Rolle gesehn. So gut wie gestern gefiel er mir noch nie darin. Überhaupt wurde wesentlich frischer und lebhafter gespielt als vorgestern. Die Vallière als Gräfin Werdenfels sah sehr gut aus, auch wirkte ihr Organ angenehm sinnlich, Hans Raabes Genußmensch war eine vorzügliche Leistung, wenn man die ungeheure Schwierigkeit der Aufgabe in Betracht zieht. Alma Lind war als Molly gegen die Vorjahre unverändert gut. Die Karyathiden (Eßlair, Ferner und Ansfelder) ganz brillant, ebenso Lübau und Seger als Saranieff und Zamrjaki. Burghardt spielte den Sommersberg, den Verfasser der „Lieder eines Glücklichen“ (Wedekind erzählte mir nachher in der Torggelstube, daß er, als er sich umdrehte und ihn sah, beinahe losgeplatzt wäre) in meiner Maske. Schauderhaft war hingegen der Gast Ernst Rothermund als Konsul Casimir und noch schlimmer Luise Barrand, die den 15jährigen Sohn Casimirs gab. Da sehnte man sich nach Tilly Wedekind zurück. Das Stück selbst machte mir wieder einen kolossal starken Eindruck.
Heut wurde ich durch den Postboten geweckt, der eine Kiste hereinbrachte, aus der jämmerlicher Lärm und unheimlicher Gestank drang. Sie enthielt den kleinen Kater Peter, den mir Frl. Görg auf meine Bitte übersandte, da Lotte ihn gern haben wollte. Das arme Tier war von der langen Reise in der Kiste ganz lahm und dreckig. Ich gab ihm gleich Milch zu trinken und ließ ihn im Zimmer sich bewegen, wobei er die Pfoten fortgesetzt einzeln ausschüttelte und ausstreckte. Nachher brachte ich das Tier auf dem Arm zu Lotte, die noch ein Kätzchen hat. Die beiden Viecher bekamen sich gleich in die Haare. Sie werden sich aber wohl, da beide sehr jung und verschiedenen Geschlechts sind, bald aneinandergewöhnen.
Inzwischen kamen Briefe – und darunter Landauers Antwort. Er fügt sich mit Rücksicht auf unsre lange freundschaftliche Beziehung in die Rolle eines Beschuldigten, der sich verteidigt. Natürlich sieht er die Dinge in völlig anderm Licht als wir und findet, daß ich ihm schmählich Unrecht antue. Leider erlaubt er mir nicht, eine Abschrift des Briefs an Nohl zu senden. Der würde das Menschliche, Ehrliche und Schöne in Landauers Verhalten dann sicher auch einsehn, aber Landauers Stolz wehrt sich offenbar gegen die Zumutung, sich auch Nohl gegenüber zu verteidigen. Gegen mich ist der Brief respektvoll, aber doch so fest, daß Landauer direkt die Kabinettsfrage stellt: ich müsse zugeben, ihm unrecht getan zu haben oder auf seine weitere Freundschaft verzichten. Als Beilagen fügt er dem Schreiben die Korrespondenz mit Nohl und seinen Briefwechsel über Nohls Artikel mit Buber bei. Nun bin ich mit meinem verfluchten Tout comprendre wieder in einer elenden Zwickmühle. Daß Landauer nun in allem Recht, wir andern in allem Unrecht haben, gebe ich ihm natürlich nicht zu. Ich werde noch einen Tag warten, und ihm dann schreiben, was mein ehrliches Herz mir diktiert. Was soll ich anders tun?
München, Mittwoch, d. 12. Juli 1911.
Der Tripper scheint nun wirklich soweit geheilt zu sein, daß Rückschläge nicht mehr zu fürchten sind. Ich komme eben vom Arzt. Er hat den Nachturin, den ich bis dahin zurückhalten mußte, untersucht und keine Kokken gefunden. Er meint, ich könne mit Maßen wieder anfangen, Alkohol zu trinken und in der nächsten Woche, falls bis dahin alles günstig bleibt, auch schon koitieren. Wie ich mich danach sehne! Vor einigen Tagen küßte ich eines der Pensions-Stubenmädchen, die sehr auf mich einging. Ich hätte nachher fast geheult, daß ich sie nicht, da die Gelegenheit so günstig war wie möglich, bei mir behalten konnte. Und als ich vorgestern Lotte die Katze brachte, – sie lag noch im Bett –, da ließ sie mich ihr süßes Brüstchen küssen, sodaß ich bald vergangen wäre. Ob sie die erste sein wird? Emmy wohl kaum. Die sagte mir erst gestern im Café wieder, daß sie „da herum nicht ganz sicher“ sei – und mich gleich wieder zu infizieren – dazu spüre ich bei Gott wenig Lust.
An Landauer habe ich noch nicht geschrieben, will es aber heute sicher tun. Mich beschäftigt die Geschichte aber und ich leide darunter. Wozu sind all diese Mißverständnisse nötig? Wir wollen neuen Anstand, neue Beziehungen zwischen den Menschen schaffen und schon unter uns ist keine ehrliche freie schöne Verständigung möglich.
Gestern abend traf ich im Stefanie den Maler Heiduk und Frau, die im eignen Automobil von Berlin gekommen sind. Was diese Künstler für Menschen sind! Heiduk fand die Verurteilung Semeraus wegen seiner „unzüchtigen“ Schriften zu 8 Monaten Gefängnis für ganz in der Ordnung. Ich fragte ihn hierauf, ob er nicht doch lieber Billard spielen wolle. – Dabei ist er ein ganz netter Mensch. Es ist bei den Leuten lauter Weltfremdheit.
Torggelstube: Anthes, Weigert mit einer Dame, die Schauspieler Rothermund und Ansfelder, Direktor Victor Barnowsky mit zwei Finanzmännern und Gustel Waldau, der gesund und braun von Italien zurück ist. Die beiden älteren Herren, die Barnowsky poussierte, hatten solche Ähnlichkeit miteinander, daß ich Anthes leise fragte: „Wer ist denn der Herr, der zu beiden Seiten von Waldau sitzt?“. – Wedekind saß im andern Raum und schrieb. Ihm war wohl unser Lärm zu vulgär. Nachher Orlando di Lasso, wo Weigert uns unaufhörlich mit Lobpreisungen des Justizrats Bernstein ennuyierte. Gegen drei Uhr Heimweg in Begleitung von Anthes und Ansfelder. Durch die nächtliche Ludwigstrasse, die ich unaussprechlich liebe.
München, Donnerstag, d. 13. Juli 1911.
An Landauer schrieb ich einen vorsichtigen, freundschaftlichen – doch aber bestimmten Brief. Ich gebe mich darin mit seiner Aufklärung zufrieden, ohne, wie er verlangte zuzugeben, daß ich ihm schmählich unrecht getan hätte. Ob und was er jetzt schreiben wird, kann ich garnicht voraussehn. Seinem Eigensinn wäre zuzutrauen, daß er nun doch Schluß macht in unsrer Freundschaft, ebenso leicht ist es natürlich möglich, daß er einsieht, daß ich von meinem Standpunkt garnicht anders handeln konnte als ich tat. Es wäre nicht hübsch von ihm, machte er deswegen ein Ende, weil ich ihm gegenüber einmal stark meine Persönlichkeit betont habe. Und mir wäre der Verzicht nicht leicht.
Papa schrieb mir eine Karte aus Kudowa in Schlesien, wo er schon im vorigen Jahr die Quellen benutzt und damit seiner Herztätigkeit sehr geholfen hatte. Er lädt mich zum 12. November nach Berlin zum „Familientag“ ein. Ich werde mich also wohl nicht drücken können.
Gestern begegnete mir der Direktor Maximilian Burg und erzählte, er wolle Mitte August im Hotel Wagner ein Einakter-Cabaret aufmachen, das er „Münchner Narrenspiele“ nennen wolle. Er wolle von mir einen Einakter dazu haben. Auch bat er mich, bei Thoma anzufragen, ob der ihm nicht einen geben wolle. Ebenso Rößler. Ich habe gegen die ganze Sache starken Argwohn. Burg ist ein unheimlicher Renommist. Jedenfalls werde ich erst mal mit Rößler und Thoma sprechen, und wenn nicht ganz sichere finanzielle Garantien geboten werden, lasse ich die Finger aus dem Narrenspiel.
Abends war Kegelbahn – und zwar Sommerfest. Es gab herrliche Schinken, Sardellen, Käse, Caviar und Gänseleberpastete. Ferner setzte Halbe eine ganz vorzügliche Pfirsichbowle an, und ich trank davon genug, um einigermaßen betrunken zu sein. Ungünstige Folgen haben sich aber bis jetzt nicht eingestellt, und so hoffe ich, diesen ersten Exzess als Feuerprobe auf meine Geheiltheit betrachten zu können. Ach endlich, endlich! Übrigens ist das festliche Ereignis für die Ewigkeit fixiert worden. Ein Photograph kam und nahm die ganze Kegelgesellschaft für die Sportnummer der „Münchner Illustrierten Zeitung“ auf.
München, Freitag, d. 14. Juli 1911.
Halbes Roman „Die Tat des Dietrich Stobäus“ habe ich zu Ende gelesen. Ich ging mit einigem Mißtrauen an den beinah 600 Seiten starken Wälzer heran – aber ich bin angenehm enttäuscht. So große stilistische Schwächen das Buch hat – schrecklich viel Hinweise auf die Disposition der Geschichte –, psychologisch ist das eine feine Studie. Man erlebt wirklich alles mit, was den Menschen dahin bringt, die Geliebte zu töten, und das Spukhafte, Schauerliche, Geheimnisvolle, das durch die ganze Geschichte geht, hat mehr Größe als ich Halbe je zugetraut hätte. Daß er die Handlung um das Jahr 1860 spielen läßt und in einem nachgelassenen Dokument des Dietrich Stobäus in der Ich-Form erzählt, ist eine Klugheit des Autors, die beweist, wie stark er sich seiner sprachlichen Unfertigkeiten bewußt ist. Von einzelnen Geschmacklosigkeiten abgesehn, hat mir das Ganze sehr gut gefallen und die künstlerische Persönlichkeit Halbes näher gebracht.
Rößler ist wieder da. Er tauchte im Café Stefanie auf, sehr munter aussehend. Wir waren dort eine Weile am „Majors-Tisch“ beisammen, wo unter andern auch Meyrink sich wieder mal zeigte, der jetzt in Starnberg wohnt. Ich mußte dann bald nach Hause, da ich das Puma zum Abendbrot erwartete. Es kam statt um 7 erst um 8 Uhr und bat mich, ich möchte erotische Attacken unterlassen. Nach dem Essen legte sie sich auf den Diwan und da ich merkte, daß sie sich willig streicheln und küssen ließ, durfte ich hoffen, mein geheiltes Befinden endlich wieder in aller Süßigkeit ausleben zu dürfen. – Sie berichtete mir zu meinem nicht geringen Entsetzen, daß sie in letzter Zeit angefangen hat, Aether einzuatmen, und während wir darüber sprachen und dadurch das Piacere, das sicher erfolgt wäre, noch verzögert wurde, erschien Rößler, was mir garnicht lieb war. Natürlich wußte er nichts von dem Ernst unsres letzten Gesprächs und erreichte durch seine Lustigkeit, daß das Puma jetzt ihm ihre ganze Zärtlichkeit zuwandte. Ich quälte mich sehr dabei, ließ mir aber nichts anmerken. Rößler lud uns in den Ratskeller ein, wo wir eine Flasche sehr guten Moselwein tranken. Dann Torggelstube. Unterwegs trafen wir den alten Schmierendirektor Julius Türk, der jetzt das Rixdorfer Theater hat, also Kätchens Prinzipal ist. Er kam mit uns. Nach einer Weile erschien Wedekind mit Tilly, W. in sichtbarer Aufregung. Sie setzten sich apart und verließen dann, da an einem der Nachbartische Radau gemacht wurde, schnell das Lokal. Es war „Erdgeist“-Premiere gewesen (zu der ich wegen der Aussicht auf Lottes Besuch nicht gegangen war) und da soll nicht alles geklappt haben, sodaß Wedekind sehr verstimmt war. Nachher kam Lulu Strauß mit der Nachricht, die Vallière sei nach der Aufführung ohnmächtig geworden. Es wäre für Wedekind schrecklich, wenn die Frau ernstlich krank würde. – Das Puma war um 11 Uhr ins Luitpold verabredet. Rößler war durch die lange Reise sehr übermüdet, und mit Julius Türk, der über Wedekind saudummes Zeug zusammenquatschte, allein zu bleiben, hatte ich garkeine Lust. So fuhr ich zum Café Stefanie, wo ich Billard spielte. Nachher ging ich noch zu Kati Kobus. Die blödsinnige Hitze in dem Lokal veranlaßte mich, sehr bald fortzugehn. Emmy wird heute in der Ludwigskirche getauft. Ihr ist das eine prächtige Sensation – und es ist allerliebst zu sehn, wie sich bei ihr der Entschluß, katholisch zu werden, so durchaus deutlich aus Neugier, Sentimentalität und Geilheit zusammensetzt.
Heut kam eine Karte von Johannes, der in Aeschi ist, und ein weiterer Brief von Landauer, der sich mit meiner Antwort zufrieden gibt. Er reist sehr bald nach Süddeutschland ab, und wir werden uns vermutlich in Frankfurt sehn, da dort eine Zusammenkunft des Sozialistischen Bundes geplant ist.
München, Sonnabend, d. 15. Juli 1911
Der Diwan in meiner Stube kann endlich wieder eine Liebesgeschichte erzählen: das Puma war die erste – und wir liebten uns auf das Süßeste. Nachmittags schon hatte sie mich ins Stefanie antelefoniert, ich möchte sie abholen. Ich kam zu ihr, und wir wollten wieder Einkäufe machen. Vorher – in ihrem Zimmer – küßte sie mich mehrmals zärtlich auf dem Mund, indem sie sorgfältig den Schnurrbart dazu zurückbog. Ich kaufte ihr einen sehr schönen lilaseidenen Schal und nahm auch gleich für Uli einen geblümten mit (30 Mark gab ich aus – dabei habe ich erst vor einigen Tagen 100 Mark von der Deutschen Bank geholt und muß mir notwendigst einen Anzug kaufen. Das Puma findet, ich sehe in meinem weißleinenen Waschanzug aus wie ein Ostergruß). – Dann fuhr ich also mit Lotte zu mir. Als wir beim Ankleiden waren, kam Rößler und lud uns zu sich zum Abendbrot ein. Was geschehen war, konnten wir ihm nicht verheimlichen, da unsere dürftige Kleidung uns deutlich verriet. Nachher gingen wir drei in Eckels Weinstuben, dann fuhr ich mit dem Puma ins Café Odeon. Sie erzählte, sie habe mit Rößler eine Reise verabredet, während Strich mit seinen Eltern reise, und als ich sie fragte, ob sie nicht auch mit mir kommen würde, war sie sehr einverstanden. Erst meinte sie, sie werde nach der Reise mit Rößler mit mir eine machen, nachher fiel ihr ein, sie wolle doch lieber Rößler ganz schießen lassen und blos mit mir reisen. Ich war sehr glücklich. Wir verabredeten Weimar. Ihre Adresse wird inzwischen Berlin sein, da ihre Mutter in solche Dinge gern eingeweiht werden kann und jeden Schutz übernimmt. So kann sie getrost die Korrespondenz mit Strich pflegen, ohne daß er eine Ahnung hat, daß Lotte nicht bei ihrer Mutter in Wilmersdorf, sondern bei Mühsam in Weimar ist. Wenn nur Strichs Abreise zustande kommt! Es wäre herrlich – über alles Maß herrlich! Eine richtige Hochzeitsreise mit Lotte, wie ich dereinst – selige Zeit! – mit Frieda die Hochzeitsreise nach Augsburg machte. Daß es doch zustande käme! Wie reich wäre der Berner Pump verzinst!
Wir gingen nachher noch ins Luitpold, wo wir Sörgel und Strich trafen, dann in die Torggelstube. Da der Separatraum schon geschlossen war, mußten wir an einem Holztisch im großen Lokal Platz nehmen. Wedekind saß einsam in unserer Nähe, kaute Bleistift und schrieb. Ein merkwürdiger Mensch, der nicht anders arbeiten kann, als im Kneipenlärm und zwischen Kellnerinnen. – Der Sörgel geht mir schandbar auf die Nerven, und da auch Lotte durch ihn nervös zu werden schien, brachen wir bald auf. – Heut früh frühstückte ich oben bei Rößler, der mir sein indisches Verhältnis vorstellte. („Das dollste an Braut habe doch jetzt ich!“ hatte er uns in Tegernsee von ihr erzählt.) – Ein hübsches nettes Mädel, schlank und groß – aber garnicht mein Typ. Sie hat etwas Bürgerliches an sich, was sie wie eine auf Abwege geratene höhere Tochter erscheinen ließ. Auch Jolly Jolanda war da, ein Cabaret-Mädel, das bis heute hier oben in der Pension gewohnt hat ...
Die „Familie Mühsam“ schickt mir eine neue Einladung zum Familientag mit der „Tagesordnung“, die sich aus einem Festmahl und einer „Geschäftssitzung“ zusammensetzen soll. Der Zusammenschluß der Familie soll danach eine dauernde Einrichtung werden. Ein hanebüchener Blödsinn.
München, Sonntag, d. 16. Juli 1911.
Mein Programm war gestern, abends ins Schauspielhaus zu gehn, um „Erdgeist“ zu sehn, dessen Premiere ich versäumt hatte. Nachher wollte ich Uli und Lotte im Luitpold treffen. Es kam anders. Als ich schon in der Elektrischen nach der Maximilianstraße fuhr, stieg Ecke Theresienstraße Rößler ein und erzählte, daß er zur Ausstellung wolle. Da ich in diesem Jahre noch nicht draußen war, entschloß ich mich kurzerhand ihn zu begleiten. Vor der Theater-Bar der Ausstellung saßen Mitglieder des Künstlertheaters, darunter Pallenberg, der erste Komiker, den ich kürzlich im Vorübergehn durch Lulu Strauß kennen gelernt hatte, ferner Charlé, ehemals Direktor der Neuen Wiener Bühne und ein Herr Lux, der mich daran erinnerte, daß wir uns im Jahre 1900 schon gekannt hätten, als Besucher des gleichen Stammtisches im Kaiser-Kaffee in Berlin mit dem verstorbenen Leschnitzer, meinem Kollegen in Risenfelds Adler-Apotheke, Dr. Keibel, Boas u.s.w. Er (Lux) hieß damals Löwe und war Zahnarzt. Also einer, der mich noch aus meiner Apothekerzeit kannte. Die Herren dachten, ich sei gekommen, um die „Schöne Helena“ zu sehn und Pallenberg war dann so liebenswürdig, mir in dem fast ausverkauften Haus noch ein prächtiges Freibillet in der Mitte des zweiten Ringes zu beschaffen. Vorher hatte Charlé mich beiseite genommen, und mich gebeten, in ein Chanson, daß er zu singen hat, noch ein paar Verse hineinzudichten mit Schüttelreimen. Ich versprach, es zu versuchen. Dann wurde der Plan erwogen, in der Nacht, nach der Vorstellung per Auto nach Salzburg zu fahren. Es scheint aber nichts daraus geworden zu sein. Oder die Herren sind ohne mich gefahren.
Die „Schöne Helena“ von Offenbach ist unter Reinhardts Regie zu einer ganz köstlichen Humorleistung geworden. Man mag gegen Reinhardt sagen, was man will, er ist doch der einzige, der Theater spielen kann, und das ist wohl sein wertvollstes Verdienst, daß er einem wieder ins Bewußtsein gebracht hat, daß Theater Theater und nicht Wirklichkeitskopie ist. Er arbeitet mit Farben, Bewegung, Tönen, Abstimmungen – und so gehört es sich auf der Bühne. Es gab Bühnenbilder (Ausstattung von Ernst Stern), die ganz blendend schön waren. Die Offenbachsche Musik klang herrlich durch den Raum, eine so einschmeichelnde, tänzerische, zierliche Musik, wie sie wohl nie wieder geschrieben werden wird. Und gespielt wurde köstlich. Der Menelaus von Pallenberg wird mir in seiner Komik unvergeßlich sein. Den Agamemnon gab Zettl in meiner Maske, sogar der Kneifer fehlte nicht, blos war er viel länger als ich. Die Helena spielte Mizzi Jeritza, die eine sehr schöne Stimme hat, den Calchas Gustav Charlé sehr lustig. Rudolf Ritter sah als Paris sehr gut aus und sang recht schön. Die Eibenschütz war als Orest zu forciert. Ihre Quietscherei war ja manchmal ganz spaßig, aber im ganzen drängte sie sich zu weit vor – und dazu fehlt es ihr an Charme und Sicherheit. Die Inszenierung war ganz glänzend. Sehr wirksam ein Steg, der durch den Zuschauerraum auf die Bühne führte, und von dem aus – also mitten durch die Zuschauer hindurch ein großer Teil der Mitwirkenden auftrat. Lustige Einfälle in hellen Haufen. Eine Glanzleistung Reinhardts, deren Eindruck sich in stiller Selbsteinkehr sicher kein Snob entzieht.
Nachher traf ich in der Elektrischen die kleine Frieda Wiegand, die ich vor ein paar Monaten im Café Bauer kennen gelernt hatte. Sie sah reizend aus, war aber in Begleitung eines entsetzlich fad aussehenden Burschen. Wir ignorierten die Begleitung und plauderten sehr nett miteinander.
In der Torggelstube fand ich den Stammtisch dicht besetzt: Roda Roda, Ettlinger mit Frau, fremde Damen, Muhr, Weigert mit einer Dame, Rothermund, Steiner, die Vallière, die ich erst kennen lernte mit Ehemann und einer hübschen Freundin, namens Helene Ries u.s.w. Die Vallière gefiel mir sehr gut. Sie beklagte sich sehr über die Münchner Theaterkritiker, die gar keine Rücksicht darauf nehmen, daß sie mit viel zu wenig Proben die ungeheuer schwierigen Wedekind-Rollen spielen muß. Ich werde im „Kain“ darauf hinzeigen. Das Frl. Ries war allerliebst. Sie ist erst ein halbes Jahr bei der Bühne und geht jetzt nach Brünn ins Engagement. Ich lockte das junge sinnliche Ding auf allerlei schlüpfrige Wege, auf denen sie sich graziös bewegte. – Nachher spielte ich noch mit Rothermund und Steiner im Orlando di Lasso Billard, bis wir nach 3 Uhr hinausgeworfen wurden. Ich leistete mir zum Heimweg ein Auto.
Nun an die Arbeit! Fuhrmann drängt um einen Beitrag für die Staats-Nummer des „Kometen“ – und die August-Nummer des „Kain“ harrt noch des ersten Federstrichs.
München, Dienstag, d. 18. Juli 1911.
Ein Tag keine Eintragung und wieder eine lange Reihe registrierwürdiger Geschehnisse. Zunächst zwei Theater-Abende:
Sonntag war ich mit Lotte in „Musik“. Das Stück selbst ist ein Experiment Wedekinds gewesen, und als ich vor einem Jahre mit ihm darüber sprach, gab er mir zu, daß meine Auffassung davon die richtige sei, daß nämlich das Schicksal der Clara Hühnerwadl kein tragisches sei, sondern daß das Mädchen einfach Pech hat. Dieses Pech führt dann natürlich zur Lächerlichkeit (Viertes Bild: „Der Fluch der Lächerlichkeit“). Heinrich Manns Meinung, das Stück sei das beste Wedekinds, denn es bringe wahre Kunst in kolportagehafter Aufmachung, scheint mir gesucht und falsch. Wedekind spielte den Musiklehrer Reissner (gemütloser Weise in der Maske des Vorbilds Dressler) unter allem Luder. Er versagt, wo er nicht sich selbst spielen kann, und er hätte gescheiter getan, die Rolle des Lindekuh zu übernehmen. Dagegen war die Vallière recht gut. Es ist keine leichte Aufgabe, fortwährend – den ganzen dritten Akt hindurch ununterbrochen zu heulen, und morgens hatte sie, wie sie mir nachher erzählte, eine Art Blutsturz gehabt; d.h. infolge einer Krachszene mit Wedekind war die Periode 10 Tage zu früh eingetreten und hatte ihr das Blut literweise aus allen Körperöffnungen getrieben. Sie ist eine zweifellos gute Schauspielerin. Stolberg könnte sich freuen, wenn er sie behalten dürfte. Das zeigte sich auch gestern wieder, wo ich sie (begleitet von Uli) als Lulu im „Erdgeist“ sah. Natürlich darf man sie nicht mit der Eysoldt vergleichen. Die spielte den Erdgeist als raffiniertes Tier, und Stimme und Bewegungen überwältigten den Zuschauer, daß man meinte, ein Elementarereignis stürze über einen her. Aber im vorigen Jahre spielte Tilly Wedekind die Rolle, und zwar ganz nach Wedekinds Intentionen, der den Schön – seit er ihn spielt – zur Hauptfigur des Stückes machen will. Tilly verschwand völlig dabei. Im Vergleich zu ihr schnitt die Vallière brillant ab. Vor allem: sie hat eine famose Figur, schlanke Hüften, hohen Wuchs, eine sehr schöne Erscheinung. Ihr Spiel ist das einer reifen Schauspielerin; sie hat etwas von der Art der Frau v. Hagen. Wedekinds Schön war auch nicht übel, und die übrigen Schauspieler (Steiner als Afrikareisender war sogar gut) verderben nichts. Nur – und das ist der Jammer am Schauspielhaus immer – es gab garkeine Regie, und jeder Schauspieler agierte am andern vorbei. Wedekind sollte wirklich mal für ein gutes Zusammenspiel sorgen. Sonst wird das Interesse an seinen Juli-Gastspielen bald dahin sein.
Zu den andern Dingen: Sonntag traf ich im Café Emmy. Ihre Taufe hat sie überstanden, und nun redet sie ernstlich vom Kloster. Ich sagte ihr, ins Kloster hineinkommen sei leichter als wieder herauskommen, und als ich schließlich fragte, wer denn im Kloster ihr Gärtchen bestellen soll, wurde sie böse und ging. Heut früh, als ich sie im Stefanie begrüßen wollte, schnitt sie mich. Zu dumm! Sie wird schwer einen Freund finden, der es so uneigennützig gut mit ihr meint, wie ich.
Ferner war Sonntag Gertrud Fehl bei mir. Sie heulte schrecklich, und ich gab ihr 10 Mark. Ihre zahllosen Küsse entschädigten mich etwas für das Goldstück. Aber wie das mit dem Ehepaar weiter werden soll, ist mir schleierhaft.
Sonntag abend nach dem Theater war ich mit Lotte und Strich bei Eckel Abendbrot essen. Nachher kam Höxter. Ich hatte das Gefühl, Höxter paßt nicht nach München. Er soll nur bald nach Berlin zurückgehn. Dort gilt er als etwas Besonderes, hier sind zuviel Besondere, als daß man ihn, wie er es wünscht, schätzen könnte.
Gestern nach dem Theater war ich in der Torggelstube, wo ich den weichen Meyer, Anthes, die Vallière mit ihrem Gatten, Falkenstein, Weigert mit Freundin, Feuchtwanger und Charlé antraf. Nachher kam Wedekind. Das Gespräch ging hauptsächlich um Roda Roda, der anfängt, sich mit seiner „Themidor“-Geschichte lächerlich zu machen. Er hat vor einigen Tagen – ich war dabei – Ettlinger, der authentisch fürs „Berliner Tageblatt“ orientiert werden wollte, ehrenwörtlich versichert, er habe vom Künstlertheater keinen Pfennig Vorschuß bekommen. Nun stellte sich heraus, daß die Quittungen über 3000 Mark vorliegen. Roda hat sich mit seinen Behauptungen und Übertreibungen elend in die Nesseln gesetzt. „Ihm treibt schon der Arsch mit Grundeis“ drückte Müller sich aus ... Sehr komisch war ein Gespräch zwischen dem Pedanten Feuchtwanger und der ehrgeizigen Vallière. Feuchtwanger hielt ihr einige Schwächen in der Aussprache vor – zum Teil ganz blöd –, und die Vallière regte sich schrecklich darüber auf, und erbot sich, Dutzende von Briefen beizubringen, in denen ihr die ersten Sachverständigen ihr unerhörtes Talent bestätigten. Ich wollte mich totlachen über den Disput, an dem ich mich nur beteiligte, wenn er aufzuhören drohte. Ich heizte dann ein, und es ging weiter. Weigert, der unentwegt nur Anekdoten erzählt, brachte recht lustige über den Prinzen Louis-Ferdinand, diese urkomische Serenissimus-Figur am bayerischen Hof.
Nachher gingen wir – Weigert mit Freundin, Feuchtwanger und ich noch ins Orlando, wo ich eine sehr nette Hure sitzen sah – im Typus an die Kellnerin Emmy vom „Simplizissimus“ erinnernd. Ich beschloß, sie mit mir zu nehmen, und stieg ihr, als sie fortging, nach. Wir fuhren per Auto zu mir, und ich hatte eine sehr hübsche Nacht, in der ich mich nach dem verfluchten Tripper, der vor genau 3 Monaten eingesetzt hatte, mal gründlich auslebte. Das Mädchen gefiel mir sehr gut, hat eine hübsche Figur, wenigstens vom Nabel abwärts (leider Hängebusen), ist 23 Jahre alt und steht ihrem Beruf mit großer Unbefangenheit und garnicht moralistisch gegenüber. Ich gab ihr 12 Mk. (Das Geld geht weg wie der Teufel. Ich habe mir gestern 200 Mk geholt und auch schon für 32 Mk einen neuen Anzug gekauft, ganz abgesehn von den erhöhten kleinen Ausgaben.) Ich ging mit dem Mädel ins Stefanie. Als sie fort war, kam Rößler, der mich überredete, mit ihm schwimmen zu gehn. So fuhren wir im Auto zum Ungerer-Bad. Es war herrlich. Seit 3 Jahren schwamm ich zum ersten Mal wieder, und es ging noch ausgezeichnet. Ich werde das köstliche Vergnügen jetzt möglichst jeden Tag aufsuchen. Nachher per Auto zur Torggelstube Mittagessen (Die Vallière mit Mann, Meßthaler, an einem andern Tisch Ettlinger und Rosenthal). Dann per Droschke heim, wo ich wieder, statt endlich mit der August-Nummer des „Kain“ zu beginnen, 4 Seiten in dies Buch einschrieb. – Jetzt gehe ich natürlich ins Stefanie. Ich bin schon ein arges Faultier!
München, Mittwoch, d. 19. Juli 1911.
Nun ein paar Personalnotizen. Mit Hardy scheint es jetzt wirklich aus zu sein. Er zeigt sich mit Emmys Laune solidarisch. Gestern begegneten mir beide im Hofgarten. Sie beugten die Köpfe und schoben vorbei ohne zu grüßen. Meinetwegen. Emmy nehme ich es nicht übel. Sie ist momentan in einem Zustand kompletter Verschrobenheit. Sollte es ihr gelingen, sich dem verfluchten Geschwätz der Pfaffen mal wieder zu entziehn, dann wird sie auch wieder zu ihrer sexuellen Beweglichkeit kommen und einsehn, daß das was ich tat kein Verbrechen war. Aber daß Hardy, statt sie den pfäffischen Einflüssen zu entfremden, sie darin bestärkt – Lotte behält immer wieder recht: er dämonisiert ein kleines Mädchen –, das ist ekelhaft. Bis vor einer Woche hat er das Mädel aus Snobismus auf den Strich geschickt – Emmy erzählte es mir selbst –, jetzt grüßt er seinen besten Freund nicht mehr, weil der das gleiche Mädchen vor dem Kloster warnt, in dem keiner sei, der ihr das Gärtchen bestellen werde. Hätte ich vier fünf Tage früher das gleiche zu Emmy gesagt, dann hätte sie mir die Hose aufgeknöpft, wie es doch wahrlich oft genug geschah. Äh, – diese Menschen haben keinen Respekt vor ihren Beziehungen. Sie halten das „Erlebnis“ für wichtiger und merken garnicht wie ärmlich die Erlebnisse sind, die nicht auf guten menschlichen Beziehungen fussen.
Im Stefanie erzählte mir Scharf, daß Dr. Robert Douglas gestorben ist. Damit ist die Ohrfeige, die ich von ihm bezog, aus der Welt geschafft. Er war ein schwer nierenkranker Mensch, und er hat Glück gehabt, daß der Tod verhältnismäßig milde Formen hatte. Nachtrauern kann ich ihm nicht, dazu sind wir uns immer zu fremd gewesen, dazu hat vor allem unsere Bekanntschaft zu unerquicklich geendet. Doch werde ich seiner Witwe schreiben. Für diese meschuggene Zirkusdame habe ich doch irgendwelche Sympathien, und für ihren kleinen Addi auch heute noch zärtlichste Freundschaftsgefühle. Ich würde mich freuen, wenn der süße Junge wieder an mich glauben lernte.
Frl. Ichenhäuser forderte mich gestern abend zum Schachspielen auf, womit diese Feindschaft erledigt sein dürfte. Mir ganz angenehm.
Kanders, der vor ein paar Tagen von einer spanischen Reise zurückkam, schreibt mir aus dem Krankenhause, ich möchte ihn besuchen und ihm Nohls George-Artikel mitbringen. Soll heute geschehen. – Von Rechenberg ein Brief, in dem er mir mitteilt, er errichte mit einem andern zusammen bei Constanz ein Geschäft zum Vertrieb von praktischen Dingen. Ich möchte dafür Propaganda machen. Der Brief ist sehr lustig. Gleichzeitig ein ganzer Stoß Prospekte über die Gegenstände, die die Firma vertreibt: Haus- und Küchengeräte und Condome. Der Präservativ-Prospekt ist so komisch, daß ich heute schon sehr vergnügte Minuten hatte – Ich werde ihn dem Puma bringen.
Gestern besuchte mich Herr Otto Singer, der mir nachgrade doch „spinnert“ vorkommt. Er sitzt dann da, redet ganz gleichgiltiges Zeug, sieht unstet umher und läuft wieder fort. Ich weiß garnicht, was ich mit ihm anfangen soll. Heut war ein schwedischer Genosse bei mir, der aus Preußen und Sachsen ausgewiesen ist. Ich gab ihm 2 M.
In der Torggelstube erzählte Feuchtwanger, der Prinzregent liege im Sterben. Die Hofchargen und Redaktionen seien ganz insgeheim benachrichtigt worden. Mich geht das ja nichts an. Ob der Mann, der in der Residenz wohnt, Luitpold oder Ludwig heißt, soll mir recht gleichgiltig sein. Aber die Schauspieler sind sehr besorgt. Eine Hoftrauer hätte für viele Leute, die mich angehn, wichtige Folgen. Deshalb sei auch dies hier vermerkt.
Mit der Vallière poussierte ich gestern nach Noten. Obwohl ihr Ehemann mit am Tisch saß, kniffen wir uns die Hände und drückten die Knie aneinander. Die Situation war sehr reizvoll, zumal wir uns in anzüglichen Bemerkungen, die alle von der Tischgesellschaft auf andre Dinge als auf unsere Verständigung bezogen werden mußten, überboten. Trotzdem glaube ich kaum, daß sich ein richtiges Techtelmechtel entwickeln wird. Wenn ich die Frau recht beurteile, so liebt sie Sensationen und fürchtet Erlebnisse.
München, Donnerstag, d. 20. Juli 1911.
Mit Emmy scheine ich es jetzt endgiltig verschüttet zu haben. Heut vormittag traf ich sie im Stefanie mit Bolz. Ich begrüßte sie, hielt ihr die Hand hin und sagte: „Na, Emmy, wir wollen uns wieder vertragen.“ Erst lächelte sie, dann meinte sie aber – und verweigerte mir die Hand: „Geh mir vom Leibe!“ – Ich sagte, was mir im Augenblick in den Sinn kam: „Ich bin ja noch garnicht drauf.“ – Doch kaum war ihm das Wort entfahren, möcht ers im Busen wieder wahren. Zu spät. Tiefe Entrüstung. Nach einer Weile wilder Aufbruch von Bolzens Tisch, der mir berichtete, Emmy habe es ihm übel genommen, daß er mir nicht gleich an die Gurgel gefahren sei. Nun habe ich womöglich von Hardy Attacken zu gewärtigen. Es ist recht übel.
Von Rechenberg kam ein sehr spaßiger Brief in seinem besoffenen liebenswürdigen Schimpfstil. Er wird Teilhaber an einem Versandgeschäft – eben sehe ich, daß ich darüber gestern schon berichtete. Inzwischen habe ich mit dem Condom-Prospekt Uli, Lotte und die Vallière höchlich amüsiert.
Mit Lotte werde ich reisen. Ich habe ihr festes Versprechen und bin namenlos glücklich darüber. Ich liebe das süße herrliche Geschöpf mit allen Fasern meines Lebens, und mir scheint, daß sie zur Zeit auch für mich zärtlicher empfindet als sonst. Jeden Tag beglückt sie mich durch zarte süße Küsse auf dem Mund, und ich hoffe, auch heut wird mir das Glück eines solchen Kusses nicht entgehn. Ich warte auf ihren telefonischen Anruf. Bis dahin an die Arbeit! Es wird hohe Zeit!
München, Freitag, d. 21. Juli 1911.
Eben geht Bolz fort. Er erzählt Schauergeschichten von Emmys Zustand, die anscheinend in kompletten religiösen Wahnsinn verfallen ist. Sie verflucht mich und fast alle übrigen Freunde als Ketzer, halluziniert den Teufel, der sie an den Beinen zieht, und in ihrer kleinen armen Psyche scheint es wild herzugehn. Dabei ist sie geil wie nur je, und Bolz hat nach jedem Koitus, den sie zuerst verlangt, die furchtbarsten Flüche und Anklagen gegen ihn und gegen sich selbst anzuhören. Er ist schon ganz verzagt. Das schlimmste ist, daß man das Mädel jetzt jeder Gewalttätigkeit für fähig halten muß. Bolz hat sie schon auf der Straße attackiert, als er mit einer andern Frau ging. Ich muß gewärtigen, daß sie mir mit Revolvern oder Rasiermessern entgegentritt. Das beste wäre schon, sie ginge je eher je lieber in ein Kloster. Das wird für ihre verwirrte Seele vielleicht besser sein als das Irrenhaus, wo sie den Zwang spüren müßte. Das arme Mädelchen! – und die dreimal gottverfluchten Pfaffen, die ihr wohl obendrein noch die Hölle heiß machen! – –
Heut früh – jetzt ist’s abends – kam Lotte und holte mich ab, als ich grade baden gehn wollte. Ich ging natürlich mit ihr ins Café. Ich habe sie sehr, sehr lieb, und jedesmal, wenn sie mir mit sündigem Lächeln von der bevorstehenden Reise spricht, möchte ich sie vor seliger Freude zerfleischen. – Ich habe diese Tage viel an diese Liebe und an die zu Frieda gedacht. Wie ungeheuer töricht sind die Menschen, die da meinen, ein Herz könne nicht gleichzeitig nach mehreren Seiten gezogen werden. Meine Liebe zu Frieda leidet garnicht durch diese Aufwallung. Denke ich Friedels, dann füllt sich alles Herz mit Sehnsucht und Zärtlichkeit, und doch zweifle ich nicht einen Moment an der Richtigkeit und dem Wert des Gefühls, das mich dem Puma verbündet. Ich kann neben dem Puma sitzen, sie leidenschaftlich zu küssen wünschen, und gleichzeitig an Frieda denken, sie herbeisehnen und in die Luft greifen in der Illusion, ich erfaßte ihre Hand. Und wieder kann ich durch ein Wort, eine Bewegung, einen Blick von Uli zu glühender Liebe hingerissen werden, und dann, fünf Minuten später, wenn ich etwa die Vallière sehe, deren Hände in Küssen ertränken, kann mit der Uhr in der Hand ihren Atem aufzufangen suchen, bis zu dem Moment, wo ich stürmisch aufbreche, um Lotte zu treffen. Vielleicht ist es dumm und unpraktisch von mir, all das nicht zu verbergen. Aber ich kann nicht anders. Ich könnte mit Lotte im Bett liegen, sie rasend lieben, und ihr gleichzeitig von Moggerl vorschwärmen. Wie ist es blos denkbar, daß ich, da ich – das bilde ich mir doch ein – ein Erotiker bin, wie nicht viele herumlaufen, daß ich so maßlos wenig Glück bei den Frauen habe? Die Natur ist garzu talentlos. Irgendein Kommis bekommt’s, und weiß nichts damit anzufangen.
Gestern abend in der Torggelstube poussierte ich die Frau Mewes, ehemalige Grete Gräf. Sie ließ sich sogar auf den Mund küssen von mir. Der Vallière und nachher der Frau Weigert küßte ich die Hände – beide sind mit sehr schönen Händen ausgestattet –, und nachher liefen alle drei mit ihren Ehemännern nach Hause. Es ist ganz verrückt. Daß ich mehr oder weniger aufs Onanieren angewiesen bin, das kommt mir wie der infamste Witz vor, den das Schicksal je ausgeheckt hat. – Wäre Strich nur erst fort! Dann geht’s mit dem Puma auf Reisen, und der Gedanke daran ist so wohltuend wie die himmlischen täglichen Schwimmbäder im Ungererbad draußen. Puma, süßes Puma! Weiber, süße Weiber! Liebe, süße Liebe!
München, Sonnabend, d. 22. Juli 1911.
Ich sitze schon wieder in Erwartung des Pumas, das mich um 11 Uhr abholen wollte, und jetzt – ½ 12 Uhr – noch nicht da ist. Ich weiß schon, daß mein gegenwärtiger Reichtum viel zu der erhöhten Sympathie beiträgt, die sie mir jetzt entgegenbringt. Aber das ist nicht Berechnung, sondern es beweist nur, daß der Mensch, wenn er nicht fortwährend rechnen muß und Launen haben kann, liebenswerter ist. – Sie wird mich wieder ins Caféhaus schleppen und mir beim Dominospiel Geld abnehmen. Am Ende ist das bei der unglaublichen Hitze, die jetzt wochenlang andauert – ein in München unerhörter Zustand, der mir recht angenehm ist – das gescheiteste was man machen kann. Käme sie nur erst!
Landauer fragt mich an, ob ich an einer Zusammenkunft der süddeutschen Genossen in Stuttgart teilnehmen will und schlägt den 13. August dafür vor. Ich habe zustimmend geantwortet. Nur wird das, was ich aus München zu berichten habe, nicht tröstlich lauten. Gestern abend spät sprach ich Morax, der von der Kati kam. Ich fragte ihn, ob er denn nichts mehr tun wolle. Aber er scheint müde zu sein und redete sich hinaus, er sei bald 30 Jahre alt und müsse sich endlich eine Existenz schaffen. Als ob er nicht bei der Kati singen könnte, auch wenn er hier und da mir ein paar technische Mühen abnimmt. Auch der eine Enttäuschung! Es ist recht, recht übel. Ich überlege, wie ich in München mit ganz neuen Personen eine ganz neue Gruppe heranziehn kann. Es wird schwer halten.
München, Sonntag, d. 23. Juli 1911.
Die Sonne sengt vom Himmel hernieder, daß der Asphalt stinkt. 26° Réaumur im Schatten. Man sehnt sich nach Regen – in München! das will was heißen. Es ist Spätnachmittag. Das Schwimmbad und den Kuß des Pumas habe ich schon genossen. Gleich gehe ich an die Arbeit, denn es fehlen mir für die August-Nummer des „Kain" noch wichtige Beiträge: der Leitartikel, der „Sittlichkeit“ heißen und den Fall Semerau noch einmal behandeln soll, der Theater-Artikel (über das Wedekind-Gastspiel) und einige Bemerkungen (über Jatho, vielleicht über die Kriegsgefahr wegen Marokko). – Gestern mußte ich schon wieder ins Theater. Im Lustspielhaus war die Premiere einer „Kriminalgroteske in drei Instanzen“ von Lothar Schmidt und Heinrich Ilgenstein. „Fiat Justitia!“ heißt der Dreck. Die beiden Autoren sprach ich vor der Aufführung. Sie hatten großen Erfolg, obgleich hundsmiserabel gespielt wurde, und obgleich das Stück nicht besser ist als tausend andre – allerdings auch nicht schlechter. Eine Satire auf die deutsche Rechtsprechung. Das Milieu nach Serbien verlegt. Einige nette Einfälle, gute, wenn auch alte Witze. Widerlich war mir ein langer sentimentaler Passus im zweiten Akt, wo die Eltern des als Mörder Verdächtigen erscheinen. Die Eitelkeit der Beamten, ihre arrogante Dummheit und der Buchstabensinn der Justiz werden verulkt, aber doch eben nur verulkt. Es fehlt der Stachel des Hasses, den man bei Ilgenstein eigentlich hätte erwarten dürfen. Das „Zweierlei Maß“ wird ungeschickt aber derb glossiert – und das gute Bürgertum applaudiert, freut sich, geht vergnügt heim und findet, daß in dieser Welt alles aufs beste beschaffen sei. Die Polizeizensur weiß das gut zu unterscheiden. Hätte das Stück etwas vom Wedekindschen Mostrich, dann wäre es so sicher verboten worden, wie, wenn es von mir verfaßt wäre. – Uli war im Theater, weil Alwa – mehr schlecht als recht – einen Gefängniswärter zu spielen hatte. Lotte konnte ich leider nicht mehr erreichen, sodaß ein Billet von den zweien, die ich nachmittags von Lulu Strauß bekommen hatte, verfallen mußte.
Lotte! Ich laufe den ganzen Tag mit dem Gedanken an sie herum. Gestern sagte sie mir in reizender Form eine kleine Schmeichelei, aus der ich ersah, daß sie mich doch sehr gern haben muß. Ich habe mir das sehr lustige Kegelbahn-Bild besorgt, auf dem ich hinter dem breitprotzigen Roda Roda hervorluge. Sie kritisierte die verschiedenen Visagen auf der Photographie sehr geringschätzig. Dann zeigte sie auf mich und meinte: „Wenn ich den da nicht im Original kennte, würde ich ihn sehr nett finden.“ Als ich ihr darauf den Arm um die Hüfte legte, machte sie die Lippen spitz.
Die Roda Roda-Geschichte nimmt sehr peinliche Formen an. Roda hat – ich saß dabei – in der Torggelstube Ettlinger sein Ehrenwort gegeben, daß er keinen Vorschuß für Themidore bekommen habe. Inzwischen sind die Quittungen über 3000 Mk ans Licht gekommen. Jetzt bombardieren sich die Herren Roda und Ettlinger mit groben Briefen, und die Sache wird wohl vor die Gerichte kommen. Hoffentlich brauche ich nicht Zeuge zu spielen. Roda Roda benimmt sich in der ganzen Affäre dumm und anmaßend, und wenn nun alles über ihn herfällt und schimpft, fällt es mir wirklich schwer, ihn in Schutz zu nehmen – und ich nehme sehr ungern gegen ihn Partei. Was für Häßlichkeiten um solche Lappalien!
München, Montag, d. 24. Juli 1911.
Ich komme eben zum Essen von einem kostspieligen Spaziergang zurück. Ich kaufte mir einen Hut für 8 Mk 50 und Schuhe für 12 Mk 50, ferner für das Puma, das mich zu dem Gange aus dem Bett geholt hatte, ein Paar Höschen für 5 Mk, Strümpfe u.s.w. für 5 Mk und 10 Mk gab ich ihr in bar. Rechne ich noch Caféhaus und Droschke, so muß ich sagen, daß das Geld, das ich gestern in einer halben Stunde Poker gewann, in einer halben Stunde Theatinerstrasse wieder draufgegangen ist. Immerhin habe ich jetzt elegante Halbschuhe und einen Schlapphut, gegen den alle früheren kläglich verschwinden, und das Puma hatte Riesenfreude, und wir zwei sind wieder ein bißchen enger aneinander geschmolzen. Gestern wollte sie mit den Strich-Brüdern zum „Themidore“. Ich entschloß mich daher, abends zur Ausstellung hinunterzufahren. Dort traf ich Sobotka, der mit dem Kompagnon Roda Rodas F. Steffan identisch ist, den ich einst bei Roda kennenlernte und auf den Roda jetzt mordsmäßig schimpft („Ein begüterter Dilettant, der dem Künstlertheater seinen Willen diktiert“). Ich fragte ihn, ob nicht ein Freiplatz für mich da sei, und erhielt einen in der ersten Reihe – aber neben Sobotka-Steffan, dem Autor. Themidore ist der unerhörteste Dreck, den ich noch auf der Bühne sah: ohne Handlung, ohne Witz, ohne Esprit, ein unglaublicher Bockmist. Die Musik von Digby La Touche kann ich nicht beurteilen. Der musikalische Strich erklärt sie als minderwertig. Schön war die Ausstattung von Oskar Graf, schön manches von Reinhardt gestellte Bühnenbild. Die Darsteller hatten garkeine Aufgaben. Nur Pallenberg war wieder glänzend; aber der dichtete offenbar seine ganze Rolle selbst zusammen. Im ganzen: wenn das die Reform der Operette sein soll, dann kann Stollberg getrost mit seinem Gärtnertheater weiterwursteln, dann ist an der Operette überhaupt Malz und Hopfen verloren. Es ist doch unglaublich, daß man, um gute Operetten spielen zu können, immer wieder zu Offenbach zurückgehn muß. Aber vielleicht entschließt sich das Künstlertheater einmal zu einer Mikado-Aufführung. Die könnte unter Reinhardts Regie fabelhaft werden. – Sobotka mahnte mich gestern wieder um einen Operetten-Text. Eigentlich dürfte ich mir die Aussicht nicht entgehn lassen. Ein Komponist wird mir gestellt. Die Aufführung am berühmtesten Theater unter Reinhardts Regie ist, wenn ich’s irgendwie gut mache – gesichert. Solche Gelegenheit findet sich nicht leicht wieder. Ich glaube wirklich, ich werde mir den Stoß geben und diese Geldarbeit machen. So könnte auch der herrliche Reichtum länger dauern.
Nachher ging’s mit den beiden Strichen und dem Puma in die Torggelstube, wo es solange nett war, bis das allmählich unvermeidlich gewordene Rindvieh Sörgel kam. Am Haupttisch saß die Vallière, umringt von einer Horde geiler Verehrer. Es wurde gepokert. Rößler rief mich an. Ich solle auf ihn warten, da er mit mir heimgehn wolle. Ich entschloß mich aber, lieber mit dem Puma mitzugehn. In der Maximilianstraße sah ich ein, daß Strich doch bei ihr bleiben werde – wenn es ihm auch nichts nützte, denn das Puma hat „die G’schicht“ –, und so trieb’s mich zurück zu den Pokerern. Das Puma warnte mich noch: „Du hast zuviel Glück in der Liebe“ rief sie mir nach. „Du verlierst gewiß alles. Bedenke die Folgen!“ Ich war denn auch entschlossen, nicht zu pokern. Nach einer Weile war Eyssler nicht mehr zu halten. Er bat, ich möchte statt seiner weiterspielen und hinterließ mir 10 Mk dazu, die ich zwar nicht gebraucht hätte, aber nahm, weil ich den Aberglauben habe, daß ich nur mit fremdem Geld gewinnen kann. Ich gewann wirklich in der kurzen Zeit, die es noch dauerte etwa 50 Mk, die nun für lauter nützliche Dinge wieder ausgegeben sind. – Ach, wie ich das Puma liebe! Als sie heut früh bei mir eintrat, lag ich splitternackt im Bett. Sie steckte mir die Zungenspitze in den Mund und trieb mich auf. Ich beobachtete ihre Blicke, als ich nackt vor ihr stand, und ich konnte damit recht zufrieden sein. Aber sie sagte nur: „Nun, mein Lieber, freust Du Dich auf Dresden?“ – Ob ich mich freue! Ob ich mich freue!!
München, Dienstag, d. 25. Juli 1911.
Mir geht’s fabelhaft gut. Lotte kommt jeden Morgen zu mir, um mich abzuholen, und morgen – dann hofft sie, wird ihr Rosengärtchen wieder empfangsbereit sein – ist mir ein Piacere in Aussicht. Daß auch sie sich auf Dresden freut, gestand sie mir heute ein. Ich bin diesmal ganz optimistisch. Daß jetzt noch etwas Störendes kommen und alles verhindern könnte – den Gedanken lasse ich garnicht zu mir ein.
Gestern war ich im „Hidalla“. Lotte und Uli wollten beide wegen der Hitze nicht mit. So lud ich Seewald ein. Wedekinds stärkste Rolle. Als Hetmann ist er durchaus genial. Übrigens ist mir auch das Stück eines der liebsten von ihm – umsomehr, als einst meine Freundschaft mit Frieda in der gemeinsamen Liebe zu dieser großartigen Tragödie des Idealismus begann. Die Vallière als Fanny Kettler war recht gut. Besonders wirkte ihre Erscheinung so vortrefflich, daß man ihr die in dieser Rolle durchaus unerläßliche Schönheit einfach glaubte. Dabei gute Bewegungen, eine reine Sprache und, wo es nötig ist, einiges Temperament: was will man mehr? Ihre Anfälle von Theatralik verzeihe ich ihr. Was sonst gezeigt wurde, war ziemlich mäßig. Raabes Morosini ging an, Rotermunds Brühl war ganz gut, Steiners Gellinghausen ohne Belang. Der Launhardt des Herrn Ansfelder ließ kalt, dagegen war die Berta Launhardt, die uns Frl. Leonhardi vorsetzte, von so grotesker Unmöglichkeit, daß man hätte weinen mögen. Schauderbar, höchst schauderbar! – Natürlich wieder sehr mangelhafte Regie, und eine Souffleuse, deren Organ ihr ein Heldentenor neiden könnte.
Dann Torggelstube: die Vallière, Steiner, Rotermund, Falkenstein, Muhr, Eyssler, Feuchtwanger, Lulu Strauß, der Wiener Siegfried Geyer. Nachher Weigert und Frau und Egon Friedell. Es war einige Erregung, da „vier Hetären“ erwartet wurden. Endlich kamen sie, und ich sah, daß es Engländerinnen vom Künstlertheater waren. Muhr, Strauß und Geyer setzten sich mit ihnen an einem Extra-Tisch. Nach einer Weile kam Muhr und fragte, ob ich englisch könne. „Yes!“ sagte ich, obgleich ich keine Ahnung habe, und ging zu den Damen. Es stellte sich heraus, daß es zwei Wienerinnen waren, die ich nun – von dem Sekt, der floß, reichlich angeregt, nach Noten poussierte. Ich unterhielt den Tisch, in dem ich die englischen Mädchen, von denen die ältere übrigens ganz reizend war, in radegebrochenem Deutsch mit englischem Akzent ansprach. Da aber mit den Ausländerinnen kein Gespräch zu führen war, wandte ich mich alsbald der Wienerin an meiner Seite zu, mit der ich solange zotete, bis sie sich willig küssen ließ. Meine Tischgenossen waren sehr erstaunt über mich, da ich selten so öffentlich aus mir herausgehe. Aber das Mädel war recht nett, und ließ sich gerne die Beine und die Brüste betasten. Natürlich mußte sie Muhr nach Hause fahren, der den ganzen Abend schon vor Eifersucht fast geplatzt wäre. Das Arschloch! Auf die Weise hat das arme Mädel nun allein schlafen gehn müssen, denn bei Muhrs Tolpatschigkeit ist es nahezu ausgeschlossen, daß er den Mut gefunden hätte, mit ihr ins Bett zu gehn.
Die Post brachte eine Karte von Landauer, der einen Beitrag für die nächste Nummer des „Sozialist“ haben will. Da ich mit dem „Kain“ noch weit zurück bin, werde ich wohl nicht dazu kommen in der kurzen Zeit. Außerdem eine Karte von Papa aus Kudowa. Ich hatte ihm kürzlich einen ausführlichen Brief geschrieben, worin ich über mein körperliches Ergehen berichtete und sehr eingehend auseinandersetzte, wie es mit „Kain“ steht. Ich dachte, er würde sich diesmal, wo er Ernst und Energie sehn mußte, mit dem Laternenpfahl winken lassen und ein paar braune Lappen lockern. Er schreibt aber blos: „Über Deine Mitteilung, Deinen Gesundheitszustand und die körperliche Kräftigung betreffend, habe ich mich sehr gefreut u.s.w.“ – von dem andern kein Wort. Ein alter Diplomat. Die Handschrift immer noch fest und deutlich, nur in der Adresse, wo er sich offenbar besondere Mühe gab, etwas zittriger als früher. Die Psychologie dieses alten Mannes ist doch ganz rätselhaft. Immer wieder der gleiche Bescheid: Warte auf mein Ende!
München, Mittwoch, d. 26. Juli 1911
Ich erwarte das Puma, das heute allerdings nicht allein kommen wird, sondern mit Strich. Wir wollen zur Pinakothek. Gestern abend waren die beiden zum Souper bei mir – vorher war ich beim Drucker und im Bad gewesen –, dann gingen wir zur Ausstellung hinaus. Nach einer Weile kam Sörgel, der mit seiner dummen Langweiligkeit Strich sofort mit Beschlag belegte. Lotte ärgerte sich sichtlich darüber und forderte mich auf, etwas im Ausstellungspark mit ihr zu spazieren. Wir hatten ernste Gespräche miteinander. Sie sagte mir allerlei Liebes, so, daß ich der einzige Freund bin, den sie habe, der einzige, vor dem sie keine Geheimnisse zu haben brauche, und der sie in ihrem wirklichen Wert erkenne. Über Hardekopf in seiner Beziehung zu Lotte einigten wir uns auf diese Formel: er habe die Kleinheit, die er in ihr nur erkennen konnte, für seine Phantasie vergrößert und das Bild Lottes dadurch völlig verzerrt. Psychologische Erwägungen, wie Strich sich verhalten würde, wenn er von Lottes verschiedentlichen Seitensprüngen erführe – mit dem Ergebnis, daß er unter keiner Bedingung auch nur etwas ahnen dürfe. Ich erzählte Lotte, wie merkwürdig ich veranlagt sei: ich liebe sie inbrünstig und doch wäre ich, wenn sie erst 5 Minuten fort sei, sofort bereit, mit einer andern schlafen zu gehn. Sie meinte, das komme wohl daher, daß ich kein richtiges Verhältnis mit ihr habe, also unbefriedigt sei und Sensationen gebrauche. Möglich. Dann ließ ich das Puma bei einem Silhuettenschneider portraitieren und ein Schattenriß mit, einer ohne Hut prangen jetzt auf meinem Schreibtisch. Wir gingen zu Strich und Sörgel zurück, nachher alle in die Torggelstube, wo an allen Tischen Bekannte von mir saßen. Fritz Strich kam hinzu und wir waren recht vergnügt und dalberten viel. Nachher ging ich noch mit Lotte und Strich ins Orlando, und auf dem Heimweg erörterten wir sehr ergiebig die Zusammenhänge des physischen Ausdrucks eines Menschen mit seinen psychischen Erlebnissen. Lotte beteiligte sich sehr lebendig an dem Gespräch und sagte einiges so Wunderschönes und sagte es so leidenschaftlich und beteiligt, daß meine Liebe und Bewunderung für sie grenzenlos waren. Es ist nicht wahr, daß Bettina von Arnim die letzte bedeutende Frau war.
München, Donnerstag, d. 27. Juli 1911.
Gestern konnte ich keinen Augenblick mit dem Puma allein sein. Strich war immer dabei, selbst abends kam er ins Theater mit. Vormittags alte Pinakothek, eine der herrlichsten Galerien, die es gibt. Seit Tschudi Direktor ist, ist alles noch viel schöner sichtbar als früher. Die Bilder hängen hervorragend gut, und die Ausschaltung minderwertiger Werke und die Neuerwerbung wertvoller erhebt die Pinakothek auf eine großartige Höhe. Besonders interessierten mich ein paar neuerworbene Goyas – darunter besonders das Porträt einer spanischen Königin, und eine Leihausstellung aus dem Nachlaß eines Ungarn, darunter eine Reihe wundervoller Grecos. Dieses Licht, das aus dessen Bildern strömt! Diese Ruhe der Komposition, diese Kraft der Bewegung! Am schönsten darunter fand ich das von Tschudi angekaufte Passionsbild. Auch den Laokoon finde ich herrlich und Christus auf dem Ölberg. Ich war lange in den Räumen der Gallerie – Strich und Lotte besahen inzwischen unten die Vasen-Ausstellung. – Nachher Hofgarten, dann Café Börse und abends Theater; wir sahen „Zensur“ und „Kammersänger“ von und mit Wedekind. Die „Zensur“ ist mir eines seiner wertvollsten Bekenntniswerke. Es ist schon großartig, wie er schamlos die Gardine vor seinen eignen Ehe- und Liebeserlebnissen wegzieht, und dann in ganz künstlerischer Geste Personen und Handlungen symbolisiert und zur Lebenstendenz verallgemeinert. – Sein Spiel war mir immer da, wo er Wedekind war, prachtvoll, da wo er Schauspieler war, schmierenmäßig. Die Vallière als Partnerin recht wirksam, Raabes Zensor einwandfrei. – Den „Kammersänger“ faßt Wedekind im Gegensatz zu fast allen Berufsschauspielern völlig ernst auf. Der überlegene zynische Künstler mit einem starken Fonds Menschlichkeit. Es wurde allgemein flott und gut gespielt, sodaß die letzten Premieren des Gastspiels, in dem nun keine mehr folgt, weit besser ausfielen als die ersten. Ich werde heut noch, sonst morgen, über das gesamte Juli-Gastspiel für den „Kain“ schreiben und mich für Wedekind, für die Vallière und sehr gegen das regielose Theater wenden.
Nachher waren wir im Ratskeller, wo wir über das Problem „Ehe“ sprachen, Strich dafür, ich dagegen – wobei Lotte sehr scharf, sehr geistvoll und bestimmt Strichs Partei ergriff. Heut berichtete sie mir, ihr sei das zwar alles im Moment völlig ernst gewesen – das Ideal der Treue und der Monogamie, aber ein andres Mal könnte sie ebensogut in Übereinstimmung mit ihrer Praxis das Gegenteil verfechten. Später gingen wir noch in die Torggelstube, wo wir den Bruder Strichs trafen – auch Sörgel erschien dann natürlich –. Heftige Dispute über Anarchismus, Individualismus, Nivellierung und Differenzierung. Die beiden Brüder, bei denen ich die Gleichartigkeit des logischen Denkens bewunderte, drängten gegen meine Überzeugungen. Sörgel warf hier und da ein Wort dazwischen, mit dem er seine gänzliche Unfähigkeit, prinzipiell zu urteilen, bewies. Das Puma war von der Hitze kaput und beteiligte sich garnicht am Gespräch. – Heut vormittag kam sie bei mir an. Zum Piacere war es ihr zu heiß: es sind 36° Celsius im Schatten. Ich setzte sie im Hofgarten ab, nachdem wir zusammen gegessen hatten, und ging mit Alwa ins Ungererbad schwimmen. Dort passierte mir etwas sehr Lustiges. Ein unendlich dicker Kerl begrinste mich und ich hörte, wie er „süß“ sagte. Ich konnte, da ich keinen Kneifer aufhatte, die Physiognomie des Menschen nicht erkennen und fragte ihn, wer er sei. Nun rückte er näher. Ich sah einen ältlichen bartlosen, weibisch aussehenden Glatzkopf, der jetzt ein Gespräch mit mir begann. Nach ein paar Worten war mir klar, daß er schwulen wollte. Dem muß es in Eroticis arg schlecht gehn, wenn er schon auf mich verfällt. Ich ließ ihn schonungsvoll und sehr amüsiert stehn. – Abends soll ich das Puma unterhalten. Inzwischen muß ich noch tüchtig arbeiten.
München, Freitag, d. 28. Juli 1911.
Das Geld geht höllisch auf die Neige. Gestern holte ich 500 Mk von der Bank. Davon wollte ich bis zur Abreise leben und die ganze Reise bezahlen. Es wird aber bestimmt nicht reichen, wenn ich, wie ich beabsichtige 400 Mk für die Hochzeitsreise brauche. Ich gab dem Puma gestern 50 Mk in bar, damit sie noch nötige Anschaffungen machen kann. Dann war ich den größten Teil des Tages mit ihr beisammen, und gab viel aus. Wir waren im Cabaret zum „Grünen Pegasus“, wo uns ein wenig genußreiches Programm vorgetingelt wurde. Von der Bühne herunter begrüßte mich der dicke Heinz Lebrun, dessen schöne Stimme allmählich auch unter dem Suff leidet. Nachher fuhren wir per Droschke zur Torggelstube, und unterwegs durfte ich Lottes Mund heiß und zärtlich küssen. Sie sagte da zu mir: „Daß ich mich von dir küssen lasse ist mehr, als daß ich mit dir schlafen gehe.“ – In der Torggelstube führte ich sie an den eng besetzten Stammtisch, und sie lernte eine Reihe von Leuten kennen, darunter Alfred Polgar aus Wien, der zur Zeit hier ist (vorgestern tauchte er mit dem Ungarn Molnár auf), Geyer, Feuchtwanger, der Direktor der Wiener Residenzbühne, dessen Namen ich nicht verstand, die Vallière, Falkenstein u.s.w. Lotte war recht beschwipst und poussierte mit den Wienern nach Noten. Draußen saß Wedekind, kaute am Bleistift und dichtete. Lotte sprach ihn an, leider war ich nicht dabei. Wedekind soll sehr nett und sehr schüchtern gewesen sein. Nachher kamen die Strichbrüder, zu denen wir an einen andern Tisch gingen. Ich fuhr mit Lotte und Strich per Droschke heim. Als ich das betrunkene Puma küssen wollte, sagte sie boshaft: „Nicht küssen, mein Angenehmster. Dazu muß ich zuviel Dégouts überwinden.“ Das Wort lag mir schwer auf der Seele und ich kam traurig ins Bett. – Heut war ich mit Lotte im Luitpold, wo ich Mary Irber sprach. Ich soll sie demnächst besuchen, wenn ihr Graf fort ist (also doch?). Sie sah reizend aus. – Jetzt komme ich vom Baden – in der unheimlichen, anscheinend nie endenden Hitze eine herrliche Wohltat. Heut wurde der alte Dickbauch von gestern hinausgesetzt, weil er auch gegen andre Leute zudringlich wurde. Es gab großes Gelächter, und ich hatte einen persönlichen Erfolg mit der Bemerkung: „Das ist doch verständlich, daß einer bei der Temperatur warm wird.“
Ein Telegramm aus Bern: „Examen siegreich bestanden Doktor Nohl, Schwarzthorstraße.“ Doktor Nohl? Das ist wohl nur ein Witz von Johannes. Ich sandte telegrafisch zwanzig Franken.