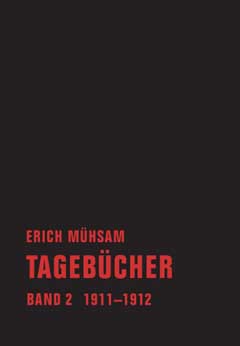VII
17. Oktober 1911 – 5. Januar 1912
S. 868 – 1011
Fortsetzung vom 17. Oktober 1911.
Freundin Bob nach großem Krach endlich doch abgereist sei. Sie hatte das Julchen in einer Bar mit ihrem Grafen – jetzt spricht sie von ihm schon per Ottokar – überrascht. – Um 2 Uhr brachen wir auf, und der Bankdirektor brachte mich noch per Auto vor den „Simpl“. Dort traf ich zu meiner Freude Peppi Kirchhoff mit einer Freundin. Ich war sehr lustig und ziemlich stark angetrunken. Ich bekam von beiden Mädchen und von Emmy Mundküsse.
Als ich nach 3 Uhr heimkam, fand ich ein Telegramm von Johannes vor: „Um Himmels willen Monatsvorschuß telegrafisch.“ Nach Wien, postlagernd. Ich habe heute 20 Kronen telegrafisch abgeschickt. – Ich bin recht ärgerlich über den Freund. Er hat der Wirtin hier gesagt, er habe mich damals noch im Orlando gesucht, ich sei aber schon weg gewesen. Nach Zürich hatte er mir ein Telegramm gesandt: „Liberato“, sodaß ich doch annehmen mußte, er sei hier verhaftet gewesen und nun noch keine schriftliche Zeile, sondern nur diese lakonische Geldforderung, nachdem ich ihm vor 3 Tagen erst 50 Mk extra gegeben hatte. Wo soll das hinaus, da ich doch selbst noch arg in Schulden stecke und in meinem Alter immer mehr Bedürfnisse für mich selber habe! – Ich hoffe sehr, daß sich sein Verhältnis zu seinem Vater bald völlig klären wird. Er erzählte bei seinem Hiersein, daß der Vater, dieser halsstarrige Professor ihm einen versöhnlichen Brief geschrieben habe, aus dem eine baldige Annäherung und Aussöhnung wohl zu schließen ist. Es wäre für ihn ein Glück und auch unsrer Freundschaft nur zuträglich, die doch fortwährend durch finanzielle Häßlichkeiten getrübt wird. Ich weiß genau, daß er mir manchmal im Stillen nachrechnet und dann wohl sicher meine Opferwilligkeit mangelhaft findet, und ich leugne mir garnicht, daß ich oft Anforderungen, die außerhalb der Monatsraten an mich herantreten sehr bedrücklich empfinde. Es wäre sehr an der Zeit, daß diese Schwierigkeit zwischen uns behoben würde.
Heut früh brachte der Geldbriefträger eine Postanweisung aus Zürich. Der Kassierer des Freidenker-Vereins sendet mir „laut Beschluß des Vorstandes“ ganze 8 Mark (10 Franken). Das Billet allein hat mich 21 Mk 20 gekostet, Auto, Hotel. 3 versäumte Tage – ein nettes Geschäft. Vielleicht werde ich die Schweinerei doch noch öffentlich blosstellen ...
Zwei neue Bücher kamen an: „Aus der Enge“. Gedichte von Friedrich Wilhelm Wagner. 1911. Verlag von K. G. Th. Scheffer in Groß-Lichterfelde und „Frank Wedekind als Mensch und Künstler“. Eine Studie von Dr. Hans Kempner in Breslau. 3–10. Tausend. Verlag Oskar Linser, Pankow-Berlin. Beide Autoren schreiben mir dazu in besonderen Briefen, ich möchte ihre Arbeiten im „Kain“ „würdigen“. Ich werde mich zu beherrschen wissen.
München, Mittwoch, d. 18. Oktober 1911.
Mir geht’s übel. Ich bin dem verfluchten Bandwurm nun endlich mit Helfenberger Kapseln zu Leibe gegangen, die teils Rizinus-Öl, teils Filix-Extrakt enthalten. Bis jetzt ist ein mächtiges Ende des Viehs abgegangen, mindestens acht Meter, aber der Kopf ist noch nicht heraus, und ich fürchte, ich werde die unheimlich anstrengende Kur wiederholen müssen. Raus muß die Schweinerei! Wie jämmerlich kleinlich sind doch die Chikanen der Natur. Ich vergleiche den lieben Gott gewöhnlich mit einem Amtsrichter.
Von Johannes kommt eine sehr betrübende Karte aus Wien. Er und Iza wurden, da sie keine Anzahlung leisten konnten, nirgends aufgenommen und mußten im Freien kampieren. Julius Muhr, an den ich ihm einen Empfehlungsbrief mitgegeben hatte, war sehr unfreundlich und gab ihnen nicht einmal die Hand. Nun will er die Adresse von Rudolf Grossmann. Ich werde ihn außerdem an Hermann Bahr rekommandieren. Schade, daß Kraus, der in Gelddingen einer der anständigsten Menschen ist, die ich kennen gelernt habe, für Freundschaftsdienste nicht mehr in Frage kommt. Er hat sich doch in seinen Polemiken gegen mich zu schäbig gezeigt. Hoffentlich nützen die 20 Kronen, die ich gestern sandte, bis aufs Erste. Ich kann sonst garnichts mehr tun. Von den Honoraren des Kleinen Theaters habe ich noch Schulden und alles mögliche zu zahlen, und wenn ich denke, daß ich von dem wenigen, worüber ich selbst verfüge, in diesem Monat schon über 100 Mark an Johannes weggegeben habe – die Pensionsrechnung zähle ich dabei garnicht – so kommt mir immer vor, als ob ich doch auch gewisse Rechte selbst auf meine Einnahmen habe. Ich ärgere mich sehr darüber, daß Johannes die 50 Mk, die ich ihm gab, verjuxt hat und daß ich sie jetzt wieder ersetzen soll. Er müßte doch einsehn, daß nur die allerintimste Gemeinschaft zwischen zwei Menschen solche Anforderungen an einen, der selbst arm ist, rechtfertigen kann. Gab ich ihm früher alles und behielt selbst nicht das Mindeste, so war das natürlich und in der Ordnung, da ich außer ihm keine Welt hatte. Jetzt hat er eine Frau, ich hundert andre Beziehungen, da muß er mir schon auch einiges Eigenleben zubilligen.
Im Kleinen Theater wirke ich recht erfolgreich. Da ich im vorigen Jahr in Frankfurt glatt abstank, freut mich das. Es zeigt mir, daß ich diese Einnahmemöglichkeit immer wieder aufschließen kann, und ich denke sehr daran, mich mal gelegentlich für einen Monat nach Wien engagieren zu lassen. – Aus der „Fackel“ entnehme ich, daß Ludwig Ritter von Janikowsky gestorben ist, ein Freund von Kraus, mit dem ich in der Wiener Zeit oft beisammen war und der mir einmal sehr Interessantes und Intimes aus dem Leben und vom Tode der ermordeten ersten Frau von Przybyszewsky, Ducha, erzählte (Übrigens hörte ich von Emmy, daß Przybyszewsky nun auch von seiner zweiten Frau, der ehemaligen Casparowicz, getrennt sei.)
München, Donnerstag, d. 19. Oktober 1911.
Meine Arbeitsfreudigkeit und Schaffenskraft scheint plötzlich total gestört zu sein. Ich fürchte, es gibt in der allernächsten Zeit eine Katastrophe. Denn, was in Nr. 8 des „Kain“ kommt, ist mir noch völlig dunkel, und zum Kalender, dessen Erscheinen für Oktober öffentlich annonciert war, fehlen mir noch immer eine Menge wichtiger Beiträge. – Gestern störte mich in der Fortführung dieser Aufzeichnungen der Konsul, deren Küsse mir immer wieder wesentlicher sind als alle Berufsarbeit. Sie gestand ein, daß die ganze Ehebruchsgeschichte mit dem Architekten Lutz eine Komödie war, die Rößler und sie mir vorgespielt haben. Sie haben beide ausgezeichnet gespielt. Abends war ich bei ihnen zum Souper. – Dann begleitete mich der Konsul zum Kleinen Theater und zeigte sich nachher von meinem Vortrag sehr entzückt. Ich komme vorläufig immer erst als letzter dran und muß selbst sagen, daß alles was vorher kommt, äußerster Dreck ist. Ich habe dem Direktor gestern sehr deutlich meine Meinung über das Unternehmen mitgeteilt. Die Stöckl hatte mir ins Theater einen Brief geschrieben, ich möchte doch noch ins Benz kommen, sie habe mit mir etwas Wichtiges zu sprechen. Sie saß mit ihrem Grafen bei Sekt. Ich setzte mich nicht dazu, sondern ging mit ihr hinaus. Sie wünschte eine Änderung der beiden Schlußzeilen meines Gedichts „Der Dichter“ („Hol der Teufel die ganze Schweinerei“), das sie vortragen möchte. Ich nahm die Änderung sofort zu ihrer Befriedigung vor. Dann erzählte sie mir, sie sei nach Bobs Abreise vom Regen in die Traufe geraten, da „Ottokar“ wahnsinnig eifersüchtig auf mich sei. Er hat neulich gesehn, wie ich ihr die Schulter küßte. Am 24ten soll er abreisen, und dann will Julchen mir ihr Versprechen einlösen.
Heut früh kam Albert R. zu mir. Ich bat ihn, da er auf der Reise nach Wien ist, sich doch Johannes’ anzunehmen. Dem muß ich nun gleich poste restante schreiben, um womöglich ein Rendez-vous zu vermitteln. Übrigens traf ich gestern Wolfskehl, dem ich ankündigte, ich würde mich, sobald Johannes sich wieder in Geldnot an mich wenden würde, seiner entsinnen. Er meinte, daß wir demnächst darüber reden müßten. Ich hoffe, ihn zu regelmäßiger Zahlung bewegen zu können. – Heut war Emmy bei mir zu Tisch. Ich fürchte, man wird sie über kurz oder lang ausweisen, da sie – das erfuhr ich erst heute von ihr – garnicht Emmy Hennings heißt, sondern Dagni Lund und dänische Staatszugehörige ist. Sie war sehr zärtlich zu mir, und hätte sie nicht grade wieder die „G’schicht“, so wäre es wohl nicht dabei geblieben, daß sie mir blos den Penis aus der Hose zog und ihn liebevoll streichelte. – Jetzt aber an die Arbeit!
München, Freitag, d. 20. Oktober 1911.
Es ist ein Skandal: ich habe immer noch nichts weiter gearbeitet. Jetzt will ich aber das Tagebuch wirklich ein wenig vernachlässigen. Heut nachmittag und die nächsten Tage wird was getan. – Zu berichten gibt’s ohnehin wenig. Emmy werde ich wahrscheinlich am Kleinen Theater anbringen. Ich stellte sie gestern dort vor und sie machte guten Eindruck. – Von einer neuerlichen Korrespondenz mit Minnie Kornfeld ist noch zu berichten. Sie hatte mir einen flehentlichen Brief geschrieben, ich möchte ihr wieder Gedichte zur Rezitation schicken und das hatte ich dann auch getan. Heut kam nun ein rührender Brief von ihr voll Dankbarkeit und Begeisterung. Wüßte ich nur: liebt die Frau mich oder meine Verse? Immerhin: beides ist was wert, und ich will sie fortab besser behandeln als bisher. – Mit der Familie Douglas-Andrée scheinen sich jetzt nach dem Tode des Mannes wieder Beziehungen anzubahnen. Gestern überreichte mir die Frau (Lotte nennt sie „die Zirkusdame“) ein Bild von Addi, der auch selbst dabei saß. Ich habe für den Jungen sehr viel Sentiment. Er ist eigentlich der einzige Mensch, dem gegenüber ich ein bißchen schlechtes Gewissen habe. Er hat mich so sehr geliebt und wurde dann gegen mich aufgehetzt. Nun weiß er garnicht, wie er sich zu mir verhalten soll. Ich streichelte ihm gestern einmal im Vorbeigehn das Haar. – Wäre nur die Mutter nicht so gefährlich intrigant!
München, Sonnabend, d. 21. Oktober 1911.
Lotte ist endlich zurück. Ich war nach meinem Auftreten in die Torggelstube gefahren, dorthin kam sie mit den Strich-Brüdern. Blei hatte sich zum ersten Mal als Schauspieler produziert in Sternheims „Hose“ (daß ich nicht dort sein konnte, tat mir furchtbar leid), und Lotte war, nach dem Ausdruck des kleinen Hörschelmanns, vom Bahnhof aus „direkt in die Hose gefahren“. Ich war sehr glücklich, sie wiederzusehn. Sie sah ganz reizend aus, war witzig und liebenswürdig und ihre kleinen Bosheiten gegen mich hatten einen zärtlichen Beigeschmack. Morgen vormittag kommt sie zu mir. Als sie ging, setzte ich mich an den Haupttisch und pokerte (Ertrag: 21 Mark). Ich zahlte dann Rauschenbusch die 25 Mk, die ich ihm seit einem Jahr schuldete, und ging nachher, aber animiert, ins Orlando hinüber, wo ich mein kleines Hürchen traf und mit mir nahm. Sie blieb etwa eine Stunde bei mir, und das genügte mir. Es war seit Kätchens Abreise die erste Frau, die bei mir im Bett war, und ich denke, nun wird wohl bald allerhand folgen: Lotte wird mir ihre Gunst nicht weigern, Emmy ist wieder gesund und hat mir, sobald ihre „G’schicht“ vorüber ist, einige Nächte versprochen, am 23ten reist der Graf Schwerin ab und die Stöckl ist für mich frei, und in den allernächsten Tagen fährt Rößler nach Berlin, sodaß meine Bemühungen um den Konsul wohl auch nicht länger erfolglos bleiben werden ... Ich habe eine sichere Ahnung, daß Frieda in sehr kurzer Zeit wieder da sein wird. Das wird mein ewiger Gram bleiben, daß ich nicht alle andern um ihretwillen verschmähen darf.
München, Montag, d. 23. Oktober 1911.
Nur einige Daten über die letzten beiden Tage. Denn die Arbeit ruht immer noch, und ich muß jetzt alle Hoffnung darauf setzen, daß ich heut zum letzten Mal im Kleinen Theater auftrete, also morgen die Entschuldigung zu großer Nervenanspannung nicht mehr habe. Diese Woche muß intensiv geschuftet werden, sonst ist’s mit Kain No. 8 und mit dem Kalender Essig.
Sonnabend hatte ich zwei Besuche alter Herren. Mittags kam ein 66jähriger pensionierter elsässischer höherer Zollbeamter, namens Figer, zu mir, der sich durch allerlei Chikanen beschwert fühlt. Ein typischer Querulant, der – wie jeder Querulant – natürlich reichliche Gründe zur Unzufriedenheit hat, dem aber die angetane Unbill zur Monomanie geworden ist. Es war sehr schwer, ihm auseinanderzusetzen, daß der „Kain“ nicht der geeignete Ort sei, seine Beschwerde anzubringen. Ich gab ihm schließlich die Adresse von René Schickele, der sich ja nicht sehr freuen wird, dem Manne aber immer noch eher raten kann als ich. Mir tat der arme Teufel, dem helle Tränen in den Augen standen, in der Seele leid. – Abends erschien der etwa ebenso alte Hofschauspieler Aloys Wohlmuth. Ich hatte ihm wegen des Gedichtes gegen Possart, das mir Feuchtwanger kürzlich gegeben hatte, geschrieben, und nun kam er selbst. Da er verlangte, ich solle das von Haß triefende Gedicht als meines ausgeben – ich hätte das schon um der schwachen Form willen nicht gekonnt, – kann aus der Publikation im „Kain“ nichts werden. – Aber prächtig waren die Wutausbrüche des alten Mannes gegen Possart, diesen „Hund“, diesen „Burschen“, diesen „Hundsfott“. Eine solche Anhäufung von Haß, Erbitterung, Rachsucht kann wirklich nur durch einen kompletten Schweinhund in einem so alten Herzen entfesselt werden, und die Beispiele, die Wohlmuth erzählte, unzählige Beispiele, verraten den alten Possart wirklich als Erzlumpen. Während er noch bei mir war, kamen Rößler und der Konsul, der sein Stück fertig hat, wollte adjö sagen, da er nach Berlin fahre, um es anzubringen. Leider werden mir die Tage seiner Abwesenheit nicht viel nützen, da ausgerechnet jetzt die Mutter und Schwester des Konsuls zu Besuch da sind. (Die Schwester sähe ich gern wieder). Übrigens ist ja Lotte wieder da und mein Wunsch, den Konsul herumzukriegen, ist dadurch eo ipso etwas gedämpft, was Rößler schon hoffnungsvoll prophezeit hatte. – Abends ging ich dann in die Torggelstube: Muhr, Eyssler, Dr. Brecher und dessen Mädel. Wedekind kam und setzte sich in den andern Raum. Ich flüchtete zu ihm, und wir hatten unterhaltende Gespräche über Politik. Er gab mir eine Rundfrage der „Zeit“ über den tripolitanischen Krieg, und las mir seine Antwort darauf vor. Sie lautet dahin, daß Wedekind mit Italiens Vorgehen ganz einverstanden ist, da der Islam in Europa keine Existenzberechtigung mehr habe. Ich war entsetzt und entwickelte meinen Standpunkt, indem ich die Angelegenheit ganz von der sozialen und allgemein menschlichen Seite her betrachtete. Da Wedekind mir den Brief der „Zeit“ mitgab, werde ich im „Kain“ die Sache behandeln. – Nachher wieder Gespräche über Ehe und Eifersucht. Wedekind zitierte einiges, was er über die Beziehung von Mutter und Kind in seinem neuen Stück geschrieben hat. Um 2 Uhr kamen Gotthelf und Lulu Strauß, und wir alle brachen sehr bald auf.
Sonntag: Lotte holte mich aus dem Bett, sah interessiert zu, wie ich mich splitternackt wusch, und wir fuhren zur Auer Dult. Dort kaufte ich allerlei Hübsches für sie, darunter ein entzückendes Bettmodell, das grad für ihre Puppen paßt. Dann aßen wir in der Torggelstube und gingen später ins Stefanie, nachdem ich noch vorher in ihrem Zimmer zusehn durfte, wie sie sich umzog. Ihre Nacktheit, die sie absichtlich lange vor mir zeigte, berauschte mich, aber das begehrte Piacere verweigerte sie mir. Dagegen küßte sie mich so herzlich und lange auf den Mund, wie ich es – außerhalb des Bettes – noch nicht von ihr erlebt habe. – Als ich später allein im Stefanie saß, kam Emmy voll Aufregung und erzählte diese Abenteuerlichkeit: Vor einigen Tagen hatte sie in ihrem Atelier wieder mal eine Erscheinung. Sie sah eine wildfremde Frau stehn, die auf einmal wieder verschwand. Nun hat sie in diesen Tagen die kleine Fränze Fischer photographiert und gestern entdeckte sie beim Entwickeln der Platte, daß auf dem Negativ hinter Fränze deutlich jene fremde Frau zu sehn ist. Ich habe das Negativ noch nicht gesehn. Bis sie es mir gezeigt hat, bin ich geneigt, mir die Sache rationalistisch zu erklären. Immerhin: Kein Mensch kann wissen, ob nicht die Phantasie guter Medien – und das ist Emmy bestimmt – bis zur Materialisation ihrer Imagination geht. Jedenfalls will ich das Mädel mal zu Schrenck-Notzing schicken. Für den ist sie gewiß ein „Fall“. Nachher kam sie zu mir zum Abendbrot. Ich mußte ihr dann noch eine Rolle abhören, die sie im Kleinen Theater spielen soll und als ich fort wollte, da es Zeit für mich wurde, meine Verpflichtung diesem Kunstausschank gegenüber zu erfüllen, verlangte sie, ich müsse sie erst vögeln. Du lieber Himmel! Der Mensch ist schwach, und ich tat ihr den Willen, erfreut, sie nach so langer Zeit dazu wieder imstande zu finden. Eine merkwürdige Perversität von ihr ist es, während des Aktes ihre Geilheit durch die ordinärsten Ausdrücke zu bestätigen. Dabei beschimpft sie den Mann unter ihren rasenden Küssen – aber ich kann nicht leugnen, daß mich dies Verhalten sehr reizt und aufregt.
Heute: Zum Mittagessen war das Puma bei mir. Nachher sträubte sie sich nicht mehr. Nachdem ich vorher, während sie vor dem Spiegel ihre Beine bewunderte vor ihr hingekniet war und sie da geküßt hatte – sehr lange und inbrünstig geküßt, – wo es die Frauen am liebsten haben, – sie stand dabei an die Tischplatte gelehnt und betrachtete den Vorgang im Spiegel, – nötigte ich sie auf den Divan, wo wir dann ausgiebig und ganz richtig Wiedersehen feierten. – Nachtragen will ich noch, daß ich gestern nachmittag mit Lotte eine einstündige Droschkenfahrt durch den herbstbunten englischen Garten gemacht hatte, bei der wir beide fast kein Wort sprachen, und die doch wie eine wirkliche Liebesverständigung zwischen uns wirkte. Ach, bin ich froh, daß Lotte wieder hier ist! Jetzt wird es mir sobald nicht wieder lange schlecht gehn.
Heut nachmittag im Café fragte mich Poppert, ob ich nicht geneigt sei, das Gastspiel am Kleinen Theater noch 3–4 Tage zu verlängern. Da mir das Geld sehr zupaß kommt – ich möchte Lotte noch viel schenken – sagte ich zu.
München, Dienstag, d. 24. Oktober 1911.
In 10 Tagen soll der Kain Nr. 8 erscheinen, und noch immer ist kein einziges Manuskript da. Wie das werden soll, wissen die Götter. Jetzt erwarte ich das Puma zu Tisch. – Über Johannes bin ich sehr ärgerlich. Außer einem Telegramm und einer Postkarte, worin er Geld verlangt, noch keine Silbe aus Wien, nicht einmal die Adresse. Wer ihn damals hinderte, ins Café Orlando zurückzukommen, weiß ich jetzt. Ich traf nämlich heute Heinz (mit dem langen Friedel; sie gingen „ins Geschäft“), und der erzählte mir, Johannes sei ihm begegnet. Das erklärt freilich alles. Es wird mich aber nicht hindern, ihm im nächsten Brief, mit dem ich mich nicht beeilen werde, deutlichst meinen Standpunkt klar zu machen. – – Das Nebenzimmer, worin damals das unglückliche Kätchen einquartiert war, ist wieder bevölkert. Es wohnt eine 17jährige Soubrette, ein Fräulein Hell, darin, das ich bis dahin nur vom Hören kannte, indem sie mitunter allerliebst trällert und singt. Heut nacht begegnete ich ihr auf der Treppe. Ich leuchtete ihr durch den Korridor und sah, daß sie ganz allerliebst ist. Leider fand ich nicht den Mut, ein Gespräch zu beginnen. Das soll baldmöglichst nachgeholt werden. Ich habe lange keine neue Frau kennen gelernt.
München, Dienstag, d. 26. Oktober 1911.
Noch immer bin ich beim ersten Artikel (über die Terwin), ich werde wohl noch eine Nacht dranwenden müssen. Jedenfalls aber erlebe ich jetzt Angenehmes. Vorgestern hatte ich seltsamen Kaffeeklatsch bei mir. Das Puma hatte bei mir Mittag gegessen – manchen Kuß bekam ich bei dieser Gelegenheit –, und dann kam der Konsul herunter. Wir hielten sie zum Kaffee fest. Plötzlich erschien ihre Schwester – Muscha geheißen –, ein herrliches Geschöpf, das zerbrechlichste, was ich je sah, in der Figur erinnert sie an Uli. Lotte und ich waren begeistert. Der Konsul mußte leider fort, ließ uns aber die Schwester da, und ich lud mir nun noch meine neue Nachbarin ein, die auch gern kam, Justine Hell, ein nettes, ganz junges, dummliches hübsches Ding. Wir benahmen uns alle sehr korrekt, aber doch war es ganz lustig. Nachher ging ich mit Lotte Einkäufe machen. Ich liebe Lotte sehr, sehr, sehr.
Gestern fand ein Piacere mit Emmy statt, die mich in Gegenwart von Lotte und Strich im Café so aufgeregt hatte, daß ich nicht anders konnte, als sie mit mir zum Abendbrot zu nehmen. Übrigens war sie im Bett reizend.
Heute früh bekam ich schon im Bett Küsse vom Konsul, die mir von Heller ausrichtete, ich soll morgen bei ihm meine „Freivermählten“ vorlesen. Gustel Waldau wird dort sein und der Konsul, und ich will auch das Puma bitten, mitzukommen. Auf meine Frage an den Consul, ob wir nun nicht doch Rößler betrügen wollen, meinte sie: „Lust hätte ich schon“. Ich denke, in einer der nächsten Nächte wird es vor sich gehn. Auch die Stöckl muß ich noch haben, ehe sie – am 1ten – abreist. Ob mit Frl. Hell was zu wollen sein wird, scheint mir zweifelhaft. Vielleicht kuppelt uns die nahe Nachbarschaft einmal zusammen.
Von Johannes ein trauriger Brief aus Wien. Ihm geht es sehr schlecht. Ich werde ihm heute 25 Kronen schicken.
München, Freitag, d. 27. Oktober 1911.
Dies scheint kein Glückstag zu werden. Ich machte heute nacht eine hanebüchene Dummheit. Ich war bei Benz gewesen, wo ich erst die Stöckl, dann eine reizende kleine Engländerin poussierte. Meine Hoffnung, eine von beiden mit mir nehmen zu können, erwies sich leider als irrig, und nun kam ich gegen 3 Uhr ziemlich alkoholisiert heim. Bei meiner Nachbarin war Licht, und ich sah, daß ihre Tür zum Speisesaal hin offen stand. Weiß der Teufel, was mich ritt, jedenfalls kletterte ich im Hemd aus dem Bett, schlich mich in den Speisesaal und wollte von dort aus beobachten. Ich sah ins offene Schlafzimmer der Kleinen hinein, ohne das Bett sehn zu können, das um die Ecke stand. Es rührte sich nichts im Zimmer, ich fand aber nicht den Mut, einzutreten. Plötzlich ging die Korridortür, und das Mädel kam erst von unten herauf. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Sie war offenbar sehr empört und fragte, was ich in ihrem Zimmer zu suchen hätte. Ich erklärte ihr, ich hätte nur im Speisesaal Streichhölzer gesucht. Jetzt liegt sie noch zu Bett. Wenn sie den Wirtsleuten die Sache berichtet, sehe ich allerlei Unangenehmes entstehn. Jetzt erwarte ich Lotte zu Tisch. Die soll mir raten, ob ich mich schriftlich entschuldigen soll oder was sonst tun.
Eben kommt ein Brief von Onkel Leopold, der mir mitteilt, daß wider sein Erwarten meine Geschwister den Kain nicht finanzieren werden. Eine unglaubliche Bande. Es wirkt wie Hohn auf mich, daß gleichzeitig die offizielle Einladung zu dem famosen Familientag eintrifft, zu dem ich mich am 12. November einfinden soll. Es wird darin mitgeteilt, daß meines Vetters Kurt Mühsam Drama „Sonnenbursch“ am 13ten im Friedrich Wilhelmstädtischen Schauspielhaus aufgeführt wird. Der versteht sich aufs Geschäft und auf Reklame. Pfui Teufel!
Mit dem neuen Kain-Heft bin ich seit gestern ein gut Stück weiter. Heute werde ich abliefern, was bis jetzt da ist und hoffe auch noch den Rest fertig zu stellen. Falls mit meiner Anstellung am „Komet“ etwas wird mit 200 Mk monatlich, würde ich 100 Mk davon regelmäßig an Steinebach abliefern, damit das Blatt weiter erscheinen kann. Wie kann ich mich nur einmal an den Geschwistern rächen?
Uli und Seewald sind seit einigen Tagen fort – nach Paris. Sie mußten sozusagen flüchten, da Thesings rohe Leidenschaft Gewalttätigkeiten gegen Seewald befürchten ließ. Schade, ich war grade wieder mit Uli vertrauter geworden. Daß sie mich je wieder lieben wird, bezweifle ich ja, aber sehr gute Freunde werden wir immer bleiben.
München, Nacht auf Sonntag, d. 29. Oktober 1911
Es ist gleich ½ 4 Uhr. Ich komme aus dem Stefanie heim, wo ich seit 11 Uhr mit dem Puma, Strich und dem Ungarn Nikoschani pokerte (Ertrag 11 Mk). Ich bin zu nervös um gleich schlafen zu können. So will ich das Tagebuch erledigen.
Zwei Tragödien: Thesing macht furchtbare Geschichten, säuft wie ein Wahnsinniger, zwinkert mit einem scharfgeladenen Revolver und hat irgendwoher auf mysteriöse Weise 200 Mark erlangt, womit er nach Paris zu fahren droht, um Seewald zu erschießen. Der arme Teufel ist total irrsinnig. Es ist wohl das erste Mal, daß ihm eine wertvolle Frau nahe getreten ist und das erträgt seine robuste Seele nicht. Ich fürchte, er schnappt über. Sicher ist er jeder Wahnsinnstat jetzt fähig. Bolz und Kutscha, der bärtige Maler aus Ascona, der seit kurzem hier ist, betreuen ihn.
Die zweite Tragödie betrifft Adi Douglas-André. Dem armen Jungen wird vorgeworfen, er habe mit einem 8jährigen Mädel Geschichten gemacht. Er soll sie eingesperrt, ihr Röcke und Hemdchen hochgehoben und sie angefaßt haben. Ein Dienstmädchen behauptet es gesehn zu haben. Diese Sache vermittelte die neue Beziehung der Familie zu mir. Frau Douglas bat mich heute im Café an ihren Tisch, erzählte mir ungeheuer ausführlich die ganze Geschichte und ersuchte mich, mit dem Jungen zu sprechen. Ich tat das heut nachmittag so vorsichtig wie möglich. Er wird gemerkt haben, was ich meinte: lügen – unter allen Umständen fest bleiben im Lügen. Dann ist ihm nichts zu beweisen. Ich bin natürlich überzeugt, daß die Sache doch stimmt. Der Bengel ist bald 14 Jahre alt, da sehe ich in harmlosen kleinen Versuchen nichts Erschreckliches. Wir freundeten uns wieder sehr an und spielten Schach und Billard miteinander. Ein entzückender Bube. Hoffentlich kommt er mit einem blauen Auge aus der Affäre.
Zum Abendbrot war heut Emmy bei mir. Nachher natürlich das übliche Dessert. Sie ist prachtvoll sinnlich und liebt mich aufrichtig. – Morgen erwarte ich die Stöckl zum Essen. Ob ich sie nach der 5jährigen Pause ins Bett werde nehmen dürfen? Ich brenne auf diese Sensation. Sie ist ein netter, hübscher Kerl und eines der gescheitesten Weiber, die mir noch in die Quere gekommen sind.
München, Montag, d. 30. Oktober 1911.
Heut habe ich seit Jahren zum ersten Mal wieder eine Novelle geschrieben, und zwar bin ich nicht von selbst darauf gekommen, sondern durch Zufall. Bei der letzten Redaktionssitzung des „Komet“ wurde darüber gejammert, daß für die Studentennummer, die vorbereitet wird, kein Prosabeitrag da sei. Ludwig Bauer habe einen versprochen, sich aber nichts mehr merken lassen. Ich erklärte aus einer plötzlichen Laune heraus, daß ich etwas schreiben wolle. Mir fiel ein, wie vor ein paar Jahren in Zürich großer Jubel war, als der zehntausendste Student immatrikuliert wurde. Daraus habe ich nun eine amüsante kleine Skizze gemacht: „Tetje Sörens bezieht die Universität“. Ich bin neugierig, wie sich das Ding gedruckt ausnehmen wird, und wieviel Honorar ich kriege. Bis jetzt habe ich fast garkeine Novellen drucken lassen. Ich erinnere mich nur an eine humoristische „Das Lebensprogramm“, das vor 9 Jahren in der „Fröhlichen Kunst“ erschien, und an eine sentimentale Skizze „Grete“, mit der ich mich an Margarete Beutlers Schreibfaulheit rächen wollte, und die um dieselbe Zeit herum in der „Freistatt“ stand. Jetzt werde ich „Carmen“ im Kain-Kalender drucken. Die übrigen Sachen: „Erinnerungen“, eine Novelle etwa aus dem Jahre 1903, hat mir Roda Roda mal verbummelt, als er sie abtippen ließ; „der Strichjunge“ (etwa 1904) wurde einmal von Hanns Heinz Ewers im Wissenschaftlich-humanitären Komitee vorgelesen; das Manuskript muß noch in einem meiner Koffer liegen, ebenso die von „In Vertretung“ und „Ein Ehrenhandel“, die beide aus der besten Frieda-Zeit stammen, und deren zweite ich damals Frieda in die Feder diktierte. – Ich glaube kaum, daß ich auf dem Gebiete der Erzählung je Hervorragendes leisten werde. Zu einem Roman werde ich mich wohl nie im Leben konzentrieren können.
Erotisch geht’s mir seltsam. Die Stöckl versetzte mich Sonntag. Das Puma kam statt dessen auf telefonischen Anruf, hatte aber – bis heute – „die G’schicht’“. Nun telefonierte ich die Stöckl gestern abend an und sie bat mich, heut zu Benz zu kommen, sie werde dann mit mir schlafen gehn. Das erzählte ich Lotte. Heute machte ich nun wieder mit dem Puma allerlei Einkäufe. Unterwegs erklärte sie mir, sie möchte morgen mittag zu mir kommen zu einem Piacere. Sie müsse dazu aber die Bedingung stellen, daß ich heute nicht mit der Stöckl schlafe. Nun ist mir gewiß ein Kuß vom Puma lieber als eine Nacht mit irgendwem sonst, und ich versprach ihr sofort, die Bedingung zu erfüllen, ungeheuer erfreut, Spuren von Eifersucht bei ihr zu finden. Ein so großer Feind von Eifersucht ich bin: richtet sie sich gegen mich, so macht sie mich stolz und glücklich, und schließlich denke ich mir, ist ja auch nur da Eifersucht vorhanden, wo irgendwas von Liebe da ist. Das bestreitet zwar das Puma, und behauptet, es mache ihr blos Spaß, mir Opfer aufzuerlegen, ehe sie zu mir ins Bett kommt. Im Grunde habe sie gegen Freuden, die ich mit der Stöckl habe, garnichts. Da nun die Stöckl morgen abreisen will (sie kommt im Januar wieder), war ich etwas in Verlegenheit, wie ich mich entschuldigen soll, und überlegte schon, ob ich nicht gegen 2 Uhr Müdigkeit vorschützen und dann doch noch zu Benz fahren solle, also Lotte mal regelrecht betrügen sollte: das wäre ein neuer Reiz für mich gewesen. Nun bin ich aber aus aller Not. Als ich eben heimkam, fand ich ein Telegramm von der Stöckl: „Leider heute vergeben, Julchen“. Dieses Telegramm werde ich vor dem Puma verheimlichen. Sie soll glauben, ich brächte ihr freiwillig das Opfer, auf die Stöckl zu verzichten.
Consul war heut früh bei mir, wir küßten uns heftig. Als ich ihr erzählte, daß ich in ihre Schwester sehr verliebt sei, meinte sie, sie glaube, daß ich auch Muscha sehr gut gefalle. Wer weiß, ob daraus nicht noch etwas wird?
Ich habe höllisch zu arbeiten. Der Kalender muß im Laufe der Woche fertig werden. Der Verlag Paul Cassirer will Beiträge von mir zu einer modernen Balladen-Anthologie. Der „Komet“ beansprucht viel Arbeit von mir; die gesamten Korrekturen der achten Kain-Nummer stehn noch bevor, und Roda Roda fragte mich neulich auf der Kegelbahn, ob ich nicht mal mit ihm ein Stück schreiben möchte. – Übrigens soll ich dem Dr. Brecher, dem Dramaturgen des Volkstheaters meine „Hochstapler“ einsenden. Ich werde Müller dazu auffordern. Das wäre spaßig, wenn das alte Zeug doch noch auf die Bühne käme.
Gleich muß ich fort ins Kleine Theater. Morgen bin ich gottseidank damit fertig. Es greift doch an die Nerven.
München, Dienstag, d. 31. Oktober 1911.
Vor einer Reihe von Monaten verkaufte ich für 12 Mk diverse Briefe von Dehmel, Wedekind, Scheerbart u. s. w. an den russischen Gauner Glasberg. Jetzt erfahre ich durch den kleinen Hörschelmann folgendes: Glasberg hat hier irgendwen um eine große Summe betrogen und ist ausgekniffen. Die Briefe hat er für 20 Mk an einen Händler verramscht, mit dem Hörschelmann wegen Ankaufs unterhandelte. Hätte Hörschelmann die Sachen nicht entdeckt, so hätte der Mann sie in einem Katalog angezeigt, und ich hätte mir wahrscheinlich große Ungelegenheiten zugezogen, da Dehmel und Wedekind sehr empfindliche Leute sind. Der kleine Hörschelmann hat es nun freundlich übernommen, die Sache einzurenken und hat den Händler überredet, mir den ganzen Kram zum eignen Preise zur Verfügung zu stellen. So sehr mich die 20 Mk schmerzen werden, so werde ich es natürlich doch tun, zumal der sammelwütige Zwerg mir diesen Preis gewiß gern zahlen wird, und ich bei ihm sicher bin, daß mir weiter keine Unannehmlichkeiten drohen. Auch könnte ich bei ihm die Briefe immer einsehn, wenn ich sie brauchen sollte. Und an den Handschriften liegt mir nichts.
Jetzt erwarte ich das Puma zum Essen und zum Lieben. Nachmittags gehe ich mit dem Consul zu Heller (meine Küsse bekam ich schon), wo ich die „Frei-
München, Mittwoch, d. 1. November 1911
Während ich gestern schrieb, kam Lotte, aß bei mir und legte sich mit mir auf den Divan. – Ich begleitete sie dann noch ins Café, wo wir das Ehepaar Kutscha trafen, und dann holte ich Consul zu Heller ab. Leider war Gustav Waldau nicht da, so las ich das Stück nur Heller und Consul vor, die es schon kannte. Heller war zu meiner großen Freude sehr eingenommen von dem Werk. Er will es der Frau Direktor Stolberg zu lesen geben, und hofft, es auf diese Weise dem Schauspielhause andrehn zu können. Ich habe nicht viel Hoffnung. Auch der Herr Haas aus Cöln, der zwei Manuskripte hat, meldet sich trotz Mahnung nicht mehr. Ich habe mit dem Stück von jeher – es ist jetzt über zwei Jahre alt – die Erfahrung gemacht, daß es denen, auf die es mir ankommt, gefällt, und daß die, auf die es in der Praxis ankommt, es ablehnen. Das sind eben die Kutscher der Kultur – und wenn sie auch nur so heißen. – Nach der Vorlesung schenkte mir der Consul allerlei Kleinigkeiten, dann gingen wir ins Stefanie und fuhren darauf im Auto zur Bahn, da Rößler mit dem Orient-Express-Zug aus Wien ankam. Auf der Fahrt küßten wir uns lebhaft. Rößler muß den letzten Akt der „Fünf Frankfurter“ noch einmal umarbeiten. Er soll gegen die ersten beiden abfallen. – Nach meinem – gottseidank letzten – Auftreten im Kleinen Theater ging ich in die Vier Jahreszeiten-Bar, wohin mich Rößler zum Abendbrot eingeladen hatte. Wir aßen brillant und tranken Mumm. Rößler erzählte mir dabei etwas, was mich sehr bewegt. Er war vor Wien in Berlin, und dort traf er Ella Barth. Das arme Mädel hat immer noch kein Engagement, und es geht ihr schlecht. Rößler fragte sie nach Bubi Wolff, und sie sagte ihm, der sei abgesetzt. Aber wenn ich jetzt im November nach Berlin komme, dann hätte ich alle Chancen bei ihr. Jetzt ist auch der letzte Zweifel, ob ich zu dem „Familientag“ fahren soll, behoben. Ella! Ich glaube, ich liebe dich wirklich!
Während dieser Schreiberei störte mich ein angeblicher „Journalist“, der 1 Mk 50 Pf kostete. Kein Tag vergeht jetzt ohne solchen Kerl –, und während er noch da war, ließ sich eine Dame anmelden. Es war Muschi Diekmann, die Schwester des Consuls. Bis jetzt war sie bei mir. Etwas so zerbrechliches, dünnes, rührend schattenhaftes habe ich noch nie gesehn. Gegen diese Frau verschwindet Uli mit all ihrer Schlankheit völlig. Ihre Arme sind skeletthaft mager, die Hüftknochen ragen weit aus dem Kleide heraus. Natürlich blieb es nicht bei bloßen Gesprächen. Das liebe Mädchen ließ sich willig küssen, und mir scheint, daß diesem schönen Mund das Küssen keine ganz ungewohnte Beschäftigung ist. Sie will sehr bald wiederkommen.
München, Donnerstag, d. 2. November 1911.
Die Monatsrechnung ist wieder furchtbar hoch ausgefallen: über 190 Mark. Dabei ist das Geld aus Berlin noch nicht angekommen (die fälligen 450 Mk von Eckert natürlich erst recht nicht). Von Johannes keine Nachricht, sodaß ich nicht weiß, ob ich ihm sein Geld noch in die Mariahilferstrasse schicken soll oder woanders, denn er schrieb mir, die Wirtin habe zum Ersten gekündigt. Ich bin recht verstimmt, denn ich sehe für den November allerlei arge Schwierigkeiten entstehn. Und die täglichen Besucher legen mir eine Steuer auf, die ich kaum noch tragen kann. Fände ich nur die Form, wie ich sie mir ohne brutal zu werden, vom Halse schaffen kann.
Gestern lernte ich im Stefanie durch Robert Eyssler den Dr. Ludwig Bauer aus Wien kennen, den Wiener Korrespondenten der Münchn. Neuesten Nachrichten und Mitarbeiter am „Kometen“. Heut abend soll ich ins Lustspielhaus (der Consul kommt mit), wo von ihm der „Königstrust“, eine „Operette ohne Musik“ aufgeführt wird. Der Schauspieler Götz, ein recht sympathisches Mitglied des Lustspielhauses, reicht für mich ein. Dr. Bauer mißfällt mir persönlich ebenso wie der Schriftsteller. Er hat ein Organ wie eine kaputte Kindertrompete und redet in prätentiöser Art dummes Zeug. Er und Eyssler fuhren über Harden her so pöbelhaft und einsichtslos, wie man es von jedem letzten Banausen zu hören gewöhnt ist. – Nachher kam Lotte ins Café mit dem unmöglichen Maler, Rinaldo, der auch einmal Levy geheißen haben dürfte. Der Mensch ist ein Samumist (ich glaube, das Wort stammt von Bahr und bedeutet einen Menschen, der wie ein erstickender Wüstenwind auf die Stimmung der übrigen wirkt. Strindbergs Samum gab Anlaß zu der Neubildung). Man hat aber so Leute, die zufällig in die Gesellschaft gerieten und nicht wieder hinausfinden. Man selbst entschließt sich natürlich nie, sie nachhaltig zu amputieren: Der Sörgel ist so einer, und jetzt neuerdings der Slowake Negoschanes. Stinkende Kletten, unbenervte Nervengänger. Lotte und ich verließen selbander melancholisch das Caféhaus und trennten uns am Siegestor. An der Haustür traf ich Rößler und ging mit ihm hinauf. Wir spielten Écarté. Ich gewann etwas. Dann kam der Consul und deren Mutter, die sehr jammerte. Sie hat mit dem Tode ihres Mannes, der Consul in Rangun (Indien) war, das ganze Vermögen verloren, und es geht ihr sehr schlecht. Nachher kam noch Muschi, die entzückend aussah. – Ich ärgere mich über Rößler, weil er, seit er Consul so eifersüchtig bewacht, geringschätzig von Lotte spricht. Ich will ihn heut oder morgen zur Rede stellen.
Abends ging ich kegeln: Halbe, Wilm, Schmitz, Scharf, Körting und v. Jacobi. Von da aus wir alle – außer Schmitz – in den „Bunten Vogel“ in der Barerstrasse, wo ich auch schon mit Lotte und Strich gewesen bin. Dort gab es an verschiedenen Tischen Krach. Von einem Tisch hinter uns wurde ich angepöbelt, und schließlich sogar mit Wein bespritzt, von dem ein Spritzer auch Halbe traf. Der Rüpel entschuldigte sich, sodaß die Sache beigelegt wurde. Die Krachstimmung setzte sich bei mir in so aufgeregten Träumen fort, daß ich heute sehr übellaunig herumlaufe. Zum Glück kam Consul vorhin herein, und deren sehr zärtliche Küsse besänftigten mein Gemüt einigermaßen.
Der neue „Pan“ kam an, in dem Kerr seine unmöglichen Angriffe gegen Harden fortsetzt. Der ist einmal in einem kleinen Nordseebad beobachtet worden, wie er bei offenem Fenster in einem Parterre-Zimmer einer Hure, die er sich von Berlin mitgenommen haben soll, Minett machte. Da die eingebornen Bauern sich darüber entrüsteten, bot ihm Paul Cassirer, der zugleich in dem Badeort war, seine Wohnung zu derartigen Zwecken an. Cassirer hat die Geschichte überall herumerzählt (ich kenne sie seit Monaten durch Heinr. Mann). Wedekind wußte auch davon, und nun beschimpft Kerr seit 2 Monaten Harden in jeder „Pan“-Nummer deswegen. „Kleine Unappetitlichkeiten perverser Schwäche“. Saudumm und hundsgemein! Kerr hat wohl nie einem Mädel Minett gemacht? Ich leugne nicht, daß ich es sehr gern tue. Denn der höchste sexuelle Genuß liegt in der Beobachtung des Genusses, den die Partnerin von unsern Bemühungen hat, und die Frauen spüren nun einmal da unten am liebsten die Zunge der Männer (die übrigens auch selbst ein sehr empfindsames Geschlechtsorgan ist). – Hoffentlich ist Harden gescheit genug, sich durch die Schweinerei Kerrs nicht kompromittiert zu fühlen. Ein Vergleich des Verhaltens Kerrs mit dem Hardens (Kerr beruft sich natürlich auf die Priorität Hardens, gegen den daher jede Rücksicht falle) ist ganz verfehlt. Harden hatte ganz verdeckte Andeutungen gegen Eulenburg und Genossen gemacht, hatte sie in ausgesprochen politischem Interesse gemacht und hatte sie durchaus ohne moralischen Vorwurf gemacht. Kerr ist ganz deutlich und zeigt sich moralisch entrüstet. Er macht sich dadurch lächerlich und unter gesitteten Menschen unmöglich. Ich werde wohl im „Kain“ diese ganzen Literaturgezänke ignorieren. Sie sind zu widerlich.
Zugleich kam die neue „Sozialist“-Nummer mit einem Artikel von Johannes „Der junge Baader“, eine sehr feine und gescheite Studie. Hoffentlich hat Landauer erst die Genehmigung von Johannes eingeholt (den Artikel hatte er seit vielen Monaten liegen). Sonst wären neue Unzuträglichkeiten zu befürchten.
Außerdem schickt Schustermann zwei neue Ausschnitte aus dem „Kleinen Journal“ und der „Staatsbürgerzeitung“, die sich mit dem Mühsamschen Familientage beschäftigen. Daß sich die Blätter über die Geschichte lustig machen, finde ich ganz in der Ordnung. Daß sie sie aber parvenühaft finden und mit dem Verhalten der jüdischen Hochfinanz zur Aristokratie, wie es im Prozeß Wolf-Metternich zutage getreten ist, in Parallele stellen, scheint mir psychologisch falsch zu sein. Die ganze Geschichte ist eine echt mühsamsche Verschrobenheit, sonst nichts. Natürlich werde ich in den Notizen besonders erwähnt als „Edelanarchist“. Die „Staatsbürgerzeitung“ findet es besonders amüsant, davon zu träumen, wie der Anarchist und der Zionist Mühsam „brüderlich vereint“ an dem Familientage teilnehmen werden. Daß wir in der Tat Brüder sind, ahnt sie natürlich nicht. Mir ist natürlich die ganze Mittuerei der Presse nicht angenehm, und wenn Ella Barth nicht wäre, möchte ich auf die Teilnahme ganz gern verzichten. Aber schließlich: Konzessionen mache ich nicht. Was ich tue, kann ich vor mir selbst vertreten. Mögen die Schmöcke reden was sie wollen. Mich zu kompromittieren – d. h. mich als korrupt zu demonstrieren –, das wird ihnen nicht gelingen. Lachen mag über mich, wer nichts bessres zu tun hat.
München, Freitag, d. 3. November 1911.
Gestern war ich nach langer Pause wieder im Theater: Ludwig Bauer, „der Königstrust“, Operette ohne Musik im Lustspielhaus. Er hätte das Zeug „Shawspiel ohne hinreichendes Talent“ nennen sollen. Der erste Akt war nett in der Idee: es wird für eine Milliardärstochter ein König als Mann gesucht, und zwar ein Prätendent. Gute Aperçus, die brillante Figur des polnischen Juden Seligmann, der „der Herr der Welt“ heißt wegen seines unermeßlichen Geldes, guter Dialog, witzige teils, teils geschmacklose Erfindung. Ein ausgezeichneter Witz: ein Journalist – natürlich größten Stils, zugleich Schmock und Sherlock Holmes – zieht den Vorhang von einem Bild in der Wohnung des Krösus, darunter hängt die gestohlene Mona Lisa. Der zweite Akt schwach: im Kriegszelt des türkischen Befehlshabers, der im Kampfe liegt mit dem vom Trust finanzierten Prätendenten. Dritter Akt: ganz dumm, abgeschmackt, talentlos. Blöde Sentimentalitäten, völlig lendenlahmer Witz. Erfolg mau. Aufführung leidlich. Sidonie Lorm als zu verehelichende Dollarprinzessin war nicht hervorragend, Alva, der als naiver König sich selbst spielte, kam seine absolute Talentlosigkeit sehr zustatten. Er war recht gut in seiner tolpatschigen Naivetät, auf die er immer angewiesen ist. Ausgezeichnet war Götz als Seligmann – übrigens eine famose Figur in dem minderen Stück. Alle andern mäßig und weniger als mäßig. Die Regie ganz passabel. – Während der Pause traf ich Reese, der jetzt Lektor in der Theaterabteilung des Müllerschen Verlages ist. Rößler empfahl ihm meine „Freivermählten“, und er bat mich, sie ihm einzureichen. Da er außerdem in enger Beziehung zum Lustspielhaus steht, wird er sie vielleicht dort anbringen können, ohne daß ich den Canossagang zu tun brauche. Nach der Aufführung bei der Theatergarderobe entstand eine peinliche Szene mit Rößler. Ich war mit dem Consul im Theater, Lotte und Strich saßen zwei Reihen hinter uns, Rößler kam nachher und setzte sich in die erste Reihe. Wir hatten mit Lotte und Strich verabredet, daß wir zusammen ins Torggelhaus gehn wollten. Rößler dagegen wollte Consul in die Vier Jahreszeiten Bar mithaben, wo er mit Bauer und Steinrück verabredet war. Auch mich forderte er auf mitzukommen. Ich erklärte aber, ich wolle die Verabredung mit Lotte innehalten und bat ihn, auch Consul dazu freizugeben. Er meinte darauf, er sehe es nicht gern, daß Consul und Lotte zusammenkämen. Consul passe nicht in das Hurenmilieu mit Emmy etc. – Ich verbat mir energisch jede Beleidigung Lottes und verlangte, er habe sich respektvoll über sie zu äußern. Er packte Consul, die sich sträubte, in eine Droschke und fuhr mit ihr davon. Ich hatte mich furchtbar aufgeregt und ging mit Lotte und Strich in die Torggelstube, wo ich so dumm war, Consuls Fernbleiben wahrheitsgemäß zu erklären. Die arme Lotte, die wirklich ganz durch ihre Künstlerschaft und ihre persönlichen Werte geworden ist was sie ist, war tief gekränkt und weinte. Es war ein vermiester Abend. Heut früh ging ich hinauf und stellte Rößler noch einmal zur Rede. Jetzt benahm er sich sehr nett, gab zu durch den Consul hysterisch geworden zu sein und lud Lotte und Strich zu heut abend mit mir zum Abendbrot zu sich ein in einem liebenswürdigen sympathischen Brief: „Menu: Toter Vogel mit Beilage“. Ich habe die Geschichte mit dem Puma, das mittags bei mir aß, und nachmittags auch mit Strich, der natürlich von Rößlers Kennerschaft des Lotteschen außerehelichen Lebens nichts ahnen und deshalb keinesfalls mit Rößler in Krach kommen darf, eingerenkt, und jetzt erwarte.
München, Sonnabend, d. 4. November 1911.
Jetzt erwarte ich Lotte – wollte ich schreiben, da trat sie ein. Auch Strich kam und es war sehr nett oben, zumal Rößler erst nach 9 Uhr von einem Poker kam und ich inzwischen, während Strich und Lotte schön miteinander taten, den Consul hinlänglich küssen konnte. Wir pokerten, erst ohne, dann mit Rößler, und ich gewann – bei nur 40 Pf Limit – 40 Mk, von denen ich allerdings nur etwa 10 Mk ausgezahlt bekam. Das übrige wurde von meinen Schulden bei Rößler abgezogen, die sich nun auf 33 verringern. Wir gingen dann noch – Lotte, Strich und ich – ins Stefanie, dort hatte das Puma leider solche Kopfschmerzen, daß sie weinte und Strich noch Nachts einen Apotheker wegen Pyramidon herausklingeln mußte. Sie gingen bald, und ich blieb in der Gesellschaft des Dr. Bauer, der ein Trottel ist, Eysslers (eines Kitschiers) und Alwas, eines naiven Homerichs, zurück. Mit Bauer und Alwa endlich noch zu Kati Kobus. Heut nachmittag war Steiner bei mir, um die 6 Mk 30 einzukassieren, die ich ihm seit langem schuldete. Die Operation war schmerzlich, aber jetzt bin ich froh, das Geld los zu sein. Ich bin nicht gern Leuten etwas schuldig, die das Geld selbst nötig brauchen.
Gestern hatte ich von Steinebach einen sehr schmerzlichen Brief bekommen: Das Konto „Kain-Verlag“ weise einen Saldo von Mk 613.71 auf. Er wolle diese Nummer noch herausbringen, könne aber weitere nur dann drucken, wenn von irgend einer Seite aus für die Zukunft größere Zuschüsse geleistet werden. – Heut kam außerdem ein längerer Brief von Hans, in dem er seine und meiner andern Geschwister Ablehnung begründet, mit den Argumenten, die ich vorausgesehn hatte: selbst keine reichen Leute, unsicheres Geschäft, seinen Bekannten gefalle das Blatt nicht u. s. w. u. s. w. Natürlich auch noch allerlei schöne Winke, wie ich es besser machen könnte. Nun war ich heut bei Steinebach. Wir einigten uns dahin, daß er eine ganz geschäftsmännnische Kalkulation aufstellen soll über die Wahrscheinlichkeit der Rentabilität, die ich in Berlin meinen Geschwistern vorlegen werde. Sollten sie auf ihrer Ablehnung beharren, und ich das Geld auch sonst von keiner Seite kriegen, so habe ich monatlich 80 Mk einzuzahlen. So wird es wohl kommen, und ich weiß nicht, ob ich die Pension nicht werde kündigen müssen, um es leisten zu können. Wird aus dem Kontrakt mit dem „Komet“ nichts, dann bin ich ganz aufgeschmissen. Ich bin traurig und wütend. Den Kalender wollte Steinebach schon garnicht mehr herausbringen. Erst als ich ihm versprach, ihm dafür und für das gesamte übrige Saldo einen Schuldschein auszustellen, gab er nach. – Jetzt will ich an Ella Barth schreiben, um in bessere Laune zu kommen.
München, Sonntag, d. 5. November 1911.
In der Torggelstube teilte mir Weigert, der von Cöln kam, mit, das Deutsche Theater dort (P. Haas) habe meine „Freivermählten“ spielen wollen, jedoch habe die Zensur die Aufführung verboten und es bestehe keine Hoffnung, daß sie sie noch freigeben sollte. Auf Weigert ist kein unbedingter Verlaß. Da ich aber zufällig gestern grad an Haas geschrieben hatte, er möchte mir das Manuskript zurücksenden, hoffe ich, authentische Aufklärung zu erhalten. Stimmt die Geschichte, so möchte ich die Tatsache, daß das Stück angenommen war, doch publizieren. Vielleicht fördert das die Annahme zum Druck oder zu einer Vereinsvorstellung.
Nachher kam Tilly Waldegg vom Neuen Schauspielhaus, Berlin, an den Tisch mit Burg und einem andern ihrer Kollegen vom gleichen Theater, die jetzt im Volkstheater mit dem „Leibgardist“ von Molnar gastieren. Ich gehe morgen mit dem Puma hinein.
Von Hans eine Postkarte. Papa läßt mir sagen, ich solle erst im letzten Augenblick zum Familientag abreisen, da Onkel Marcus sehr schwer krank sei, und Papas Teilnahme daher in Frage gestellt sei. Kommt er nicht, so solle ich auch fernbleiben. Nun habe ich aber gestern an Ella geschrieben, sie möge mich am neunten schon erwarten, und da ich sicher glaube, dieses Mal von ihr alles Herrlichste zu erreichen, will ich auf die Reise nicht verzichten. Deshalb schrieb ich gleich an Hans, ich hätte in Berlin sehr dringliche Geschäfte und müsse schon früher dortsein. Sollte Papa nicht zum Familientag dort sein, so würde ich, auch wenn ich in Berlin bin, ebenfalls nicht daran teilnehmen. Warum der Alte mich nur dort wissen will, wenn er selbst dabei ist, ist einigermaßen unklar: Ob er das versprochene Reisegeld sparen will? Oder fürchtet er Attacken auf mich, vor denen er mich bewahren möchte? „Kompromittiert“ wird er durch mich dort auch, wenn er zugegen ist. Abwarten.
Von Johannes ein trauriger Brief aus Wien. Es geht ihm sehr schlecht. Ich werde mich mit Wolfskehl in Verbindung setzen, damit er endlich aus dieser unwürdigen Not herauskommt.
München, Montag, d. 6. November 1911
Gestern ist der Consul nach Berlin gefahren. Rößler, Muschi und ich brachten sie zur Bahn. Im Auto knutschte Rößler mit dem Consul, während ich mich an Muschi schadlos hielt. In ihrem Coupé konnte Consul dann auch mir, von Rößler unbemerkt einen schönen Kuß geben. Muschi ist etwas unglaublich Rührendes. Sie wiegt mit ihren 20 Jahren nur 78 Pfund. Heut will sie zu mir essen kommen, doch durfte ich nur Feigen vorbereiten. Das ist ihre ganze Nahrung. – Torggelstube: Basil, Weigert, Schaumberger, Muhr, Goldschmidt. Nachher kam noch Brecher (der Kerl macht seinem Namen Ehre – nur möchten alle andern brechen, wenn sie ihn sehn) mit dem Berliner Burg, der über den Werdegang der Steckelberg Interessantes erzählte. Sie war erst bei ihm Kindermädchen in Hamburg gewesen, ehe sie zur Bühne kam. Ihre Karriere dankt sie ihrer großen Schönheit (die auch schon dahin ist). Jetzt wird sie den Millionär Mannheimer heiraten. Daß sie sich ihrer Vergangenheit schämt, ist sehr lächerlich von der Frau. Aber sie tut’s und behauptet, von einer gräflich Steckelbergschen Familie im Harz abzustammen. – Muhr berichtete mir von dem Beginn einer Liaison mit einer Ringkämpferin. Der Tolpatsch hat sich von dem 17jährigen holländischen Bauerntrampel weiß machen lachen [weismachen lassen], sie sei noch Jungfrau, und er werde der Erste sein. Er hatte sie schon in seiner Wohnung, wo sie die erste Zigarette ihres Lebens rauchte. Natürlich verbrannte sie damit ihr sehr schäbiges Kleid. Muhr gab ihr 20 Mk zur Anzahlung an ein neues, und das Mädel kaufte sich außerdem einen Mantel und zahlte für beides nur 5 Mk an. Ich amüsierte mich herrlich über die Geschichte. Dieser Muhr ist ein unsagbarer Trottel in Eroticis. Morgen nachmittag will er die Dame im Café Orlando vorführen. – Später kamen noch Lotte und Strich in die Torggelstube, an die ich 4 Mk im Poker verlor. Jetzt habe ich noch 10 Mk. Ich bin in Sorgen wegen der Berlin Reise.
München, Dienstag, d. 7. November 1911.
Molnár: „Der Leibgardist“, Lustspiel in 3 Akten – Volkstheater. Ich war mit Lotte dort. Ein kolossal geschickt gemachtes Stück. Der Schauspieler, der seine Frau auf die Probe stellt, indem er selbst sie in der Verkleidung eines Leibgardisten verführt. Also ein Bravourstück für gute Darsteller. Sehr geschickter Dialog, unglaublich raffinierte Wirkungen – im ganzen: sehr amüsant. Der zweite Akt ist gefährlich: Abschweifungen ins Sentimentale, aber die ganze Szenerie: eine Loge in der Wiener Hofoper, Ausblick auf die gegenüberliegenden Logen, dazwischen aus dem Grammophon Caruso-Gesang im Hintergrunde retten die Situation, vor allem der glänzende Aktschluß: stürmischer Beifall hinter der Szene, der aufs Parkett ansteckend wirkt. Der Charakter der Frau, die Schauspielerin ist, brillant gezeichnet, und eine Figur, ein Kritiker, die Lotte spezielle Freude machte, weil er fast in demselben Verhältnis zur Frau steht, wie ich zu Lotte, der in alles eingeweihte Freund, zugleich Freund des Mannes, der selbst in die Dame verliebt ist und nicht allzuviel erreicht, worüber er sich selbst lustig macht. Gespielt wurde ausgezeichnet von den Berliner Gästen des Neuen Schauspielhauses: Tilly Waldegg sah famos aus und nahm die schwierigsten Stellen leicht und einleuchtend. Besonders imponierte sie mir im (besten) dritten Akt, wo der Mann sich zu erkennen giebt und sie im Moment spielen muß, daß sie ihn vom ersten Moment an erkannt hätte. (Lotte flüsterte mir dabei zu: „Das hätte ich ebenso gemacht“.) Die Waldegg war keinen Moment outriert, und das war so gut, daß sie dieser koketten und doch sehr differenzierten Frau nichts von ihrer Differenziertheit nahm. Den Schauspieler machte Eugen Burg sehr gut. Abel hat die Rolle im Kleinen Theater kreiert, und ich kann mir vorstellen, daß der noch besser war. Aber Burgs Leistung war schon respektabel, seine Verwandlung vollkommen. Den Kritiker spielte Retzbach einwandfrei. Die vom Volkstheater selbst gestellten Kräfte waren bedeutungslos. Die Horvath als Kuppelmutter ganz nett, wenn auch der Gedanke, daß diese Rolle von Ilka Grüning gespielt worden ist, melancholisch stimmen konnte. Brecher spielte sich als mauschelnden Gläubiger selbst. Die Ausstattung war von Berlin mitgebracht und füglich hoch über dem Niveau des Volkstheaters. – Nachher Torggelstube. Brecher hatte mir sagen lassen, die ganze Theatergesellschaft gehe zu Benz und ich versprach nachzukommen. Als Strich zur Torggelstube kam, pumpte ich ihn um 10 Mk an, überließ ihm das Puma und rückte ab. Bei Benz traf ich Tilly Waldegg, Burg, Retzbach, Weigert, Brecher, Schaumberger und noch eine Dame, und es war recht nett. Dann noch in den Simplizissimus, wo erst Scharf vortrug und dann auch ich dazu vergewaltigt wurde. Es war sehr lange her, daß wir beide nicht mehr dort am gleichen Abend rezitiert hatten. Ich unterhielt mich gut mit der Waldegg, die, obwohl gewiß schon hoch in den Dreißigern, noch sehr reizvoll ist, vor allem eine sehr feine geschmackvolle Person mit schönen zarten Händen, die von ihrer übrigen Anlage zur Üppigkeit angenehm abstachen. Das Puma war mit Strich auch in den Simpl gekommen, und als meine Gesellschaft fort war, ging ich mit ihnen noch ins Stefanie, wo sie mir 2 Mk abpokerten.
Als ich mit dem Puma im Torggelhause saß, schaute plötzlich Peppi Kirchhof hinein und lief gleich wieder fort. Ich setzte ihr nach, aber sie beschimpfte mich und verschwand. Heut früh nun telefonierte sie mich an, sie möchte mich gern sehn. Ich bestellte sie zu 10 Uhr abends ins Stefanie (gleich muß ich hin, da es heut mit der Eintragung sehr spät geworden ist). Ich bin sehr neugierig.
Mit dem „Komet“ bin ich jetzt handelseinig. Ich kriege monatlich 200 Mk, wofür ich an den Redaktionssitzungen teilzunehmen, Witze und politische Verse und monatlich ein lyrisches Gedicht zu liefern habe. Weitere Beiträge werden extra bezahlt. Ein so gutes festes Gehalt habe ich noch nie dauernd gehabt (Cabarets rechne ich nicht). Jetzt kann ich die 80 Mk monatlich für den „Kain“ bezahlen, auch wenn die Berliner Reise die erhofften 3000 Mk nicht trägt.
Diese Reise ist jetzt gesichert. Denn 200 Mk für diesen Monat habe ich mir heute gleich auszahlen lassen. Schluck aus der Pulle.
Die Novembernummer des „Kain“ ist endlich auch erschienen.
Heut war ich mit Lotte bei der André-Douglas, seit dem Tod des Ohrfeigen-Gatten zum ersten Mal. Adi hat seinen 14ten Geburtstag. Ein süßer Bengel.
München, Mittwoch, d. 8. November 1911.
Das Pepperl (recte: Josephine Kirchhoff) scheint sich für mich zu einem Erlebnis auswachsen zu wollen. Sie kam also um 10 Uhr ins Stefanie, angeblich nur, weil sie mich sehn wollte und Sehnsucht hatte, überhaupt mit einem Menschen beisammen zu sein. Wir gingen in den „Simplizissimus“, wo ich Forster Riessling bringen ließ und sie mit einem Wiener Schnitzel bewirtete. Ihr war nicht wohl dort, und sie kam auf meine Bitte zu mir, aber nur unter der Bedingung, daß ich sie nicht anrühre. Ich versprach’s. Sie legte sich auf den Divan und es blieb bei zärtlichen Küssen. Dabei klagte sie sehr, daß sie so wenigen gefalle und daß sie sich bis zu Selbstmordideen unglücklich fühle. Ich fuhr sie dann per Auto zu ihrer endlos entfernten Wohnung in der Zanettistrasse (die Autotaxe hin und her kostete 5 Mk). Unterwegs war sie sehr lieb. Sie küßt außerordentlich schön. Für heute nacht versprach sie fest, bei mir zu schlafen. Sie wollte mich um 12 Uhr mittags antelefonieren. Jetzt ist es 2 Uhr, aber sie hat sich nicht gemeldet. Also scheine ich mir vorerst auch da trügerische Hoffnungen gemacht zu haben. Peppi ist nicht schön, aber sie hat prächtige dunkle Augen, einen sanften sinnlichen schmalen Mund und einen schönen Teint, dabei eine gut gewölbte weiße Stirn. Mit alledem und mit den vorstehenden Backenknochen und der Stupsnase erinnert sie mich sehr stark an Margarete Beutler in den Tagen, wo ich sie so unaussprechlich liebte. Bei Peppis Küssen bildete ich mir ein, die Beutler trüge nachträglich ihre Schuld ab, und zwar durch Peppis Mund und Peppis jugendliche Zärtlichkeit besser, als sie selbst es jetzt in ihren alten Tagen tun könnte. (Obwohl ich der Beutler auch heute noch nicht nein sagen würde). Zuhause machte ich (in der Nacht und heute früh) ein Gedicht, zu dem mich zweifellos Peppi inspiriert hatte, bei dem ich aber seltsamerweise wohl mehr an Ella Barth wie an Peppi dachte („An dem kleinen Himmel meiner Liebe –“). Wird das Mädel heut nacht zu mir kommen? Es wäre sehr schön. Morgen vormittag fahre ich (wenn nicht von Hans noch andre Weisung kommt) nach Berlin. Ella Barth werde ich telegrafisch benachrichtigen. Ob sie einmal in meinen Armen liegen wird? Daran liegt mir jetzt mehr als an allem andern. Ich habe das Mädel unsinnig gern, sie wäre vielleicht die einzige, die mir – noch lange nicht, aber vielleicht später einmal – über Frieda hinweghelfen könnte.
Mein Bedarf an täglichen Frauenküssen wurde heute schon durch Muschi gedeckt, die ich in Rößlers Zimmer vorfand, und mit der ich dann im Stefanie Kaffee trank. Sie ist doch etwas gar zu dünn und zerbrechlich. Ob ich Consul in Berlin sehn werde?
Eine überraschende Karte kam heut an. Von der Vallière. Sie hatte mir schon verschiedentlich Grüße durch andre ausrichten lassen. Jetzt schreibt sie mir einen direkt aus Frankfurt a/Main auf einer Postkarte mit ihrem ausgezeichneten Portrait. Sie sieht doch recht gut aus.
München, Donnerstag, d. 9. November 1911.
Vor der Abreise noch schnell ein paar Notizen. Zunächst die Feststellung, daß ich schon wieder eine unerhörte Dummheit gemacht habe, die mich leicht die ganze Reise hätte kosten können, und natürlich wieder mit dem verfluchten Kartenspiel. Ich saß mit Rößler im Stefanie. Da kam Gotthelf, und die beiden spielten Écarté. Ich wettete gegen Rößler und gewann zuerst etwa 3 Mark. Dann verlor ich, und um den Verlust, etwa 10 Mk wieder hereinzubringen, setzte ich 20. Ich verlor, setzte wieder 20, verlor und so ferner, bis mir Gotthelf selbst dringend riet, jetzt gegen ihn zu setzen, da Rößler in einer unübersehbaren Glückssträhne war. Ich tat’s, und prompt gewann Gotthelf. Als ich 120 Mk verloren hatte, setzte ich den ganzen Rest meines Geldes: 60 Mk – und verlor. So hatte ich 180 Mark verloren. Gotthelf und Rößler pumpten mir zusammen hundert, sodaß ich reisen kann. Aber 80 Mk bin ich in bar los und 100 Mk Schulden habe ich obendrein. Ich war natürlich sehr nervös, und wartete auf Peppi. Sie versetzte mich. So ging ich kegeln. Auf der Kegelbahn war ich wieder sehr guter Laune. – Nachher Simplizissimus. Dort interpellierte mich Halbe recht interessant. Ob ich es für ihn nützlich halte, daß er sein neues Stück, „der Ring der Gaukler“ zuerst hier am Hoftheater spielen lasse, und dann erst bei Reinhardt in Berlin. Ob ich wüßte, wie hier jetzt allgemein die Stimmung zu ihm sei, ob er noch große Feindschaften habe etc. Ich sagte ihm, daß ich nach dem Erfolge seines Romans und nach der guten Aufnahme der neuen Aufführungen von „Jugend“, „Strom“, und „Mutter Erde“ bestimmt glaube, daß die Stimmung ihm hier günstig sei, während in Berlin ja noch der Mißerfolg der letzten Premiere, der „Blauen Berge“ nachwirke. Auch glaube ich, daß er gefährliche Feindschaften hier kaum mehr habe. Die Kämpfe zwischen Neuem Verein und Dramatischer Gesellschaft sind infolge Ablebens der letzteren verstummt, und über die Ruederer-Freksa-Geschichte, die für diese Herren doch ein glatter Durchfall war, ist Gras gewachsen, umsomehr, als sich nach dem „Schmied von Kochel“ diese Partei doch nicht mehr zu laut machen darf. – Halbe war sehr beruhigt und ihm leuchteten meine Gründe ein. – Ich bin nun schon seit über 10 Jahren mitten unter diesen Literaten. Aber immer von neuem erstaune ich über die Kleinlichkeit, die Neidereien, die Kinderstubenhaftigkeit in diesen Kreisen. Haben denn solche Dinge wirklich mit dem Ewigen zu tun, auf das wir ausgehn?
Charlottenburg, Sonnabend, d. 17. November 1911
in der Nacht auf Sonntag, d. 18. November. Hotel Bismarck am Knie.
Die Nacht habe ich mir aussuchen müssen zum Schreiben, da ich am Tage doch nicht dazu gekommen wäre, sowenig, wie ich in den 10 Tagen meines Hierseins dazu gekommen bin, und da ich mir in München bei der Fülle der Arbeiten, die meiner harren, die Zeit zum Schreiben nicht nehmen möchte. Im Damensalon des Hotels sitze ich und es ist ½ 2 Uhr nachts. Zum Rekapitulieren alles dessen, was in dieser Zeit auf mich eingewirkt hat, fehlt es an Zeit und wohl auch an Gedächtnis. So mag, so gut es geht, der Reihenfolge des Geschehens nach das Wichtigste notiert werden. Manches werde ich wohl vergessen, manches vielleicht noch bei späterer Erinnerung nachtragen.
Also in der Nacht vom Donnerstag (d. 9ten) auf Freitag kurz vor 12 Uhr kam der Zug am Anhalter Bahnhof an, nach einer 11½stündigen, hinlänglich anstrengenden Fahrt, auf der ich Halbes „Insel der Seligen“ und von Wilhelm Schäfer einen Band Novellen „Anekdoten“ las. Das erste eine mißglückte Komödie, mit großen Schönheiten und großen Verschrobenheiten, das zweite altertümelnd-manierierte Feinheiten, für die ich wenig Nerven habe. – Ella Barth war nicht an der Bahn, – auch nachher nicht im Café des Westens. Ich war schwer enttäuscht und deprimiert. Erst Freitag mittag erreichte ich sie – oder war’s gar erst Sonnabend? – auf telefonischen Anruf und traf sie später abends im Café. Auf der Heimfahrt erhielt ich die einzigen Küsse von ihr, die sie mir bisher bei meinem jetzigen Berliner Aufenthalt gegeben hat. Meine Seligkeit über diese Küsse war groß. Ich schlug ihr vor, zu mir nach München zu kommen, mit mir dort ganz zu leben – und sie sagte zu. Wir haben das seitdem öfters besprochen, sehr ausführlich, – und ich bin jetzt sozusagen Bräutigam. Dann auch, daß unsre Gemeinschaft eine ganz intime sein wird, haben wir ausdrücklich beschlossen. Ich liebe Ella, das weiß ich jetzt; tue ich also, wonach es mich verlangt.
Ich sehe schon, daß ich chronologisch nicht werde rekapitulieren können. So mag es kommen, wie es sich gibt. Also am Freitag war ich auch bei Hans, wo ich Leo und Charlotte schon antraf, die zum Familientag gekommen waren. Am Sonnabend kam auch Papa. Ich war mit am Bahnhof. Er ist fabelhaft rüstig, und war im ganzen zu mir freundlicher als seit vielen Jahren. – Sonnabend abend war ich, um mir von dem Familienbetrieb Erholung zu schaffen, bei Schennis, wo ich auch Spela traf. Der alte Mann tat mir sehr wohl. Er wohnt jetzt in der Lessingstrasse, wo er fabelhaft eingerichtet ist. Ich mußte bei ihm Abendbrot essen, und er bereitete dabei eigenhändig eine unvergeßliche Fischmayonnaise. Sonntag war dann der Familientag. Er verlief weniger peinlich, als ich erwartet hatte. Von Bekannten traf ich dabei nur wenige, außer meinen Geschwistern den üblen Vetter Kurt, Laura Rosenthal und Mann, Kantorowicz und Frau, Paul Mühsam, Görlitz, und einen Herrn Max Mühsam, der mich schon verschiedentlich in Caféhäusern peinlich an unsre Namensvetterschaft erinnert hat. Ich lernte die übrige Mischboche hinlänglich kennen. Denn 93 Mühsams giebt es im ganzen nur, und 51 Personen waren anwesend. Bei der geschäftlichen Sitzung am Vormittag führte Papa durch 3½ Stunden den Vorsitz.
Verhandelt wurde nicht viel: blos Formalitäten, und charakteristisch ist, daß sich die lebhafteste Debatte daran knüpfte, ob der Familientag photographiert werden solle oder nicht. Etlichen Herrschaften waren die Zeitungsnotizen (die Herr Georg Bernhard, Plutus, auf dem Gewissen hat; seine Frau ist eine Mühsam) arg in die Nase gestiegen und sie fürchteten, natürlich wohl hauptsächlich meinetwegen erst recht kompromittiert zu werden, wenn da noch ein Gruppenbild entstände. So wurde hitzig pro und contra gekämpft. Ich brachte zum Schluß die Aufnahme dadurch zu Fall, daß ich erklärte, ein Bild sei wertlos, zu dem nicht alle, die drauf seien, gerne posierten. Es war das einzigemal, daß ich das Wort nahm. Zwischen der Geschäftssitzung und dem Diner sah ich mir, zur Erholung, einen Kientopp an. Das Essen nachher war sehr gut. Ich führte – im geliehenen Smoking – Frau Eva Kantorowicz zu Tisch. Man blieb bis gegen 2 Uhr nachts beisammen, und ich ging dann noch mit besagtem Max und einem Herrn Franz Mühsam ins Theatercafé d. Westens. – Im ganzen war ich von der Veranstaltung angenehm enttäuscht. Es waren ganz nette Menschen dabei. Auch interessierten mich die Physiognomien und ich konnte feststellen, daß die Mühsams durchweg einen intelligenten Typus darstellen. Merkwürdig ist, daß ein unverkennbarer Familienzug überall – auch, wo seit Generationen Rassenmischung erfolgt ist – erhalten ist. Übrigens stellte Frau Dr. Kantorowicz in Übereinstimmung mit mir fest, daß die Mitglieder aus Mischehen sämtlich gegen die andern minderwertig aussahen. (Gestern erfuhr ich, daß Ella Jüdin ist: die erste, die ich je geliebt habe. Wer weiß, ob wir nicht einmal legitime Nachkommen haben werden?)
Mit Papa hatte ich ein Gespräch über den „Kain“ – kurz vor seiner Abreise (am Dienstag). Er erklärte, nicht viel von den geschäftlichen Aussichten zu halten, forderte aber vom Drucker einen Überschlag ein und scheint eventuell geneigt, die nötigen 3000 Mk herzugeben. Dann könnte ich der Ehe mit Ella fast ohne materielle Angst entgegensehn. – Jedenfalls konnte ich noch nie so mit dem Alten sprechen.
Montag abend war ich im Deutschen Theater „Turandot“ in der Übersetzung und Bearbeitung von Vollmöller. Das beste war Ernst Sterns Dekoration. Fabelhaft: eine chinesische Ausstellung. Die Regie hatte das ganze Stück auf ausgelassenste Lustigkeit gestellt. Die Eysoldt war nicht so gut wie gewöhnlich. Dagegen Moissi außerordentlich. Die lustigen Figuren, besonders Wassermann und Biensfeld outrierten zur sehr, dagegen waren Diegelmann und Arnold vorzüglich. Auch das Moggerl war gut, viel besser als die Eibenschütz. Ach ja, das Moggerl, das hatte ich schon Freitag besucht. Ich fand sie, nicht etwa geknickt, wie ich erwartet hatte, sondern lustig und aller frohen Erwartungen voll. Auch Moissi kam noch zu ihr, mit dem sie jetzt ganz offen liiert ist, und wir drei gingen nachher selbander spazieren. Es war sehr nett.
Nun gleich die Theaterabende zu erwähnen. Dienstag war ich im Theater in der Königgrätzerstrasse und sah die „Schauspielerin“ von Heinrich Mann. Ich hatte das Stück schon in München gelesen, erinnere mich aber nicht, ob ich hier meinen Eindruck notiert hatte. Ihn kurz zu präzisieren: Es ist weniger ein Drama als eine Rolle. Eine psychologische Studie, gestaltet an einem Sardouschen Vorgang. Ganz moderne Menschentypen, sehr feine Beobachtungen, sehr krasse Wirkungen. Die Durieux, für die das Stück geschrieben scheint, spielte die Hauptrolle. Spielte sie phänomenal, hinreißend, unerhört. Nie gab sie soviel Herz in eine Rolle, und ihr Können fand Gelegenheit zur vollendeten Meisterschaft.
Heut war ich wieder im Theater. Es war im „Berliner Theater“ die Premiere der „Ahnengallerie“ von Stein und Heller. Heller hatte das Stück seinerzeit bei Basil vorgelesen. Ich schrieb hier schon darüber und fand meinen guten Eindruck bestätigt. Ein Riesenerfolg natürlich.
Um gleich alles zu melden, was in dies Gebiet gehört: Gestern war ich bei einem Vortrag von Maximilian Harden in den Kammersälen (Belle Alliance-Strasse). Er sprach über „Thronfolger und Staatsstützen“. Ich war mit Paul Cassirer und Ella Barth da. Hardens Vortrag dauerte über 2½ Stunden und war sehr klug und reichlich unsympathisch. Er sah aus wie eine Zirkusreiterin. Scheußliche weibische Posen. Mätzchen wie ein schlechter Cabaret-Conferenzier. Doch aber große Feinheiten, Klugheiten, Aggressivitäten. Ella war entzückt, ich etwas deprimiert.
Ella hat mich in dieser Zeit nicht immer sehr zärtlich behandelt. Sie versetzte mich etliche Male, wenn wir verabredet waren. Nachher wußte sie natürlich stets so einleuchtende Ausreden, daß jeder Vorwurf dumm gewesen wäre. Geküßt hat sie mich nur das eine Mal. Aber ich liebe sie, und das weiß sie und freut sich darüber. Ja, sie hat mich heut gebeten – als ich nach dem Theater mit ihr bei Kempinsky aß, die beiden Gedichte, die ich für sie gemacht habe, mit der Überschrift „An E. B.“ im „Kain“ zu drucken. Soll natürlich geschehn. Daß sie zu mir kommen und mit mir hausen will, ist ja alles, was meine kühnste Hoffnung wünschen könnte.
Consuela Diekmann sah ich nur einmal. Im Theater an der Königgrätzerstrasse. Rößler war bei ihr. Heut hörte ich von seinem Bruder, den ich im Berliner Theater traf, daß beide seit gestern wieder in München sind.
Geschäftlich hab ich das meiste verbummelt, was hier zu tun war. Bei Eckert war ich nicht wegen der 450 Mk für „Glaube, Liebe, Hoffnung“ und Leon Hirsch, der den „Krater“ hat und somit der Öffentlichkeit vorenthält, habe ich garnicht ermitteln können. Dagegen habe ich heute von Paul Cassirer 50 Mk Vorschuß bekommen. Dafür soll angeblich bei ihm ein Lyrikband von mir erscheinen. Wollens abwarten. Für die Anthologie, über die Hertzog mir seinerzeit schrieb, ließ ich eine Anzahl Gedichte dort. Die ganze Sache ist aber noch unsicher. Übrigens muß ich über Hertzog mein Urteil revidieren. Er scheint mir wirklich gewogen zu sein, auch behauptet Hardekopf, den ich traf, er habe nie gegen mich intrigiert. Mir wär’s schon lieb, ich hätte endlich einen Gedichtband, den jeder ohne Schwierigkeiten im Buchhandel bekommen kann.
Besuche machte ich noch bei Frau Kornfeld, die mir meine Gedichte so vortrug, daß ich merkte, daß sie gut sind, und bei Onkel Leopold. Landauer besuchte ich nicht, ich sah ihn heute flüchtig im Theater. Zufällig war ich außerdem gestern in der Privatwohnung von Cassirer und der Durieux, da ich Ella von dort zum Harden-Vortrag abholen sollte. Frau Tilla war leider schon fort, aber ich sah die fabelhafte Pracht der von Walser besorgten Einrichtung.
Wen sah ich sonst noch Bekanntes? Paul Lindau, Schalom Asch, Lotte Fröhlich-Parsenow nebst Gatten, Max Fröhlich, Hubert, Manasse, der sich, wie er mir berichtete, von seiner Frau, meiner Hedwig Neufeld, getrennt hat, Dr. Haas, Wegener, Tiedke, Otto Gebühr und Frau, Alexander Eckardt (ein verrückter Schennis-Abend im C. d. W.), Felix Poppenberg, Hollaender, Wassmann, Kurtz, Brann, mit dem ich täglich Billard spielte, Bubi Wolf, der von Ella durchaus abgesetzt ist, Berneis, die Eysoldt – herrlich wie immer, die Wellhöhner, Ewers, Ottmar Begas, und mittags regelmäßig Frl. Anita Hummel, sehr hübsch, aber von dumm-koketter Spitzigkeit. Alfred Kerr begrüßte ich im Theater nur mit kühler Verbeugung. Ich nehme ihm die Attacken auf Harden übel und wollte deshalb keine freundschaftliche Nähe. Er ist übrigens aus dem „Pan“ heraus wegen der Sache. W. Fred ist engagiert an seiner Stelle. Die Onkels Harry Cohen und Moritz Freymann sprach ich im Caféhaus – und wohl noch viele andre sonst.
Für mich war diese Reise mehr als Wiedersehn von Bekannten und Verwandten, mehr als die günstige Begegnung mit dem Vater, mehr als geschäftlicher Segen und freundliche materielle Aussicht. Für mich war sie Vorsehung und wird – so hoffe ich – Schicksal sein. Denn, ich glaube, daß mein Schicksal fortab nicht mehr ohne den Namen Ella Barth möglich sein wird. Was ich nie erlebt habe, nie gekannt, nie nur hoffen konnte, das will Wirklichkeit werden: Vereinigung zu gemeinsamem Leben mit einem glühend geliebten, wild begehrten Weibe.
München, Montag, d. 20. November 1911.
Endlich wieder zuhause. Seit den letzten Eintragungen geschah wenig Wichtiges. Ich traf gestern mittag Fritz Kalischer mit Elsa Asch (noch immer zusammen). So erfuhr ich, daß vorgestern der Bruder Sigmund Kalischer gestorben sei. Wieder einer aus dem Hille-Kreis. Ein ganz kluger feiner Mensch, aber ohne rechten Halt in sich. Schon, als ich ihn im Sommer zuletzt war [gemeint ist: sah], erzählte seine Frau, die dicke Mecklenburgerin „Bess Brenk“, er sei viele Monate schon krank und von den Ärzten nahezu aufgegeben gewesen. Er war jünger als ich ... Um 5 Uhr war ich mit Ella im Café Kutschera (ehemals Sezession) verabredet. Sie kam pünktlich. Ihre Nähe beruhigte und erquickte mich, obwohl wir nicht viel sprachen und sie zumeist Zeitung las. Dann gingen wir Arm in Arm spazieren, nach Wilmersdorf zu. Um ½ 8 Uhr mußte sie zuhause sein, konnte mich also nicht zur Bahn begleiten. Auf diese Weise kam ich um meinen Abschiedskuß. Denn am erleuchteten Abend vor ihrer Haustür glaubte sie mich nicht küssen zu dürfen. Aber sie verlangte, daß ich sie vom Bahnhof aus noch antelefonieren müsse. Das tat ich, und um 8h 45 fuhr ich los, 10½ Stunden im Rüttelwagen dritter Klasse. Ich las von Rudolf Kassner „Motive“, Essays bei S. Fischer. Rößler hatte es mir auf die Reise mitgegeben. Ein sehr gutes, feines, geistvolles, nur etwas zu geistvolles Buch. Mich stört ein wenig der Unfehlbarkeitston. Aber ein ungemein gescheiter Kopf urteilt da über Kierkegaard (das ist der beste Abschnitt), Rodin, Hebbel, Browning u. s. w. (Ich muß schnell dran denken, meine Essays für den Dreililienverlag zusammenzustellen). – Jetzt eben aß ich – um 3 Uhr erst – Mittag, da ich solange schlief. Bis jetzt sah ich nur den Consul, zu dem ich hinaufging, und die mir die erhofften Küsse nicht schuldig blieb. Dann telefonierte ich Heller an und berichtete ihm über den Erfolg der „Ahnengallerie“. Er erzählte, daß er mit Frau Direktor Stolberg schon über mein Stück gesprochen habe. Sie wolle es lesen, und ich möchte ihm schnellstens ein Manuskript zustellen. Soll geschehen.
Von Berlin sind zwei Dinge nachzutragen, die mir noch einfallen. Eines Abends traf ich im Café d. Westens den jungen Werner Lotz, den hübschen Schauspieler, der wie der junge Beethoven aussieht und doch noch garkeine Züge hat. Er fiel mir fast um den Hals und riß mich an seinen Tisch, wo Herr Max Oppenheimer mit etlichen andern Fadianen versammelt saß. Lotz erzählte, er habe ein fabelhaftes Engagement nach England, wo er eine Pantomime aufführen solle. Er habe wöchentlich 300 ₤ dazu zur Verfügung: also 6000 Mark. Nun schrieb er sich die Adresse jedes Menschen, der ins Café kam auf und wollte jeden teuer engagieren. Ich nahm ihn, da ihn die Affen frozzelten an einen andern Tisch, wo es ihm nicht besser ging. Da saß Spela mit Baron, Lanz und etlichen andern. Der arme Junge, der zweifellos Größenideen hat, und dessen ganzes Gebaren stark nach Irrsinn aussah, tat mir leid, zumal das ironische Gespött der andern ihn in seine Rolle immer mehr hineinsteigerte. Schließlich veranlaßte ich ihn, um ihn zu beruhigen, mit mir fortzugehn. Natürlich deutete der ganze Tisch das als Einleitung zu einer sexuellen Verführung. Das lag mir aber fern, und ich redete draußen gut auf den armen Knaben ein. Er wurde dann auch ganz vernünftig und nun holte ich heraus, was eigentlich an der Geschichte wahr ist. Danach scheint mir, daß er wirklich so einen Kontrakt hat und daß diese Macht ihm in den Kopf gestiegen ist. Er wollte mich sogleich als Dramaturgen und zur Abfassung einer Pantomime bewegen. Ich sagte ihm zu, mit ihm nach England zu gehn, wenn er mir 1000 Mk monatlich und freie Reise hin und her, Eisenbahn II., Schiff I. Klasse garantierte. Auch sprach ich davon, daß Ella Barth mitgehn würde, wenn sie 800 Mk im Monat bekäme. Ich glaube zwar nicht, daß aus der Sache etwas wird. Aber gewöhnlich kommt ja wirklich nur bei den ausgefallensten Verrücktheiten etwas Greifbares heraus – und schön wärs, mit Ella nach England!
Zweitens: Bei meinem Besuch in Waidmannslust berichtete mir Onkel Leopold dieses – Papa habe ihm gesagt, es sei sein Herzenswunsch, noch zu erleben, daß ich mich verheirate. Er möchte auf den Zahn fühlen, wie ich mich dazu stelle. Onkel habe geantwortet, ich könnte doch bei meiner wirtschaftlichen Position garnicht ans Heiraten denken. Aber Papa hätte in Aussicht gestellt, daß er Zuschüsse leisten werde. Dann habe er seine Ansicht entwickelt. Er denkt sich das nämlich so, daß ich in eine Buchhandlung oder einen Verlag „hineinheirate“. – Also Tochter heiraten und Compagnon werden. – Der alte Mann hat keine Ahnung von mir. Er hält mich für irgend einen Commis, den man per Schadchen standesgemäß verheiraten kann. Ich antwortete dem Onkel. Wenn mir weder in bezug auf Religion, noch auf Beruf, noch auf Vorleben, noch auf Vermögen der Dame Bedingungen gestellt werden, und mir der Lebensunterhalt hinlänglich garantiert wird, so verpflichte ich mich, in weniger als 14 Tagen eine Frau zu haben. Bis dahin hielt ich Ella für katholisch. Am Tage drauf erst sagte sie mir, daß sie Jüdin ist. Allerdings Schauspielerin, allerdings Vergangenheit, aber wer weiß, ob der Alte nicht doch einverstanden wäre, da sie mich ja offenbar nehmen will.
Noch etwas: Wir mußten schon wieder mal alle zum Notar, um in dem Familienpakt die Bedingung zu beseitigen, daß die Ehefrauen kinderlos verstorbener A. Cohnscher Erben nur bis zur etwaigen neuen Verheiratung partizipieren sollen. Vorläufig hat das nur für Minna Geltung. Später vielleicht auch noch für Ella. – Daß die Unverkäuflichkeit und Unaufteilbarkeit der Masse bis 1935 verlängert würde (bis 1925 besteht die Bestimmung schon) wurde glücklich verhindert. Vorläufig soll erst mal Arthur großjährig werden und sich dem Kontrakt anschließen.
Am Tage, an dem diese notariellen Dinge erledigt wurden, gingen wir zu Hänse Hermann, wo Papa sich mit sämtlichen Kindern und Schwiegerkindern photographieren ließ. Das Bild wird wohl nächstens kommen.
H. H. Ewers läßt mir durch den Verlag Georg Müller 3 seiner Bücher zusenden: „Das Grauen. Seltsame Geschichten“, 1908. „Die Besessenen. Seltsame Geschichten“, 1909. „Der Zauberlehrling oder Die Teufelsjünger“, Roman, 1910. Natürlich hat er schon im Café mich zu bearbeiten gesucht, über das Zeug zu schreiben. Natürlich legt er mir auch noch einen besonderen Brief bei. Und natürlich stellt er schon ein weiteres Buch in nahe Aussicht. Erst lesen – dann ist es noch Zeit, das Schreiben zu unterlassen.
Ferner kam eine Broschüre an von Johannes R. Becher: „Der Ringende. Kleist-Hymne“, 1911 bei Heinrich F. S. Bachmair, Berlin.
München, Dienstag, d. 21. November 1911.
München ist, soweit es sich überhaupt noch aufregen kann, in großer Bewegung. Die Polizei hat ein Stück geleistet, das alles bisherige in den Schatten stellt. Im Lustspielhaus trat in der vorigen Woche eine junge Dame, ein Fräulein Vallida oder ähnlich – mit langem exotischem Namen – als Tänzerin auf und führte unter andrem, einem ausgesuchten geladenen Publikum, Nackttänze vor. Es soll wunderschön gewesen sein. Bei ihrem dritten Auftreten wurde sie plötzlich unter Wahrung aller chikanösen Polizeiniederträchtigkeiten, Isolierung u. s. w. von der Bühne weg verhaftet, und zugleich mit ihr Robert und der Impresario, dem das Theater für die Tage verpachtet war, zum Polizeipräsidium abgeführt. Ich erfuhr von der Geschichte gestern durch Meyrink, und da Hüsgen, der Oberinspektor des Lustspielhauses grade im Café war, um Protestunterschriften zu sammeln, fuhr ich mit ihm zu Dr. Robert hinunter. Auf der Direktion war große Entrüstung. Die Roland erzählte mir sehr aufgeregt und ausführlich den Vorgang. Ein Rechtsanwalt war da, der Impresario und Reese. Ich stellte Robert mein Blatt für Erklärungen zur Verfügung und versprach ihm, mich sehr energisch für ihn einzusetzen. Außerdem sprach ich ihm die Absicht aus, eine öffentliche Versammlung einzuberufen, in der ich das Referat über das Thema „Gegen die Polizeizensur“ sprechen würde. Von dieser Idee schienen die Anwesenden nicht sonderlich erbaut. Robert meinte, das sei schon von andrer Seite geplant, wobei er ekelhaft mauschelte. Ich werde aber wohl trotzdem etwas derartiges arrangieren, zumal ich heute zufällig von Krobshofer einen Brief erhielt, worin er mitteilt, daß er – sehr lieb, sehr nett – 90 Mark für eine Versammlung zusammengebracht habe. Ich denke mir jetzt als Thema: „Staat, Polizei und Abhilfe“ und als Saal vielleicht die Schwabinger Brauerei. – Jedenfalls ist es mir lieb, mit Robert in nähere Fühlung zu kommen, da ich ihm sobald wie möglich das Engagement von Ella Barth empfehlen will. Es fehlte zu meinem Glück ja nur, daß sie in München zu tun hat und so die Gefahr behoben ist, daß sie etwa nach ganz kurzer Zeit eines glücklichen Zusammenseins nach auswärts an eine Bühne engagiert wird. – Heut schreibe ich ihr noch und schicke ihr 20 Mk, da ich soeben für die Novelle im „Komet“ 77 Mk erhalten habe. Das war nötig. Denn nachdem ich gestern oben bei Rößler 5 Mk im Pokern gewonnen hatte, traf ich nachher in der Torggelstube das Puma mit den Strichen und einem Vetter von ihnen (an einem andern Tisch saß Gustel Waldau, Peppler, Halbe und noch etliche andre, die von einer – leider von mir versäumten Kleist-Feier im Schauspielhaus kamen, wo Wedekind gesprochen hatte) – und mit Puma, Strich, dem Slowaken Negoschann und dessen Landsmann Forel spielte ich dort weiter und verlor gegen 20 Mk, sodaß ich wieder ganz pleite war und Strich noch 10 Mk mehr schuldig bleiben muß, als ich ihm schon schuldig war. Das Puma war ganz entzückend. Sie hängte sich auf der Straße an meinen Arm und behandelte mich sehr lieb. Heut mittag speiste ich in Rößlers Zimmer mit dem Consul und Muschi, wobei ich die neue Sensation kostete, beide Schwestern vor einander zu küssen. – Heut war Redaktionssitzung des „Kometen“. Vorher war ich bei Steinebach, der nun an Papa den Brief wegen der 3000 Mk schicken wird. Er berichtete, daß die letzte Nummer infolge des Artikels gegen Kausen besonders gut gegangen sei. Hoffentlich – das ist jetzt mein innigster Wunsch – läßt Papa sich erweichen. Dann habe ich 80 MK monatlich übrig für die Einrichtung mit Ella. Ich denke, wir werden uns von Pfaffenzeller Möbel mieten, und ganz ungeniertes Konkubinat halten. Die Aussicht macht mich toll vor Glück. – Wenn nur nicht Friedas Rückkunft von Ascona, die ich eigentlich jeden Tag erwarte, alle meine Träume wachstört. Kommt diese fanatische Liebe wieder zum Brennen, dann garantiere ich nicht für mich, ob ich nicht auf alle Ellas und Lottes und Consuls verzichte, und weiterhin als unglücklich Liebender trostlos und einsam nach dem Glück irre.
München, Mittwoch, d. 22. November 1911.
Als ich gestern die Notizen des Tagebuchs vom vorigen Jahr durchsah – ich habe mich seit einiger Zeit daran gewöhnt, stets, wenn ich eingeschrieben habe, nachzulesen, was ich am gleichen Datum des Vorjahres erlebte, fand ich – denn nach Berlin hatte ich das alte Heft natürlich nicht mitgenommen, sodaß ich jetzt 12 Tage zurückzublättern hatte, – fand ich zu meinem Schrecken, daß ich diesesmal ganz den Jahrestag meiner Freundschaft mit Johannes vergessen hatte. Das ist mir in den acht Jahren wirklich zum ersten Mal passiert, und ich bitte es dem Freunde hier ab. Allerdings weiß ich auch garnichts von ihm. Er hat seit mehr als 14 Tagen nicht mehr an mich geschrieben, und was ich vorher hörte, waren bittere Klagen über sein materielles Ergehn. Ich wage kaum, ihm zu schreiben, da ich ihm nicht auch Geld schicken kann, denn dazu bin ich jetzt fest entschlossen: sowohl Johannes wie das Puma muß jetzt hinter Ella zurückstehn. Dem armen Mädel geht’s schlecht genug, und für sie soll jetzt alles sein, was übrig ist. Gestern schickte ich ihr 20 Mk, und die 50, die ich noch übrig habe, sollen bis zum 1ten – das sind noch 10 Tage – reichen. Da kann ich nicht mehr viel abgeben, zumal ich Lotte sowieso noch 5 Mk schulde (sie mir allerdings ein Piacere). – Es ist Abendbrotzeit und ich will abbrechen, da ich zu Rößler hinaufwill. Ich habe von den Inderinnen heute noch nicht die obligaten Küsse gekriegt. – Von jetzt ab wird’s mir hoffentlich in der Erotik wieder etwas besser gedeihen. Zu morgen Mittag hat sich Emmy bei mir angesagt, und Lotte wird wohl auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gestern abend – wir gingen nach dem Poker (Verlust: 3,50 Mk) in den „Bunten Vogel“ – nahm sie mich unterwegs beiseite und gestand mir, daß Strich sie entsetzlich langweile. Käme jetzt jemand, der ihr gefiele und die Existenzsicherheit weiterhin garantierte, so würde sie trotz der 4 Jahre mit Strich, in denen er sich sehr lieb und anständig gezeigt habe, doch kurzerhand die Beziehung abbrechen. Sie tat mir leid. Es ist schon schauerlich, daß alle Menschen sich im Wichtigsten ihres Daseins von materiellen Erwägungen leiten lassen müssen. Wer weiß, ob Ella zu mir käme, wenn sich ihr irgendwo eine andre Lebensmöglichkeit zeigte? Nun, sie soll keine Abhängigkeit merken. Vielleicht liebt sie mich doch eines Tages.
Uli und Seewald sind zurück. Sie waren in London und Paris. Wenn jetzt nur keine neue Thesing-Katastrophe eintritt!
München, Donnerstag, d. 23. November 1911.
Meine Faulheit übersteigt wieder alles Maß. Da ich (vom Kegeln) erst um ½ 4 Uhr heimkam, stand ich mittags um 1 Uhr auf. Nachher war, als ich aß, Krobshofer bei mir, und dann war ich bis jetzt – es ist nach 6 Uhr – im Café. Um ½ 8 Uhr soll ich im Lustspielhaus sein, wo Strindbergs „Vater“ gegeben wird. Es ist schändlich. Der Kain-Kalender, der im September angekündigt war, wartet noch auf wichtige Beiträge. Die neunte Kain-Nummer muß schnellstens in Angriff genommen werden, der Komet verlangt größere Beiträge, Robert Heymann trat mit der Anfrage an mich heran, ob ich nicht für ein Unternehmen „Briefe aus der Zeit“ einen Beitrag von etwa einem Bogen schreiben möchte, und ich sagte zu, und der Dreililien-Verlag hat auch bald Anspruch auf das Buch, zu dessen Ablieferung vor dem 1. Januar ich kontraktlich verpflichtet bin. Aber ich tue schon garnichts mehr, seit ich von Berlin zurück bin.
Heut früh um ½ 8 Uhr klopfte es wie toll an meine Tür. Ich fuhr aus dem besten Schlaf auf. Ein eingeschriebener Brief, dem ich von außen ansah, daß er ein Manuskript enthielt. Ich war wütend. Aber als ich hineinsah, und den beigelegten Brief las, interessierte mich die Geschichte plötzlich sehr. Vor längerer Zeit bekam ich einmal eine Anfrage aus St. Gallen von einem gewissen Eugen Siedeberg, ob ich wisse, wo Panizza stecke. Zugleich schrieb der Mann mir, er werde mir gelegentlich Ausführungen senden, die mich interessieren dürften. Ich antwortete ihm, Oskar Panizza sei, soviel ich wisse, in einer bayerischen Irrenanstalt interniert. Für sein Manuskript hätte ich zum Abdruck keine Verwendung, doch könne er es mir ja mal zum Lesen schicken. Nun kam also heute ein vierseitiger Brief von dem Mann. Er behauptet darin, Gründe zu der Annahme zu haben, daß sich Panizza längst im Ausland aufhalte. Er bitte mich, näheres darüber zu ermitteln. Ich werde Scharf und die Gräfin fragen, die einzigen meiner Bekannten, soviel ich weiß, die mit Panizza noch nach dem Ausbruch seines Verfolgungswahns Fühlung hatten oder noch haben. Er (Siedeberg) verfüge über die Aussage eines Hypnotiseurs, „welchen man zur Zeit, als Panizza als Flüchtling in Paris lebte, von preußischer Seite aus zu bewegen suchte, Panizza in Paris aufzusuchen und ihm durch Hypnose in einen dem Irrsinn ähnlichen Zustand zu versetzen, um hierdurch die Pariser Polizeibehörde zu veranlassen, Panizza als Geisteskranken an Deutschland auszuliefern“. Er glaube nicht an Panizzas Irrsinn, sondern vermute, daß Bayern in dieser Sache Preußen einen verbrecherischen Dienst geleistet habe. Der übrige Teil des Briefes bezieht sich auf das beigelegte Manuskript, das den Titel führt: „Grauenhafte Verbrechen deutscher Fürsten gegen mittellose Evangelische“. Ich habe die Arbeit noch nicht gelesen, werde es aber baldigst tun, denn was der Brief enthält, macht mich sehr neugierig. Danach scheint der Mann zu behaupten, daß die Kastration unbequemer Leute vielfach geübt werde, und da er von „Enthüllungen“ spricht, und schon im Brief Aeußerungen von Kriminalisten und andern zitiert, die sich im „Berliner Tageblatt“ für die Zerstörung der Zeugungsfähigkeit bei Verbrechern und Geisteskranken aussprechen, nehme ich an, daß er gutes Material gesammelt hat. Schließlich bittet er mich, das Manuskript zu behalten, und es „fleißig zirkulieren zu lassen“. – – Ob es sich bei dem Manne selbst um Geisteskrankheit handelt, oder ob er ernst zu nehmen und vielleicht zu unterstützen ist in seinen Bemühungen, werde ich wohl erst nach der Lektüre des Manuskripts erkennen können. Ich denke, die Lektüre wird aufregender sein, als die der Ewersschen dilettantischen Gespensterbücher, der ich jetzt obliege. Schickele schrieb mal eine nette Skizze. Darin ergießen sich über eine Gesellschaft eine große Menge Zettel, die aus dem Leibe eines geheimnisvollen Vogels herunterfallen und dem neugierigen Leser die Worte zeigen: „Das Grauen von Dr. jur. Hanns Heinz Ewers ist das Beste.“
München, Freitag, d. 24. November 1911.
Den 24ten! Und noch keine Feder gerührt für all das Drängende und Wichtige. Nun ist’s schon gleich, ob ich die Stunde, bis ich fort muß, um 2 Akte des neuen Halbe-Dramas zu hören (die ersten beiden las er vor einer Woche in der Kutscher-Gesellschaft vor) „arbeite“ oder hier einschreibe.
Zunächst etwas, was mir von meinem Berliner Aufenthalt nachträglich wieder eingefallen ist. Ich saß eines Abends mit Hardekopf im C. d. W. Da erschien ein sehr großer, breiter Mann mit schwarzen Locken und Vollbart. Noch ehe Hardy aufstand, ihn zu begrüßen, wußte ich, wer es war: Däubler, der Verfasser des „Nordlicht“, des dreibändigen Gedichtwerks, das ich vor einem Jahr besaß und verkaufte. Es ist mir schon mehrfach so gegangen, daß ich Leute, ohne sie oder ein Bild von ihnen je gesehn zu haben, bei der ersten Begegnung erkannte. Während des Geheimbundprozesses – (wieder eine Störung von 20 Minuten. Ein armer Teufel, der schrecklich jammerte. Ich gab ihm 1 Mk). Während des Geheimbundprozesses also saß ich einmal mit Rechtsanwalt Caro im Torggelhaus. Da kam Ernst v. Wolzogen, den ich jahrelang nicht gesehn hatte, herein – und hinter ihm noch ein Herr. Ich lief hinter Wolzogen her, um ihn zu begrüßen, als mich der andre stellte: „Sie sind Erich Mühsam.“ „Ja, sagte ich, und sie sind M. G. Conrad.“ Es stimmte natürlich, und wir hatten einen sehr hübschen Abend miteinander. – Bei Conrad war es immerhin möglich, daß ich schon mal sein Bild gesehn hatte – von Däublers Exterieur hatte ich aber keine Ahnung, und ich hätte ihn mir eher blond und schlank vorgestellt. – Wir unterhielten uns über französische Angelegenheiten. Er zeigte sich als Feind der Republik und wünschte eine Renaissance der Dynastie. Es schloß sich eine interessante Debatte daran über Anarchismus, den er nur als aesthetische Idee anerkannte. Hardy bekannte sich natürlich zur Reaktion à tout prix. Bei andrer Personenzusammenstellung wird er wütender Anarchist sein.
Zur Gegenwart: der Artikel Siedebergs enthält in der Tat sehr schwere Beschuldigungen. Er behauptet, es sei in Deutschland – und zwar auf Befehl der Fürsten und Fürstinnen, speziell Wilhelm II. – gang und gäbe, Zucht- und Irrenhäusler zu entmannen. Er führt auch Beispiele an, doch kann ich mit seinen Beschuldigungen solange nichts anfangen, wie er nicht auch Beweise bringt. Ich werde ihn anfragen, worauf sich seine Tatsachen stützen. Überraschend wäre die Schweinerei ja nicht, ich traue Behörden und deren ärztlichen und juristischen Beamten jede Teufelei zu. Aber, will ich sie öffentlich angreifen, so muß ich absolut beweisendes Material haben.
Gestern abend reiste Rößler mit dem Consul nach Partenkirchen ab. Es gelang uns noch, uns einmal in Consuls Zimmer zurückzuziehen, wo wir die Minute des Alleinseins zu Abschiedsküssen benutzten. Dann ging ich ins Lustspielhaus und sah Strindbergs „der Vater“. Ein erschütterndes Stück von dämonischer Konsequenz und innerer Notwendigkeit. Ich sage zu Strindbergs Auffassung vom Weibe so laut ich kann Nein. Aber immer wieder zeigt sich in seinen Werken, wie wahre Kunst unbestreitbare Wahrheit giebt, und wie jede Polemik, jeder Zweifel schweigt, wenn das Leben selbst gestaltet ist. – Die Aufführung war ganz gut. Götz als Rittmeister ausgezeichnet – sehr klug und differenziert. Eugenie Werner als Paula respektabel. Alle übrigen recht mäßig, aber darauf kommt es nicht an. Ich hatte starke Eindrücke. Neben mir saß die Steckelberg und Mannheimer. Ich empfahl ihnen dringend, die „Schauspielerin“ von Heinrich Mann dem Neuen Verein zu empfehlen.
Tschudi ist gestorben. Das ist ein großer Verlust für Münchens Kunst. Seit er Direktor der Galerien war, war aus der Pinakothek erst ein wirklich weltbedeutendes Museum geworden. Er wird schwer, wohl garnicht, zu ersetzen sein. Daß demnächst an die Münchner Universität Wölflin als Dozent für Kunstgeschichte kommt, ist ein gewisser Trost. In seinen Kollegien in Berlin, die ich schund, habe ich viel gelernt. Übrigens war es auch sein Kolleg, wo ich zum ersten Mal Johannes sah.
Auch Wilhelm Jensen ist gestorben. 79 Jahre alt. Ich hatte keine Stellung zu seinen Werken.
München, Sonnabend, d. 25. November 1911.
Max Halbe las in der „Kutscher-Kneipe“ die beiden letzten Akte seines neuen Spiels „Der Ring des Gauklers“ vor. Den Inhalt der ersten beiden Akte hatte ich mir vorgestern im Foyer des Lustspielhauses von Kunkel erzählen lassen, außerdem rekapitulierte ihn Halbe vor der Vorlesung recht umständlich. So glaube ich, über das Stück schon einiges Urteil zu haben. Wenn mich die gute Art des Vortrags, die nur hin und wieder etwas schmalzig war, nicht getrogen hat, so ist dies das beste Werk Halbes. Ein Durcheinander von Leben, Bewegung, lyrischer Stimmung, dramatischer Handlung, das einen nicht aus der Spannung läßt. Dabei gute Charakterzeichnung, starke und gefühlte Sprache und der eigentliche dramatische Konflikt von großer Schwere und erschütternden Einzelheiten. Sehr amüsante Nebenhandlungen bewirken zum Schluß den Effekt eines Lustspiels. Ich hoffe für Halbe, daß er mit diesem Werk endlich wieder mal den ersehnten Erfolg haben mag. Die Studenten gingen sehr mit, und waren am Ende recht begeistert. Es war eine Freude, unter diesen lebendigen, begeisterungswilligen jungen Menschen zu sein. Als sich die meisten verzogen hatten, blieben wir andern noch in guter Unterhaltung beisammen an einem sehr langen Tisch, an dessen einer Seite Halbe, Kutscher und ich saßen, gegenüber vielleicht zwanzig Studenten, und ich hatte den Eindruck, als ob wir drei den jungen Leuten mit unsern Gesprächen eine Galavorstellung gäben. Wir sprachen über die Anfänge der Literaturbewegung Ende der 80er Jahre, und Halbe erzählte recht Interessantes aus seinen Erlebnissen, wie er mit Gerhart Hauptmann zusammenkam u. s. w. Ferner über die Entstehung seiner „Jugend“. Darauf kam er durch Lenz und Goethe. Lenz war bekanntlich der Nachfolger Goethes bei Friederike von Sesenheim. Diese Pfarrhausgeschichte gab den ersten Anstoß und wurde dann, verquickt mit eignen Erlebnissen Halbes, zu der Tragödie „Jugend“. Wir sprachen dann über viele Persönlichkeiten: Arno Holz, Mackay, Conradi, Peter Hille, Wilhelm Arendt, Panizza, Wedekind u. s. w. – und erst gegen 2 Uhr nahmen wir von den Studenten Abschied und gingen zu dreien noch ins Stefanie. Halbe begleitete mich dann noch bis vor die Haustür. Es war ein angenehmer Abend. In der nächsten Woche am Freitag soll ich bei Kutschers Studenten lesen. Das Programm habe ich noch nicht im Kopf. Wohl hauptsächlich Gedichte.
Jetzt habe ich dem Mädchen gesagt, ich sei für keinen Herrn zuhause – nur Damen darf sie einlassen. Denn jetzt will ich endlich an die Arbeit gehn.
München, Sonntag, d. 26. November 1911.
Gestern habe ich endlich gearbeitet, wenn auch nur einen Artikel „Gegen die Polizei“, den ich in fünf Stunden hintereinander herunterschrieb. Nachher kam Muschi, die jetzt täglich erscheint und die Küsse bringt, die ich sonst von ihrer Schwester bekam. – Den ganzen Abend war ich im Stefanie. Dort traf ich Uli und Seewald. Sie erzählten von ihrer Reise nach England und Frankreich. In London haben sie geheiratet, um gewissen Chikanen wegen des Zusammenlebens aus dem Wege zu gehn. Ich kramte mit Uli Erinnerungen herauf aus unsrer Berliner Zeit, wie sie ohne Wohnung war und jeden Morgen bei mir in der Grolmannstrasse ans Parterrefenster klopfte. Dann bat ich sie durchs Fenster zu mir zu kommen, räumte ihr mein Bett ein und legte mich auf den Divan. Wie sie mich einmal telegrafisch an den Bahnhof Friedrichstrasse bestellte, da sie von Königsberg kommen sollte. Ich holte sie ab. Sie stieg aus dem Zug mit einem eleganten jungen Mann. Zunächst fiel sie mir um den Hals und küßte mich ab. Dann stellte sie vor: „Mein Verlobter“. – Es war der ewige Verlobte, Assessor Krell. Schon am Bahnhof schickte sie ihn fort. „Ich möchte jetzt mit Mühsam gehn.“ – Wir erinnerten uns des köstlichen Umzugs Ulis von der Schaper- nach der Regensburgerstrasse. Ich hatte mir von einem Portier einen Handwagen ausgeliehen. Darauf packten wir das bischen Mobiliar von Uli, ein Sofa, ein Tischchen, ein paar Stühle, einen dürftigen Teppich und sonstige Kleinigkeiten. Das schob ich durch die Straßen des vornehmen Berliner Westens, und Uli ging, im Munde eine Zigarette, vergnügt nebenher. – Schließlich fiel mir auch die entzückende Geschichte ein, die ich Uli nie vergessen werde, weil sie so ganz echt Uli war dabei. Ich fuhr – wohl zu Hans’ Hochzeit – nach Lübeck, und hatte in Berlin nur kurze Zeit, in der ich außer Uli niemand sehn wollte. Ich hatte sie deshalb um 5 Uhr nachmittag ins Café Klose in der Leipzigerstrasse gebeten. Da kam sicher kein anderer Bekannter hinein. Punkt 5 Uhr erschien Uli, stürzte auf mich zu, küßte mich stürmisch auf den Mund, und sagte: „Ich muß schnell noch etwas besorgen. Wart einen Augenblick, mein Lieber. Ich bin gleich wieder zurück“. Noch ein Kuß, und fort war sie – natürlich, ohne wiederzukommen. – Es war sehr nett, und ich habe mich lange nicht mehr so gut mit Uli unterhalten wie gestern. Ich uzte sie mit ihrer Ehe, und meinte, unter Zustimmung des jungen Paares, als geschiedene Frau Seewald wird sie es einmal leichter haben in der Welt, als das ewige Fräulein Trotsch. Später kamen Lotte und Strich, und ich pokerte dann noch mit Strich und Negoschann, wobei ich leider 5 Mk verlor. – Dann gingen wir alle noch in den übervollen Simpl., wo Mary Irber, umringt von zahllosen Verehrern saß. Sie wird etwas ältlich allmählich, ist aber immer noch recht reizvoll. Ferner war Seewalds Freund Manasse dort mit einem ganz entzückenden Mädchen, das ich zum ersten Mal sah. Lotte fand, sie erinnere an Ella Barth. Sie kann recht haben. In den Augen war so etwas. Übrigens habe ich von Ella noch keine Zeile erhalten. Es ist unrecht von ihr, mich so zu vernachlässigen.
München, Montag, d. 27. November 1911
Ich habe leider schon wieder im Poker Geld verloren: 12 Mk, und wenn auch das Puma das meiste davon gekriegt hat, so fühle ich den Verlust doch recht schmerzlich. Gottseidank ist in drei Tagen der erste, und dann kommt sowieso Geld. Aber es wäre doch erfreulich gewesen, wenn ich diese letzten Tage ohne Sorgen durchgekommen wäre. – Gestern schrieb ich die ganze neunte Kain-Nummer fertig. – Heut liefere ich das Manuskript ab, und hoffe, noch heute an den Volksfestspiel-Artikel gehn zu können, der nebst einigen Kleinigkeiten der letzte ist, was noch zum Kalender fehlt. – Ist das erledigt, dann kommt die Essaysammlung für den Dreililien-Verlag an die Reihe.
München, Dienstag, d. 28. November 1911.
Donnerstag abend findet nun endgiltig die Versammlung statt, und zwar in der Schwabinger Brauerei. Thema: „Staat, Kirche, Polizei und Abhilfe.“ Ob die besonders geladenen Künstler kommen werden? Ich habe große Zweifel. Leider zweifle ich diesmal auch an meiner Geschicklichkeit. Man muß abwarten: vielleicht gelingt’s, obwohl ich noch nicht weiß, wie ich einleuchtend machen soll, daß sich die Künstlerschaft wegen der Villany-Affäre für den tripolitanischen Krieg interessieren muß. Vielleicht findet aber mein richtiges Gefühl im Moment, wo es nötig ist, doch die richtigen Worte. Herr v. Krobshofer schreibt mir, daß von Berlin die Drucksachen gekommen sind. Jetzt erwarte ich seinen telefonischen Anruf.
Gestern zeigte mir Steinebach den Brief, den er an Papa geschrieben hat. Sehr sachlich und einleuchtend. Ich habe einen langen Brief ebenfalls abgesandt, in dem ich Papa auseinandersetzte, daß die Abgabe von 80 Mk monatlich meine Hoffnung, endlich eine eigne Wohnung haben zu können, wieder zerstören würde. Ich denke mein Brief wird ihn bewegen, die 3000 Mk herauszurücken. Es wäre unglaublich, bliebe er danach verstockt.
München, Mittwoch, d. 29. November 1911.
Die Niederschrift gestern mittag unterbrach das Erscheinen Krobshofers, mit dem ich dann zu Steinebach ging. Heut hängen nun überall sehr große gelbe Plakate, auch sind Handzettel genügend zur Stelle, um die Tatsache der Versammlung weithin bekannt zu geben. – Ich freue mich sehr darauf, endlich mal wieder vor den Münchnern stehn zu können und ihnen Dinge zu sagen, die sie von andern nicht hören. Die „Münchner Neuesten Nachrichten“ und die „Münchner Zeitung“ hatte ich gebeten, einen beigelegten Waschzettel abzudrucken, der auf die Veranstaltung hinwies. Beide haben es nicht getan. Diese Burschen, die das Maul mit freiheitlichen Redensarten zum Speien vollhaben, machen sich die Hosen voll, wenn sie einmal eine wirklich freiheitliche Aktion auch nur ankündigen sollen. Der „M. P.“ habe ich natürlich schon garnicht die Bitte gestellt.
Abends war ich dann in der Aufführung des Neuen Vereins im Künstlertheater. Es gab Lenz’ „Die Soldaten“, die Dr. Kutscher neu für die Bühne bearbeitet hat. Das Experiment war ungeheuer interessant. 16 Szenen wurden vorgeführt, in denen sich die Tragödie des Soldatenliebchens, die durch Umstellung der letzten Bilder zur Tragödie des Tuchhändlers Stolzius gemacht war, abspielte. Der Inhalt war belanglos, so, daß ich nachher, als ich gefragt wurde, mein Urteil dahin zusammenfassen konnte: „Wenn es nicht so riesig interessant wäre, wäre das Stück langweilig.“ – Übrigens sind die Einzelheiten ganz herrlich und einzelne Worte und Sätze zeigen die ganze große Genialität des alten Stürmers. v. Jacobis Regieleistung war sehr respektabel – eine sehr schwere Aufgabe, das Publikum in Spannung zu erhalten, während 15mal der Vorhang niedergeht. Noch mehr lobe ich Herrn Leo Pasetti, der die Ausstattung besorgt hatte. Auf dieser kümmerlichen Bühne wurden Prospekte gezeigt, die prachtvoll waren. Noch keiner von den Künstlern, die sich unter Reinhardt darum bemüht hatten, hat die Schwierigkeit, mit der Reliefbühne fertig zu werden, so gut bewältigt wie Pasetti. Von den Einzelleistungen ist nicht sehr viel zu sagen. Sie waren zu unterschiedlich. Recht gut – weil garnicht routiniert, aber in ihrer Naivetät glaubhaft und graziös war Frl. Wolters, eine Schülerin Königs, die das verliebte Mädel spielte. Den Galanterienhändler, ihren Vater, gab Schröder recht gut und eindrucksvoll. Frau von Hagen als Gräfin La Roche sah wundervoll aus und spielte sehr nobel. B. v. Jacobis Tuchhändler war etwas zu eckig, hatte aber recht gute Momente. Ganz schlecht waren die Offiziere – alle! Graumann war zu geleckt, König, Nadler, Alten, Trautsch, Blum und Forster zum Kotzen. Stettner versuchte zu charakterisieren, machte es aber so ungeschickt, daß man hätte weinen mögen. Am besten von allen waren die beiden komischen Alten Frl. Werner, die als Großmutter Wesener ungemein echt und sehr komisch war, und besonders Frl. Hohorst, deren Jungfer Zipfersaat das vollendetste war, was ich überhaupt noch an Grotesk-Charakteristik auf der Bühne sah. Dieser Hohorst – sie spielte seinerzeit in der Büchse der Pandora die Geschwitz – kann man eine große Zukunft als komische Alte prophezeien. Sie wird der Ilka Grüning einmal den Rang ablaufen ... Im Theater war wieder alles versammelt, was überhaupt in München Geltung hat. Alle Genies und alle Esel, alle sezessionistischen Waschweiber und alle süßen Schwabingerinnen. Man hatte vor lauter Verbeugungen ein verkrümmtes Rückgrat. Nachher war ich erst in der Torggelstube, wohin vor lauter Angst, es werde dort überfüllt sein, blos ganz wenige gekommen waren: Gustel Waldau, Lulu Strauß, Ulmer und Nadler. Ich ging bald fort. Gustel setzte mich per Auto bei der Odeonbar ab, wo Lotte und Strich, Uli und Seewald und der kleine Hörschelmann mich erwarten. Neuerdings hat sich zu unsrer Gesellschaft noch ein Herr eingefunden, den keiner recht kennt. Er scheint Corneis zu heißen. Lotte nennt ihn Cronos, ich: Cornetbeef. Ich werde ihn wohl in diesen Tagen abschaffen, da er taktlos ist und keine Distanz hält. Zum Schluß: Simplizissimus. Kathi hat – was vorläufig geheim bleiben soll – das Lokal verkauft. Damit wird es wohl entgiltig mit dem Simpl vorbei sein. Denn man ging doch letzten Endes nur der Wirtin wegen hin. – Eine kleine Überraschung muß ich aufschreiben, die mir dort bevorstand. Mary Irber war dort. Wir saßen an verschiedenen Tischen. Als sie ging und mir adjö sagte, konnte ich nicht umhin, ihr einen Kuß zu geben, und sie hielt, was ich nicht erwartet hätte, ganz brav den Mund dazu hin. Seit Wien, also seit 5 Jahren, der erste Kuß von ihr.
Als ich nachhause kam heute nachmittag, fand ich einen Brief aus Lübeck vor von Papa. Die Antwort auf meine Bitte um die 3000 Mk. Er schlägt mir das Geld wirklich ab. Zwar redet er sich erst darauf hinaus, daß er momentan kein flüssiges Kapital habe. Die Häuser bringen nicht viel, da fortwährend Reparaturen nötig seien, sein übriges Geld sei in Hypotheken fest und die Reichsbank ziehe ihm wegen Charlottes Mitgift 6% von den Zinsen ab – wenn ich ihn recht verstehe. Die beiden Mitgiften für meine Schwestern in Höhe von 60000 Mk hat er also seinerzeit aufgebracht, Hans’ Laboratorium, das gewiß einige Tausende gekostet hat, hat er bezahlt. Die Hochzeiten meiner Geschwister, deren jede einen großen Batzen verschlungen hat, konnte er auch bestreiten – aber mir gegen gute Verzinsung 3000 Mk zur Sicherung meiner Arbeit zu geben, ist ihm nicht möglich. Nachher kommt dann freilich der wahre Grund. „Alle Deine Unternehmungen trugen den Stempel der Unreife und brachten mir bittere Stunden. Nun, ich will die Geschichte von der Untergrabung seiner Gesundheit nicht noch einmal aufrollen. Ich will mit dem Anfang Deiner Einsicht, daß auch wir es gut mit Dir meinen, mich heute freuen. Von dem Unternehmen mit dem „Kain“ halte ich gar nichts. Ebensowenig halten Hans, Grethe, Charlotte, Julius und Leo etwas davon. Es ist ein ganz untergeordnetes Machwerk, das niemals sich Eingang verschaffen wird oder kann.“ Und so weiter. Dann natürlich die alte Geschichte: Ich muß „eine feste Anstellung mit festem Gehalt in einem angesehenen Geschäft“ finden. Was kann man da machen? Daß ich vom „Komet“ Geld und Fixum kriege, erfreut ihn sehr. Sehr schön. Aber er läßt es zu – denn er weiß, seinen Willen, ich soll mein Blatt eingehn lassen, werde ich nicht tun –, daß ich von diesem Gehalt den größten Teil wieder in meine Arbeit hineinstecken muß. Von seiner Gesundheit, die ich untergraben habe, will er nicht reden – und tut’s mit diesen Worten schon. Was heißt das? Er ist mit dieser durch mich untergrabenen Gesundheit 73 Jahre alt geworden und ist rüstiger als ich. Wer hat meine Gesundheit untergraben? Wer hat mir „unsagbaren Kummer“ gemacht? „Du warst bisher nicht auf dem richtigen Wege.“ Aber er war auf dem richtigen Wege, da er ohne Eingehn auf Charakter und Sonderheit des von ihm gezeugten Menschen immer wieder, immer und ewig Dinge verlangte, die diesem Charakter, dieser Sonderheit stracks zuwider sind. Ich hatte von meinem Wunsch geschrieben, endlich aus dem möblierten Zimmer, in dem ich schlafen, essen und arbeiten muß, herauszukommen und eine eigene Häuslichkeit zu haben. Ja, die gönnt er mir von Herzen. Aber die Hilfe, die ich dazu brauche, gibt er mir nicht. „Vielleicht erlebe ich doch noch Freude, und dann will ich alles vergessen.“ Ja, ja. Aber ich werde, solange dieser Vater lebt, keine Freude erleben. Und wenn ich dann – nachher – alles vergessen wollte, wäre das nicht Hohn? – Wie ist es möglich? Wie kann ein Vater so verbohrt sein? Jetzt hätte er Gelegenheit gehabt, ein gutes, mögliches, menschliches Verhältnis zwischen uns herzustellen. Nein! Er weiß genau, ich muß jetzt warten, daß er stirbt, ich muß hoffen, daß er bald stirbt, damit ich, der jüngere, der seinen Ehrgeiz, seinen Stolz, sein Wertbewußtsein hat, leben kann. Er zwingt mich, seinen Tod meine Hoffnung sein zu lassen. Ob er das garnicht weiß? Ich würde ihn so gern lieben. Aber sein Verhalten zwingt mich ihn zu hassen. Denn auch in seinem Verhalten sehe ich kein Fünkchen Liebe zu mir; nur das Prinzip: Ich, der Vater, will Recht behalten! Es wird also weiter gehn müssen, wie es bisher ging. Noch ein paar Jahre Kummer, Entbehrungen, Einschränkungen, Unbequemlichkeiten, Alleinsein, Verbitterung, Lähmung, Unzufriedenheit, Eintrocknung, bis er stirbt oder bis ich kaput gehe.
München, Donnerstag, d. 30. November 1911.
Vor einigen Tagen kam von Johannes aus Wien eine sehr traurige Postkarte. Es geht ihm immer noch sehr schlecht, und er hofft immer noch auf mich, daß ich’s ändern soll. Ich mag ihm schon garnicht mehr schreiben, da ich ihm doch so garnicht helfen kann. Seit diese Karte ankam, löst ein Mißliches das andre ab. Gestern der Brief von Papa, heute einer von Ella. Dem armen Kinde gehts sehr traurig. Sie empfindet ihre Abhängigkeit von Tilla Durieux so, daß sie diese Frau glühend haßt. Sie möchte ihr, wie sie mir schreibt, „stundenlang in die Fresse schlagen“. Karlheinz Martin, ihr früherer Direktor, mit dem sie ein Verhältnis hatte, und in den sie offenbar immer noch sehr verliebt ist, ist jetzt Oberregisseur am Frankfurter Schauspielhaus. Er will sie bei sich haben, kann ihr aber kein Engagement verschaffen. Nun meint sie aber – wie liebe ich sie darum! – sie könne nicht leben wenn sie nicht Theater spielen dürfe. „Was soll ich tun?“ fragt sie wohl sechsmal. Ich soll ihr raten. Zu mir, schreibt sie, möchte sie nicht gern ziehen, weil sie mich „nicht genug lieb habe“, und weil sie fürchtet, sie könne mir zur Last fallen. Auch will sie nicht nach München, ehe nicht Engagementsverhandlungen wenigstens eingeleitet sind. Es bleibt mir jetzt wohl nichts übrig, als alle Diplomatie Robert gegenüber fallen zu lassen, und ihm den Vorschlag, sich Ella Barth zu verpflichten, direkt vorzutragen. In der letzten Zeit gehn Gerüchte um, daß das Lustspielhaus vor der Pleite stehe, da Georg Müller kein Geld mehr hineinstecken wolle. Es wäre schrecklich, wenn das wahr wäre! – Wer hätte das gedacht, daß ich an der Weiterführung dieses von mir so arg geschmähten Theaters so großes Interesse haben könnte! Was soll ich Ella nun raten? Ich werde ihr schreiben, sie solle herkommen. Ich habe, abzüglich der 40 Mk für Johannes und der 80 Mk für den „Kain“ (Gott gebe, daß Bolz’ Befürchtungen um den „Kometen“ ohne Grundlagen seien!) monatlich 250 Mk sicher, abgesehn von dem, was ich nebenher noch verdiene. Ich glaube, mit 300 Mk kann ich wohl ziemlich sicher rechnen. Das werde ich Ella vorrechnen, werde ihr nahelegen, daß sie in Berlin nicht bleiben darf, weil die finanzielle und persönliche Abhängigkeit, die die Durieux sie so sehr spüren läßt, für ihren Gemütszustand schädlich sein muß, daß sie nach Frankfurt nur gehn soll, wenn ihre Sehnsucht nach Martin es unbedingt verlangt, sie sich sonst aber hüten möge, so nahe beim Theater selbst nicht spielen zu dürfen, und daß sie hier in München auf meine Liebe und Freundschaft bauen kann, daß ich nichts von ihr verlangen werde, was sie nicht freiwillig gibt, daß die Engagementschancen größer sind, wenn sie persönlich da ist, und daß sie ja jeden Moment wieder weg kann, wenn es ihr hier nicht gefällt. – Soll mir wirklich auch diese Hoffnung wieder in die Brüche gehn? Soll ich all mein Lebtag allein bleiben? – Lotte ist kühl zu mir. Sie scheint unglücklich zu sein. Frieda ist fort. Wer weiß, wann ich sie wiedersehe? Die kleinen Mädels wie Emmy, Peppi u. s. w. gehn mich wenig an, aber sie behandeln mich auch schlecht. Es ist kläglich.
München, Sonnabend, d. 2. Dezember 1911.
Die Versammlung am Donnerstag abend verlief ganz gut. Der große Saal der Schwabinger Brauerei war zu meiner Überraschung überfüllt. Ich hatte zuerst nur den kleinen etwa 300 Personen fassenden Galeriesaal bestellt, und nur für den Eventualfall den großen. Es kamen aber über 1000 Personen. Die Zusammensetzung des Auditoriums war ganz ungewöhnlich. Sehr viele Literaten – u. a. die Beutler, Freksa, Halbe, Schaumberger, Scharf u. s. w. –, Künstler, Anarchisten aller Schattierungen und das übrige Studenten. Ich sprach 1½ Stunden, aber meine Rede stellt mich selbst wenig zufrieden. Sie war garzu zerrissen. Immerhin sprach ich fließend und wenn ich aus den vielfachen Unterbrechungen durch Beifall und Jubel schließen darf, wohl auch temperamentvoll und mitreißend. Der Schluß, in dem ich über „Abhilfe“ hätte sprechen sollen, kam ganz zu kurz. Ich konnte nur vage Andeutungen dessen geben, was der S. B. will. In der Diskussion sprachen ein paar Studenten, deren Nüchternheit und Müdigkeit mich ärgerte. Am besten sprach Sirch, der Holzarbeiter, der etwas besoffen war, aber recht leidenschaftlich redete. Recht widerlich war, daß die Studenten ihn seiner unbeholfenen Ausdrucksweise wegen auslachten. Am Schluß meines Referats war großer Beifall gewesen, untermischt mit Johlen und Pfeifen. Während der Diskussion wurde der Lärm der Studenten immer größer. Sie hatten nur noch ihren Bierulk an der Versammlung. Es war sehr deprimierend, so nahe zu sehn, wie bar diese jungen Menschen aller Herzhaftigkeit und alles leidenschaftlichen Temperaments sind. Ich mußte sie erst „dumme Jungen“ nennen, um das Klavierspiel, dem sie sich während der Rede eines jungen Mannes hingaben, zu verhindern. Im Schlußwort sprach ich dann auch nur noch gegen diese Herzenskälte der satten Söhne reicher Leute. – Ich war arg verstimmt von dem Benehmen der Burschen. Viele Leute hatten sich während der Versammlung an mich herangepürscht. Herr Otto Borngräber hatte mir geschrieben und dann mich auch noch mündlich ersucht, auf das Verbot seiner „Ersten Menschen“ einzugehn. (Ich tat ihm den Gefallen). Ein alter Genosse Vrba, ein feiner Revolutionärstyp mit einem Kopf, gemischt aus Hermann Bahr und Michael Bakunin, stellte sich vor. (Ich lud ihn gestern zum Essen zu mir. Ein armer Teufel, der als Modell lebt, und dem ich einen Anzug, Stiefel, Mütze und bares Geld gab). Dann viele Studenten, darunter einer, der mir jüngst einen sehr jugendlichen Artikel „Kritik“ geschickt hatte mit der Bemerkung, vielleicht könne ich mit seiner Arbeit oder mit – ihm selbst etwas anfangen. Brand heißt der Jüngling. Ich hatte erst Spitzelei auf Homosexualität gewittert, und ihm daher erst nach langem Zögern geantwortet, er möge in die Versammlung kommen. Ein weicher blonder Junge. Vielleicht kann das Puma von ihm Gebrauch machen. Die Münchner Zeitungen – die Münchner Neuesten Nachrichten und die Münchner Zeitung hatte ich vorher eigenhändig eingeladen und gebeten, sie möchten die Versammlung anzeigen, was sie nicht getan haben – brachten keinen einzigen Bericht darüber. Es ist wieder einmal echt. Ich habe noch Platz in Nr. 9 des „Kain“. Wartet, Burschen!
Ich hatte mich in der Erregung so überschrieen, daß ich gestern ganz heiser war. Gleichwohl mußte ich bei Kutscher lesen. Ich zog vor, nur Gedichte vorzutragen. Der Beifall war groß, und wie mir schien, wie auch Kutscher mir bestätigte, spontan und ehrlich. Das erfreut. Ich blieb mit einer Anzahl der Studenten und mit Kutscher noch lange beisammen und ging schließlich ins Café Stefanie und dann mit Strich, Lotte, Seewald und Uli zu Kathi Kobus (die den „Simplizissimus“ tatsächlich verkauft hat). Dort hatte ich eine große Freude. Ich saß neben Uli, die mir wieder ganz entzückend schien. Einmal fragte ich sie, ob ich ihr von dem Bretzelmann etwas kaufen solle. Sie lehnte ab, nahm mich aber plötzlich beim Kopf und küßte mich. Wie liebe ich das Mädchen um solcher plötzlichen Eingebungen willen. Ich hätte fast geweint vor Freude. – Heut war ich bei Lotte, um ihr einige Schmucksachen zu bringen, die beim Goldarbeiter repariert worden sind. Sie zeigte mir ihre neuen Puppenarbeiten. Sie ist eine große Künstlerin. Persönlich geht’s ihr garnicht gut. Ihre Liebe zu Strich scheint ganz verflogen. Sie ist deprimiert und offenbar unglücklich, was sich auch in ihrem Benehmen gegen mich äußert. Sie kommt nie mehr zu mir zum Essen, und an das andre darf ich schon kaum mehr denken. Daß ich ihr den Hals küßte, schien ihr schon zu viel. Nachher traf ich Uli im Caféhause. Sie wollte zu Lotte und als ich ihr meine Begleitung anbot, lehnte sie ab, da sie vorher noch eine Besorgung machen wolle. Ich ging eine viertel Stunde nachher und traf Lotte, der ich berichtete, Uli sei zu ihr gegangen. Sie beauftragte mich, ihr nachzugehn und bei ihr festzuhalten. Auf dem Wege holte ich Uli ein. Sie ging mit Thesing, und war sichtbar betreten, daß ich sie in dieser Begleitung sah. Merkwürdig, daß diese in jedem letzten Zuge gegensätzlichen Menschen nicht voneinander loskönnen! Der arme Thesing ist so unglücklich bei dieser Liebe, daß er sich jetzt schon vom Alkohol zum Aether bekehrt hat. Wenn das alles nur ein gutes Ende nimmt!
München, Sonntag, d. 3. Dezember 1911.
Seit langer Zeit war ich gestern abend wieder mal mit Wedekind zusammen. Vorher hatte ich in der Torggelstube Lotte, Uli und Seewald getroffen. Wir waren zusammen ins Stefanie gefahren und dann hatte Strich Lotte antelefoniert, und die beiden verabredeten sich noch einmal ins Torggelhaus. Ich begleitete dann Puma. Strich war mit einem Vetter schon dort. Bald kam Wedekind, der sich allein an den Haupttisch setzte. Ich zu ihm. Wir sprachen über die Versammlung, das Lustspielhaus, das, wie Lulu Strauß behauptet, am 1. Januar die Bude zumachen wird, über den „Kain“, über Harden und den „Pan“. Wedekind berichtete, Fred habe ihn ersucht, für den „Pan“ einen Artikel über die Wahlen zu schreiben. (In der neuesten Nummer hat Heinrich Mann einen glänzenden Artikel „Reichstag“). Wedekind forderte mich auf, statt seiner den Artikel zu schreiben, und schlug mir vor, mir ein Pseudonym zu wählen, unter dem ich dem „Pan“ regelmäßig politische Beiträge gäbe. Seit Kerr dort weg sei, sei dort kein Mensch, der die öffentlichen Dinge zu behandeln wüßte. Auf diese Weise würde ich genug verdienen, um den „Kain“ davon bezahlen zu können. Ich will’s versuchen. Wenn die 80 Mk für Steinebach auf andre Weise aufkämen als durch den „Kometen“, wäre ich natürlich froh.
Diesmal fiel meine Pensions-Rechnung besonders billig aus: 123 Mk. Die habe ich bezahlt, gestern auch Steinebach die 80 Mk abgeliefert und an Johannes 50 Kronen (43 Mk) geschickt. Jetzt habe ich wieder blos noch einige 80 Mk im Besitz. Kommt nun, wie ich nach dem Brief, den ich ihr schrieb, hoffe, Ella in diesem Monat zu mir, so werde ich am ersten Januar nach allen Abzügen mit den 375 Mk nicht entfernt auskommen – und die 250 Mk vom Dreililien-Verlag haben noch gute Wege, da ich bisher zu dem Essay-Buch nicht das geringste getan habe. – Steinebach habe ich veranlaßt, eine Annonce in die Zeitung zu setzen, in der 5000 Mk für 5 Jahre zur Kain-Finanzierung gesucht werden. Viel Vertrauen habe ich nicht, daß darauf Rettung kommen wird. Aber ich will doch schließlich alles versucht haben.
München, Montag, d. 4. Dezember 1911.
Residenztheater: Das weite Land. Tragikomödie in 5 Aufzügen von Artur Schnitzler. Das Stück ist eine Tragödie. Ich ärgere mich darüber, daß unsre Dichter sich immer wieder scheuen, das Leid beim richtigen Namen zu nennen. Wenn die Verwicklungen eines Dramas tragisch ausgehen, so nenne ich es ein Trauerspiel, auch wenn nur eine nicht durchaus hauptsächliche Person stirbt. Hier verliert die eigentliche Heldin ihren Mann durch sein und ihr Schicksal, ihren Liebhaber, da er durch ihren Mann erschossen wird, die Geliebte dieses Mannes ihn, die Mutter des Getöteten ihren Sohn, alle ihre Hoffnungen, und alle sind am Schluß Verirrte im „weiten Land“ ihrer Sehnsucht und der Seele. Ich wüßte nicht, wann der Ausdruck Tragödie größeres Recht auf Anwendung hätte. Es ist ein erschütternd schönes Stück. Voll echter Menschlichkeit, voll großer Poesie, voll tiefer Kenntnis verworrener Seelen. Schnitzler ist ein feiner, kluger, differenzierter, geschmackvoller Dichter. Gespielt wurde sehr gut. Steinrücks Leistung war ganz meisterlich. Er ist so natürlich, daß man erschrickt. Und doch vermeidet er den Anschein der Banalität völlig. Der Hofmeister gehört zu seinen allerherrlichsten Schöpfungen, und übertrifft noch seinen wunderbaren Solneß. Seine Partnerin war Mi von Hagen. Sie ist sehr sehr schön anzusehn, spielt vornehm und sicher, bewegt sich schön und hat prachtvolle Herztöne. Ich liebe sie als Schauspielerin ebenso wie persönlich, weil sie garnicht posiert und immer sie selbst ist. Bernhard von Jacobi war, wie immer, etwas eckig. Aber er ist unleugbar ein Talent, und ich mache die Opposition gegen ihn, die in meinem engeren Freundschaftskreise (Strichs, Lotte etc.) üblich ist, nicht mit. Alle übrigen entsprachen ziemlich gut ihren Anforderungen (die Dandler, Ulmer, Graumann, Gura, Schwannecke, Basil, der die Regie tüchtig geführt hatte, aber etwas zuviel darin tat, selbst Trautsch, Stettner und Nadler). Nur die Michalek, die eine wichtige große Rolle hatte, versagte völlig. Es ist skandalös, so etwas auf einer großen Bühne herauszustellen. Sie kann weder sprechen, noch sich bewegen, noch charakterisieren, und sieht nicht einmal vorteilhaft aus. Konventionell wäre noch zuviel Lob für sie. Dabei hatte ich Steinrück die Barth bringen wollen, und er hat kaum einen Finger für sie gerührt. Seine Ausrede, Speidel lasse sich, da die Michalek engagiert sei, auf keine Vorschläge ein, ist hinfällig. Denn Eveline Landing, mit der er allerdings ein Gschpusi zu haben scheint, bringt er jetzt an ans Hoftheater. Ich bin sehr böse auf Steinrück. Nach dem Theater war ich im Torggelhaus. Beide Striche, Lotte, Uli, Seewald, der unvermeidliche Cronos, der Krummer zu heißen scheint und ein Schweizer Freund von ihm. Nachher ging ich zum Haupttisch, wo sich Dr. Robert mit Ida Roland niedergelassen hatten. Wir sprachen über alles Mögliche, und ich benutzte die Gelegenheit, Ella Barth zu empfehlen. Dabei fühlte ich zugleich auf den Zahn, ob der Schluß des Theaters schon sicher sei. Das scheint nicht der Fall. Denn Robert redete von der nächsten Saison und schien einem Nähertreten der Engagementsverhandlungen mit Ella Barth nicht abgeneigt. Es wäre herrlich. Ich mußte natürlich sehr reserviert sein und dürfte mein persönliches Interesse an der Sache nicht merken lassen. – Nachher gingen wir, Lotte, Strich und ich, ins Stefanie, wo wir mit Negoschann pokerten. Ich verlor wieder über 10 Mk, was mir wie ein Diebstahl an Ella vorkommt.
Heute kam von Wedekind ein Brief, der auf unser Gespräch von vorgestern Bezug nimmt. Er habe an Fred geschrieben und ihn „mit allen Mitteln“ auf mich gehetzt wegen der Mitarbeit am „Pan“. Zugleich bittet er mich, von meiner Kenntnis der Vorgänge beim Abdruck seiner Kleist-Rede in den Münchner Neuesten Nachrichten keinen Gebrauch zu machen. (Er hatte mir vorgestern die Erlaubnis dazu gegeben). Hier mag der Fall wenigstens Platz finden. Wedekind hatte im Schauspielhaus eine Rede zum hundertjährigen Todestage Kleists gehalten. Diese Rede war in den „Münchner Neuesten“ abgedruckt, und man las mit Erstaunen darin eine Stelle, die etwa so lautete: „Bei der Angstmeierei der Parteien wird keine Zeitung es wagen, die Worte, die ich jetzt spreche, zu drucken.“ Man sagte sich: Aha, die Kuhhaut will Mut markieren und druckt es jetzt grade. Dann erzählte mir Wedekind, seine Worte hätten gelautet: „Bei der Angstmeierei der Sozialdemokraten und Liberalen ebenso wie der andern Parteien –“. Das hat er aber ändern müssen für die tapferen „Neuesten“. Aber doch die Angstmeierei! Also grade im Abdruck dieses Satzes, der ihn widerlegen soll, die Bestätigung! Es ist toll.
Gleichzeitig schickt mir Wedekind sein neues Stück „Franziska. Es modernes Mysterium in fünf Akten“. Georg Müller 1912. Er schreibt hinein: „Erich Mühsam, dem tapferen Kampfgefährten.“
München, Dienstag, d. 5. Dezember 1911.
Bei Bolz fand gestern abend eine Aussprache der „Komet“-Mitarbeiter statt, zu dem Zwecke, einen Solidaritäts-Trust gegen Redaktion und Verlag zu schaffen. Es nahmen teil: Ehrenberger, Bolz, Thesing und ich. Zugegen waren auch die Braut Ehrenbergers und Frl. Tarrasch, die von Bolz. Es wurden sehr trübe Meinungen über die Lebensaussichten des „Kometen“ laut. Angeblich soll garkein Geld mehr da sein, und Fuhrmann soll jede Nummer aus eigner Tasche bezahlen. Da aber das Geld seiner Frau gehöre, die nicht gern mehr herausrücke, sei die Gefahr des Bankrotts sehr groß. Es wäre scheußlich für mich, wenn diese 200 Mk wieder wegfielen. Der „Kain“ wäre wohl verloren, und die Hoffnung auf Ella müßte ich erst recht einsargen. Es wurde beschlossen, daß ich mit Fuhrmann privatim reden soll, um ihm den Nacken zu steifen, vor allem ihm begreiflich zu machen, daß es Irrsinn wäre, die 80000 Mk, die schon in dem Unternehmen drinstecken, jetzt, wo die Geschichte sichtlich besser wird und vorwärts geht, schießen zu lassen. Es gab guten Grogk bei der Unterhaltung, von dem ich reichlich trank und mich animieren ließ.
Nachher ging ich ins Luitpold. Oppenheimer hatte mir im Café gesagt, daß Heinrich Mann dort sein werde. Er belobte mich wegen des Kains und meinte, ich dürfe das Blatt unter keiner Bedingung eingehn lassen. Ich klopfte an, ob nicht etwa sein Bruder Thomas, der ja reich ist, die nötigen 3000 Mk herausrücken werde. Mann aber meinte, soviel werde er wohl nicht geben, einiges aber bestimmt. Da Thomas Mann Freitag bei Kutscher liest, werde ich wieder hingehn. Wir kennen uns ja noch garnicht persönlich.
Im Stefanie stieg wieder der Poker, der diesmal etwa 4 Mk Gewinn brachte. Doch ging das Geld drauf, da ich 2 Mk davon dem Puma Schulden zahlen mußte, und das übrige – und noch einiges – später mit ihr bei Kati Kobus ausgab. Wie sollen die Finanzsorgen nur in diesem Monat ausgehen? Schicke ich Ella das Reisegeld, so bleibt fast nicht übrig. Und doch: Dürfte ich's ihr nur erst schicken!
München, Mittwoch, d. 6. Dezember 1911.
Gestern nachmittag fand ich ein Telegramm aus Eisfeld vor: „Bin 8h 34 am Perron. Harda.“ Ich freute mich, die gute Margrit mal wieder sehn zu sollen. Nachmittags traf ich im Stefanie den Wiener Hollitzer mit seiner Tochter und Gertrude Barrison, die jetzt bei Benz tanzt. Wir saßen mit Roda Roda, mit dem ich dann noch Schach spielte. Dann zur Bahn. Margrit sah ganz gut aus, allerdings viel viel älter als ihre 29 Jahre. Sie war in Unterneubrunn beim Pfarrer Vogl gewesen, und mußte noch abends weiterfahren. Wir gingen erst ins Café Maria Theresia. Im letzten Augenblick kam sie noch auf die Idee, sie wolle Morax sehn, und so gingen wir im Galopp in den Simplizissimus, wo sie Morax blos die Hand reichen konnte und schon fortmußte. Wir waren sehr nett miteinander, und zum Abschied küßte sie mich mit ihrem bärtigen Gesicht auf den Mund. Herrgott, wie entsetzlich sich die Frau seit den lumpigen 2½ Jahren, seit sie hier bei mir war, verändert hat. Damals war sie ein junges, bildhübsches aufregendes Weib, temperamentvoll und sinnlich. Ich freue mich, daß ich sie in dieser Zeit noch gekannt, und so nah gekannt habe. Jetzt nähert sie sich immer mehr dem Typus einer früh alternden Proletarierin. Wünsche vermag sie nicht mehr zu wecken. – Nachdem sie abgereist war, ging ich ins Stefanie, wo ich mit Negoschann und Strich pokerte. Leider verlor ich schon wieder: 7,30 Mk. Dieser Monat wird furchtbar werden – Ich habe keine 20 Mk mehr. Denn heute habe ich an Ella 30 Mk Reisegeld abgeschickt, da ich fürchtete, es vielleicht morgen schon nicht mehr zu können. Aussichten, Geld zu kriegen, habe ich momentan garnicht. Wie das werden soll, ist mir höchst unklar. Dabei steht Weihnachten vor der Thür, wo doch allermindestens das Peterle was kriegen muß. Über Friedas Pläne weiß kein Mensch etwas.
München, Donnersstag, d. 7. Dezember 1911.
Nur kurz einiges Episodische, da ich erst abends um 9 Uhr zum Schreiben komme. Der Tag gestern wurde bestimmt durch ein merkwürdiges Intermezzo auf der Redaktion des „Kometen“. Ich brachte grade das aktuelle Gedicht für die nächste Nummer hin („Tante Eulalia“) und unterhielt mich mit Fuhrmann und Meier. Da kam ein junger Zeichner – ich glaube, er hieß Bauknecht – und legte ein paar Blätter vor. Fuhrmann und Meier lehnten sie ab. Fuhrmann meinte aber dabei, der Mann möge sich nicht abschrecken lassen und mal wieder etwas bringen. Der nahm seine Mappe und sagte: „Nein, Herr Fuhrmann. Bis heute ging es noch. Jetzt geht es nicht mehr weiter!“ Damit war er auch schon hinaus. Wir drei sahen einander an, und Meier sagte dann: „Sollte das heißen, daß man morgen seine Leiche finden wird?“ – Mir war sehr unbehaglich zu Mut. Ich wäre dem Menschen am liebsten nachgelaufen, aber ich hatte das im ersten Moment versäumt, und jetzt hätte ich ihn kaum mehr erreicht. Schließlich sagte ich mir: Wie oft sind an mir solche Stimmungen der vollkommensten Verzweiflung vorübergegangen. Auch der wird zu seinem Trost kommen in der Einsicht: Aus jeder Situation giebt’s einen Ausweg schon deshalb, weil der Augenblick selbst immer von einem neuen mit neuen Möglichkeiten abgelöst wird. Aber die Stimmung, die mir die heisere Drohung des armen enttäuschten Jungen hinterließ, hielt den ganzen Tag vor.
Von Fuhrmann aus ging ich zum Buchhändler Schüler, den ich um Material gegen Kausen bat. Er stellte mir allerlei zur Verfügung. Der eigentliche Grund meines Besuches war natürlich, mal anzuklopfen, ob nicht wenigstens 1000 Mk für den „Kain“ zu lockern wären, damit die Karre zunächst ein Jahr weiterfährt. Er winkte gleich ab, und wußte auch niemand, von dem er glaubte, daß er mir helfen würde. Nachher traf ich aber im Stefanie Kutscha. Der stellte für Weihnachten den Besuch eines reichen Freundes in Aussicht, der sich immer lebhaft für meine Produktion interessiert habe. Er meint, der werde wohl Geld für den „Kain“ hergeben.
Später kam ins Café Laura Rosenthals Sohn Erich mit einer Dame, der er mich als seinen Onkel vorstellte. Sie brauchte Rat. Sie hatte seit acht Jahren ein Verhältnis mit einem Leutnant v. Wiech, jetzt Redakteur der „Saison“. Der hatte ihr die Ehe versprochen und auch für ihr Kind, das schon vorher da war, gutgesagt. Er fing dann aber ein Verhältnis mit der Peppi aus dem Simplizissimus an (der „Traunsteiner Nachtigall“), und ließ die Braut ganz im Stich. Als sie einmal zu ihm kam, um ihm ihre Ansprüche vorzuhalten, brutalisierte er sie und wollte sie hinausschmeißen. Da nahm sie ein auf dem Tisch liegendes Dolchmesser und stieß es ihm in den Rücken. Ergebnis: 8 Monate Gefängnis, da das dumme Mädel, eine Modistin, namens Luise Kneffer, keinen Anwalt genommen hatte. Sie hatte sich eingebildet, sie könne Berufung einlegen. Das geht ja aber unter unsern gesegneten Rechtsverhältnissen nicht, und die von Bernstein eingelegte Revision, die sich nur auf Formfehler erstrecken konnte, wurde verworfen. Über diese Revisionsverwerfung hatten die M. N. N. eine Notiz gebracht, in der es hieß, W. sei ihr früherer Liebhaber gewesen. Dadurch fühlte sich das arme Wesen gekränkt, da er ihr ja die Ehe versprochen hatte und sie also richtig mit ihm verlobt war. Ich formulierte ihr eine Berichtigung. Außerdem versprach ich ihr, mich nach der Adresse des Vaters ihres Kindes zu erkundigen, eines Ingenieurs Körting aus Hannover. Ich glaubte, ich werde Körting auf der Kegelbahn treffen. Er war aber leider abgereist. Das tut mir sehr leid, denn, wenn die Angaben der jungen Dame richtig sind, hätte sie bei dem Vater ihres Kindes finanzielle Hilfe zu erhoffen. Der Herr v. Wiech soll vor Gericht gesagt haben, in den „Simpl“ gehe er nicht etwa wegen der Sängerin, sondern wegen geistiger Anregung, die er dort z. B. in der Gesellschaft von Roda Roda finde. Heut war ich bei Rodas zu Tisch eingeladen. Dabei stellte sich heraus, daß Roda den Kerl garnicht kennt. Ich werde diese Tatsache der Dame natürlich nicht mitteilen, da ich nicht wünsche, daß jemand durch mich ins Zuchthaus kommt. An dem Urteil gegen das Fräulein würde ja auch die Bestrafung des Kerls garnichts ändern.
Nach dem Kegeln pokerte ich wieder mit Strich, dem Puma und Negoschann und verlor weitere 3 Mk.
Bei Rodas war es sehr nett. Roda ist ein lieber Kerl. Er pumpte mir, ohne daß ich ihn gebeten hätte, 20 Mk. Auch riet er mir, was Heinr. Mann mir neulich schon empfahl, den „Kain“ durch Aktien sicherzustellen. Ich glaube nicht, daß ich diesen sehr wenig aussichtsvollen und sehr qualvollen Weg beschreiten werde. Von Hans ein Brief, in dem er Papas Meinung noch einmal wiederholt und seinerseits den „Kain“ langweilig und schlecht findet. Er beruft sich dabei auf lauter autoritative Namen, Dr. Wolf, Dr. Wertheim, Dr. Cohn u. s. w. und Frau Eppstein. Ich soll wissen, wer Frau Eppstein ist! Frau Eppstein ist enttäuscht von dem Blatte. Also muß ich die Tendenz ändern!
Heut fing ich endlich den letzten Artikel für den „Kain-Kalender“ an „Volksfestspiele“. Ich hoffe mich morgen dazu aufzuraffen, ihn fertig zu schreiben. Es wird Zeit. Im Café traf ich nachher Uli und Lotte. Beide sehn entzückend aus. Lotte berichtete etwas betreten, daß die Gräfin Frigga von Brockdorff sie „interviewert“ habe, und daß ihr Gespräch mit ihrem Bild und etlichen Puppenphotograpieen in „Über Land und Meer“ stehn würden. Sie ängstigte sich sehr, daß ich sie auslachen werde. Aber ich tat nichts dergleichen und beichtete ihr dann, jetzt meinerseits sehr verlegen, daß im „Kain“ Gedichte an E. B. stehn. Sie wollte sich totlachen, und ist gleich zu Strich hinuntergefahren, um sie zu lesen. – Hoffentlich erfüllt sie mir bald das Versprechen auf ein Piacere!
München, Freitag, d. 8. Dezember 1911.
Es ist wirklich komplette Verrücktheit: wieder gespielt und wieder verloren – 6 Mk. Jeden Abend die alte Geschichte. Der üble Slowak streicht unser aller Geld ein. Dabei hat ihn jeder von uns im ernstesten Verdacht, daß der Kerl Falschspieler sei. Nur haben wir ihn noch nicht direkt fassen können. Allerlei Kleinigkeiten leistet er sich jeden Abend beim Spiel. Gestern beschiß er mich offensichtlich um 40 Pfennige. Bei einem zweiten Versuch wurde ich grob. Wir könnten ja einfach aufhören, mit dem Burschen zu spielen, aber jetzt hoffen wir natürlich alle, noch einmal etwas von den verlorenen Geldern wiederzusehn, – oder aber ihn beim Falschspiel zu erwischen.
Zu notieren ist noch ein Gespräch mit Sidonie Lorm, die ich nachmittags im Café traf. Sie ist jetzt am Lustspielhaus, und erzählte mir, daß sie fort möchte, daß sie aber noch 2 Jahre Kontrakt habe und Robert sie nicht gehn lassen will. Mich interessierte das natürlich ungeheuer. Robert muß sie gehn lassen und muß an ihren Platz Ella Barth engagieren. Ich habe Ella den „Kain“ mit den Gedichten geschickt, die ich in die in jede Ecke der Seite geschriebene Aufforderung „Komm!“ einrahmte. Ich warte sehr gespannt auf ihre nächste Nachricht.
Gestern abend hatte ich den Besuch von zwei jungen Anarchisten, die mir sehr gefielen. Besonders der Ältere, ein gewisser Theodor Deigele, der früher schon einmal bei mir war, macht einen ausgezeichneten feinen differenzierten Eindruck. Ein temperamentvoller kluger Mensch. Mehr solche – und die Gruppe Tat wird sich wieder zeigen können.
München, Sonnabend, d. 9. Dezember 1911.
Von Ella immer noch kein Bescheid. Ich habe vor einigen Tagen schon mit der Wirtin verhandelt. Sie will mir das Nebenzimmer, aus dem Frl. Hell ausgezogen ist, für 110 Mk mit voller Pension lassen, sodaß die Rechnung für uns beide inclusive Licht 250 Mk betragen wird. Bleibt es dabei, daß ich die 80 Mk monatlich abliefern muß, wozu 45 für Johannes kommen, so geht am 1ten regelmäßig genau alles weg, was ich dann kriege. Aber ich darf und will nicht rechnen. Ella soll kommen, ganz gleich, wie sich wirtschaftlich die Dinge anlassen werden. Auch sehe ich freundliche Ausblicke. 250 Mk kommen aus Karlsruhe, sobald nur das Buch fertig ist, und mieten wir uns eine gemeinsame Wohnung, in der wir gemeinsam wirtschaften, so brauchen wir die 250 Mk, die uns zur Verfügung stehn, garnicht auf, und haben genug zu Vergnügungen etc. übrig. Käme sie doch! Ich will ihr heute noch einmal schreiben.
Gestern mittag erschien Albert R. bei mir, auf der Reise mal wieder. Ein prachtvoller Kerl, dem ich ein besseres Leben wünschte als er eins führt. Wir gingen ins Stefanie, wo wir Meyrink trafen. Der hat mit Roda Roda sich einen künstlichen Kropf patentieren lassen. Er erklärte ihn mir so: Der Kropf ist aus Leder, wird mit rosaseidnen Bändchen umgebunden und hat die Inschrift „Dulce et decorum est pro patria morir“. Damit soll eine Serie von Verhöhnungen gegen die Alpenkunst eingeleitet werden. Der Einfall ist jedenfalls sehr niedlich. – Meyrink erkundigte sich dann bei Albert nach den Bedingungen, wie man Schweizer Bürger wird. Er hat einen vierjährigen Sohn, und damit der einmal nicht Soldat zu werden braucht, will Meyrink ihn Schweizer werden lassen. Da er in Deutschland leben wird, kann ihn auch die Schweiz nicht zur Miliz heranziehn. Ein sehr kluges Verfahren, dem Militär Soldaten zu entziehn, das man unter der Hand eifrig empfehlen sollte. – Ich habe R. dem „Kometen“ als Schweizer Vertreiber empfohlen. Vielleicht legt er sich allmählich ganz auf den Buchhandel. Sein Beruf ist doch garzu gefährlich, und passiert ihm etwas, so ist er monatelang arbeitsunfähig und die Familie dem Hunger preisgegeben.
Abends war ich wieder bei den Kutscher-Studenten, wo Thomas Mann aus seinem neuen unvollendeten Roman „Memoiren des Hochstaplers Felix Krull“ vorlas. Ich lernte ihn bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal persönlich kennen. Wir hatten nur einmal – vor einem Jahr, als es sich um meinen Protest in der „Zukunft“ handelte, korrespondiert. Gesehn hatten wir uns oft, und ich erinnere mich seiner sogar noch vom Schulhof des Lübecker Katharineums her. Er gefällt mir sehr gut, wenn er auch im Exterieur keineswegs den distinguierten Eindruck macht wie Heinrich Mann. Aber er ist klug, differenziert, sehr geschmackvoll im Reden und Gesten und liest sehr gut, wenn auch ein wenig geziert lübeckisch. Was er las, ist überaus fein und klug. Zwei kurze Abschnitte aus den Jugenderinnerungen des Hochstaplers. Sein erster Theaterbesuch und die exakte Schilderung, wie er sich, um die Stunde schwänzen zu können, krank stellt. Beide Abschnitte brillant stilisiert, voll feiner Ironie und doch wieder voll starker Leidens-Confession.
Ich ging nachher noch in die Torggelstube, wo Lotte, Strich, der unvermeidliche „Cronos“ – man sehnt sich nach Sörgel – und ein Freund von ihm, ein Einjährig-freiwilliger Jude, mit Strichs Miniatur-Karten pokerten. Ich beteiligte mich und gewann wirklich 80 Pfennige. Meine Abneigung gegen den Herrn Cronos bekam zum ersten Mal Gelegenheit, laut zu werden. Der Kerl machte, den „Kain“ in der Hand, dumme Bemerkungen über die Gedichte an E. B. Ich wurde saugrob und warf ihm Taktlosigkeit vor. Wie er über meine Gedichte urteile, sei mir ganz wurscht, aber ich verbitte mir Kritiken in meiner Gegenwart. Er provozierte und sagte mir draußen noch, ich dürfe nun auch mal gegen ihn taktlos sein. Da ich aber lieber die Distanz zwischen uns erweitert als verengert sähe, antwortete ich kurz: „Das liegt nicht in meiner Art“. Die Stimmung war etwas beklommen durch das Intermezzo. Wir fuhren noch ins Stefanie, von wo die andern bald aufbrachen, während ich noch mit dem kleinen Taubmann Billard spielte.
Wedekinds „Franziska“ habe ich nun gelesen, und kann vorerst – ich werde es baldigst zum zweiten Male lesen müssen – nur sagen, daß ich sehr erschüttert und ergriffen bin von der Genialität dieses Werks. Nach Wedekinds letzten Arbeiten schien es, als hätte eine Stagnation in seiner Produktivität eingesetzt. Dieses neue Werk ist das genialste, kühnste, stärkste, was er überhaupt geschrieben hat. Natürlich ist es kein Drama, wie „Erdgeist“, „So ist das Leben“ oder „Hidalla“. Aber eine Dichtung von gewaltiger Inbrunst und Schönheit. Die Symbolistik ist eindringlich, die Sprache schön, die Verse am rechten Platz. Daß ein Herzog, ein Drachen, ein Polizeipräsident und allerlei Huren vorkommen, ist gewiß merkwürdig. Aber warum sollte es nicht in einem „modernen Mysterium“ erlaubt sein? Der ganze Vorwurf: das Faustproblem an einem Weibe dargestellt, ist sehr groß gedacht und sehr groß durchgeführt. Mit mancherlei Sentenzen stimme ich nicht überein. Aber es ist mir sehr interessant und wichtig, die vielen Dinge, die ich Wedekind oft in der Unterhaltung bestritt, hier in seiner endgiltigen Formulierung wiederzufinden. So den Gedanken: die kluge Frau wird schließlich und endlich einem Manne treu sein, dem der sie heiratet. Denn sie muß sorgen, daß ihre Kinder ein Dach über dem Kopf haben. – Ich gehe mit einer Dramenidee um „Treue“. Komme ich dazu, das Stück zu schreiben, so wird Wedekind auch meine gegenteiligen Formulierungen noch deutlicher erfahren als aus den „Freivermählten“.
Eine Menge Studenten wenden sich an mich wegen Einladungen zu den Zusammenkünften der Gruppe Tat. Erst eben war ich mit einem beisammen: Alfred Henschke, der Gedichte schreibt – ich kenne sie noch nicht, und einen etwas kindlichen aber ganz netten Eindruck macht. Ich freue mich, doch hier und da Spuren eines echten Idealismus zu finden. Vielleicht läßt er sich konservieren, wenn die junge Begeisterung rechtzeitig revolutionäre Nahrung erhält.
München, Sonntag, d. 10. Dezember 1911.
Von Ella immer noch nichts. Ich bin sehr nervös, da ich garkeinen Anhalt habe, ob ihr Schweigen für mich Gutes oder Schlimmes bedeutet. Ich sehne mich sehr nach ihr. Eine Frau dauernd um mich, das wäre wohl ein Glück für mich. Ich bin wieder mal sehr hungrig nach Liebe. Seit mehr als einem Monat war keine einzige bei mir, und des Consuls Küsse habe ich auch lange entbehren müssen.
Gestern telefonierte ich Heinrich Mann an. Er bedankt sich für meinen Artikel „Respekt vor Dichtern!“ und erzählte, daß sich Dr. Robert daraufhin schon wegen der „Schauspielerin“ mit ihm in Verbindung gesetzt habe. Wir verabredeten uns ins Stefanie, und zu meiner Überraschung berichtete Mann, auch Rößler werde hinkommen. Er kam auch und lud uns in den Englischen Hof zum Abendbrot ein, wo er mit Consul, die dort als seine Frau gilt, abgestiegen war. Nachher fuhren wir alle zu Benz hinunter, wo Rößler Sekt kommen ließ. Im Hotel hatte ich eine Gelegenheit, wo Rößler sich mit Mann zu einer Privat-Unterredung zurückzog, benutzt, um Consul zuzusetzen, mit mir Rößler zu betrügen. Sie verhielt sich merkwürdig verwirrt demgegenüber, und meinte, Rößler sei so nett zu ihr, daß es ihr leid tun würde. Ob ich mir das jetzt ganz aus dem Kopf schlagen muß? – Da die beiden schon heute früh nach Berlin abfahren mußten, wo in 14 Tagen die Premiere der „fünf Frankfurter“ sein wird, verließen sie uns bei Benz bald wieder und ich blieb mit Mann in guten Gesprächen allein. Nachher kam Peppi Kirchhoff mit einem sehr jungen eleganten Juden. Wir begrüßten uns und nach einer Weile ließen wir die beiden an unsrem Tisch Platz nehmen. Der Jüngling heißt Auerbach, ist 19 Jahre alt und studiert Jura. Er redete altklug daher, machte mir aber einen angenehmen Eindruck. Peppi verliebte sich inzwischen Hals über Kopf in Heinrich Mann, in dem sie Ähnlichkeiten mit dem Wiener Architekten Loos fand. Heut vormittag schon rief sie mich an. Sie wolle mit ihm wieder zusammen kommen. Nun werde ich also wieder in die lächerliche Situation kommen, ein Mädel, das ich selbst haben möchte, an einen Freund zu verkuppeln. Nachher werde ich sie natürlich kriegen, und ich sehe schon kommen, daß Heinrich Mann in die Reihe der von mir betrognen Liebhaber eintreten wird.
Als ich heut mittag nach Hause kann, fand ich in meiner Stube Strich und Lotte vor, die zum Essen dablieben. Ich setzte ihnen meine Ansicht über den „Cronos“ auseinander. Sie verteidigten den Burschen aber, und so werde ich wohl abwarten müssen, bis er ihnen selbst so auf die Nerven gehn wird, daß sie ihn abschieben. Lange kann es ja nicht dauern. Als ich heut mit Uli über ihn sprach, war sie völlig meiner Meinung, daß er dumm, taktlos, geschmacklos, unbenervt und langweilig sei. Das Puma hat manchmal so seltsame Freunde. Sie wird ihn einmal ins Bett nehmen und dann laufen lassen.
München, Montag, d. 11. Dezember 1911.
Endlich ist von Ella Mitteilung da: keine erfreuliche für mich. Sie wird wahrscheinlich eine Einladung von Karlheinz Martin zu einer Italienreise annehmen, und dann erst im Februar zu mir kommen. Inzwischen soll ich das Engagement bei Robert „festigen“. Das gute Kind macht mir das Leben recht sauer. Wie soll ich ihr denn das Engagement festigen, ehe sie sich nicht persönlich vorgestellt hat? Na, ich will sehn, was ich tun kann. Möglich ist es auch, daß sie schon Ende der nächsten Woche kommt, wenn nämlich aus der Reise mit Martin nichts wird. Ich weiß nicht recht, was ich wünschen soll. Zerschlägt sich die Reise, so ist das gewiß mein Vorteil, aber sie wird traurig – und vielleicht gegen mich unliebenswürdig sein. Das muß ich aber auch fürchten, wenn sie den Geliebten verläßt und aus praktischen Gründen zu mir kommt, den zu lieben ich sie ja erst lehren muß. Also wünsche ich ihr schon altruistisch das, was sie sich selbst wünscht.
Gestern abend gingen merkwürdige beängstigende Gerüchte um. Emmy sollte sich erschossen haben. Nachher hieß es, nein: sie habe Krämpfe gehabt und sei in die chirurgische Klinik gebracht worden. Abends war sie aber im Simpl, etwas verstört und angegriffen, aber ganz gesund. Über ihre Erlebnisse ließ sie sich nicht aus. Wahrscheinlich hat sie in Gegenwart eines Mannes einen hysterischen Anfall gehabt. Der wußte nicht, was das bedeutet, nahm es tragisch und allarmierte Ärzte. Die Hauptsache ist, daß es ihr anscheinend ganz gut geht.
Heut mittag war Muschi bei mir. Auf diese Weise kam ich mal wieder zu einigen Küssen. Nachher kam das Puma hinzu, und Muschi zeigte uns auf Wunsch ihre Beine, die ganz wundervoll dünn und grade sind.
Im Café war ich vorhin mit Meyrink beisammen. Sehr amüsantes Gespräch. So psychologisierten wir über Wedekind. Meyrink fand, er komme ihm vor wie ein Lustmörder, und so wolle er ihn auch in einem Drama auftreten lassen. Er könne sich nie das Verdachts erwehren, Wedekind sei damals Jack der Aufschlitzer gewesen. Eine echt Meyrinksche Idee. Aber interessant ist mir, daß ich mich eines Gesprächs mit Donald Wedekind erinnere. Er schimpfte mal wieder über seinen „literarischen Bruder“ und sagte dabei: „Frrrank ist ein Lustmörrder!“ ...
Nachher sprach ich mit Uli. Thesing hat ihr einen jungen Teckel geschenkt, über den sie sehr glücklich ist. Sie ist wieder in einer ganz reizenden Periode. Sie war noch kaum je so schön wie jetzt. Ich liebe sie immer noch leidenschaftlich.
München, Dienstag, d. 12. Dezember 1911.
Ich sehe der Zukunft mit großen Sorgen entgegen. Der „Komet“ scheint nur noch auf ganz schwachen Beinen zu stehn. Diro Meier giebt zu, daß er jeden Tag eingehn kann. Nun habe ich zwar Kontrakt aber ohne Zeitdauer, und ich fürchte, wenn es zum Klappen kommt, werde ich erst lang und breit prozessieren müssen, ehe Geld herausschaut. – Um über diesen Monat hinwegzukommen, habe ich Caro gebeten, die Deutsche Montagszeitung auf die 100 Mk zu verklagen, die ich immer noch von dort zu kriegen habe. Gleichzeitig habe ich an die Gesellschaft selbst geschrieben, und ersucht, sie möchten, um die Gerichtskosten zu sparen, das Geld doch postwendend schicken. Viel Hoffnung habe ich nicht. – Geht der Komet wirklich ein, dann adjö, Kain! – adjö Ella! – Neulich bei Benz stellte mich ein junger Mann, der Steinthal heißt und jetzt Chefredakteur der „Deutschen Montagszeitung“ ist. Er versicherte mir, daß der jetzige Verlag mit dem früheren garnichts zu tun habe und prompt bezahle. Ich möchte doch wieder meine „Pudel“-Gedichte schicken. Die Sache wäre zu erwägen. Auch den „Pan“ muß ich rechtzeitig poussieren, und jetzt zunächst intensiv an die Arbeit gehn, daß das „Scheinwerfer“-Buch rechtzeitig fertig wird. Dann ist mindestens die Januar-Nummer des „Kain“ wieder garantiert, auch wenn der „Komet“ nicht zahlt. Der Kain-Kalender ist im Manuskript gottlob fertig. Donnerstag soll ich sämtliche Korrekturen haben.
Das Deutsche Theater in Cöln schickt mir das Manuskript der „Freivermählten“ zurück. Ein Brief dabei. Man hätte das Stück dort sehr gerne gespielt, doch mache die Zensur jetzt zu große Schwierigkeiten, als daß man daran denken könnte. Das Verbot meines Stückes ist danach nicht ausgesprochen. Das hatte nur August Weigerts Phantasie ausgeschwitzt. Aber ein infames Pech habe ich schon, und solange der Vater lebt, wird auch dies Pech leben.
Jetzt gehe ich zu Heller, um ihm die „Freivermählten“ zu bringen, auf daß er sie Frau Stolberg weitergebe. Ich will durchaus jeden Versuch machen mit der Arbeit. An meiner Nachlässigkeit soll der Erfolg nicht scheitern.
München, Mittwoch, d. 13. Dezember 1911.
Heller traf ich nicht zu Hause. Er hatte mir einen Brief hinterlassen, worin er sich sehr höflich und nett entschuldigt und mir verspricht, alles für mein Stück zu tun, was in seinen Kräften stehe. Hoffentlich glückt’s ihm. Jedenfalls muß ich in diesen Tagen noch mal zu ihm, da Rößler mir erzählte, „die fünf Frankfurter“ hätten noch keinen genügenden Schluß. Ich versprach ihm, mich anzustrengen, um einen zu finden. Gelingt’s mir, dann soll ich 50 Mk haben. – Bei der Redaktionssitzung des „Kometen“ brachte ich als Ausnahmsleistung eine Anekdote an, die ich für 5 Mk an Bolz verpfändete. Wie dieser Monat weiter gehn soll, ist mir schleierhaft – zumal Weihnachten vor der Tür ist. Na, vielleicht funktioniert der Kutscha-Freund. Zahlt der 1000 Mk für den „Kain“ ein, so erhalte ich die 80 Mk von Steinebach zurück.
Abends war ich bei Artur Kutscher eingeladen. Die Gesellschaft bestand nur aus Herren, und zwar: Wilm, Friedrich Huch, Jodocus Schmitz, ein Dr. Happe und ein Neffe von Wedekind, der auch Wedekind heißt. Es gab sehr schmackhaftes einfaches Abendbrot mit Bier, Wein und Schnaps. Die Unterhaltung war stellenweise ganz amüsant. Zum Schluß wurden Verse vorgelesen, von Matthias Claudius, von Brentano und ein paar Balladen von Göpping (oder Göcking?), einem vorgoethischen Dichter von köstlicher unfreiwilliger Komik. Ich wurde genötigt, meine Altonaische Romanze und die Amanda vorzutragen. Ich kam später mit Schmitz und dem jungen Wedekind noch ins Stefanie, und machte schließlich noch Emmy und Fränze Szenen, weil sie nicht mit mir schlafen gehn wollten. Ich war reichlich betrunken.
München, Donnerstag, d. 14. Dezember 1911.
Meine Situation wird allmählich sehr beängstigend. Das Geld geht ganz auf die Neige, und ich weiß garnicht mehr, wo ein, wo aus. Eben habe ich Dr. Thoma in Tegernsee antelefoniert. Ich will ihn bitten, mal mit dem alten Hirth zu sprechen, ob er vielleicht das Geld für den „Kain“ herausrückt. Montag mittag um 12 Uhr soll ich auf die Redaktion des „Simplizissimus“ kommen, wo er sein wird. – Außerdem suche ich Heller zu erwischen. Vielleicht gelingt es mir, einen Schluß für die „5 Frankfurter“ zu finden. Dann bekomme ich von Rößler Geld. Weder Caro noch die Montagszeitung melden sich bis jetzt. Vermutlich verbummelt Caro die Klage, wie er alles verbummelt, und der Verlag wird damit rechnen und es drauf ankommen lassen. Wie soll das alles werden? Dabei ängstige ich mich schon wieder um Johannes, von dem seit Wochen kein Wort kommt. Meine Stimmung ist sehr bedrückt, und natürlich leidet darunter auch meine Arbeitslust. Stürbe doch um Gotteswillen mein Vater! Aber der scheint mir partout den Vortritt lassen zu wollen.
Gestern lud ich Kanders zum Abendbrot in die „3 Raben“ ein. Auch Uli und Seewald waren dabei. Nachher ging ich kegeln, wo ich Halbe 3 Mk, die ich kürzlich für ihn ausgelegt hatte, abnahm. Sie gingen gleich wieder drauf. Nachher im „Simpl.“ sprach er mir seine Freude aus über meine Besprechung seines Romans. Es ist merkwürdig, welche Wichtigkeit er solcher Kleinigkeit beilegt. Lotte sah ich in den letzten Tagen fast garnicht, da ich die Torggelstube, wo sie jetzt allabendlich mit Strich sitzt, wegen des Dalles meiden muß. Es kommt immer alles zusammen: kein Geld, keine Liebe und Pech über Pech.
München, Sonnabend, d. 16. Dezember 1911.
Nachtragen möchte ich noch vom Mittwoch her ein Gespräch mit dem jungen Grafen Keyserlingk, dem Neffen des Schriftstellers, der mit uns im Simpl. saß. Ich sprach mit ihm über Tolstoj, Turgenjeff, Andrejew und andre revolutionäre Russen. Er zeigte lebhafte Sympathie für die Revolution und erzählt mir von mehreren Attentaten auf den Zaren, die ungeheuer kühn unternommen waren, aber durch vage Zufälle vereitelt wurden. Einmal war eine Auster vergiftet worden. Als sie ihm serviert wurde, ließ er scherzhafterweise den ihm bestimmten ersten Austernteller einer kleinen jungen Prinzessin reichen. Sie starb. Ein ganz ähnlicher Versuch wie seinerzeit bei Alexander II. soll auch gegen Nikolaus gemacht sein, daß nämlich sein Zimmer unterminiert wurde. Die Explosion sei auch erfolgt. Doch hatte der Zar, da ein Prinz sich verspätete und die ganze Hofgesellschaft warten ließ, den betreffenden Raum noch nicht betreten. Keyserlingk behauptete diese Dinge absolut sicher zu wissen. Sie würden aber sehr verheimlicht. Wir sprachen lange über das russische Volk und die revolutionären Hoffnungen in Rußland. Ich hatte den Eindruck, der junge Graf kokettiere etwas mit den revolutionären Ideen. Aber schließlich ist ja in jeder Pose ein echter Antrieb, und mir ist die Pose nach dieser Richtung immerhin weitaus sympathischer als die umgekehrte, für die als Beispiel mein alter Hardy mal wieder in München eingerückt ist. Ich war vorgestern mit ihm und Emmy im Stefanie beisammen, und er erklärte, er halte es jetzt mit der Reaktion und gegen die Humanität. Er trug auch ein bezügliches Buch bei sich. Ich sprach ihm von Überzeugungen, und daß er davon nichts verstehe. Aber wir blieben friedlich. Ich habe ihn ja doch sehr sehr gern.
Donnerstag abend war ich in der Torggelstube mit Robert und der Roland beisammen. Ich soll Robert meine „Freivermählten“ einreichen. Nachher kam Sobotka hinzu. Mit dem ging ich fort, und er begann, mir die ganze Themidore-Angelegenheit und seinen Ärger mit Roda Roda sehr ausgiebig auseinanderzusetzen. Er begleitete mich noch zu Fuß bis an die Akademiestrasse, obwohl er in einer ganz andern Richtung wohnt, und ich dachte mir, bei einem millionenschweren Verleger soll man nicht ungeduldig werden. Meine „Freivermählten“ habe ich ihm dann auch schon schicken können.
Gestern war Redaktionssitzung des „Kometen“. Es gab die erfreuliche Botschaft, daß Diro Meiers Onkel ihm sein Kapital von 30000 Mk freigeben werde, sodaß das Blatt wieder für ein viertel Jahr gesichert ist. – Übrigens war meinem Dalles gestern früh schon durch den kleinen Hörschelmann mit 20 Mk aufgeholfen worden, dem ich dafür leider das Widmungsexemplar des Wedekindschen „Feuerwerks“ geben muß. Da ich es nicht finden kann, werde ich wohl „mit allen Wassern gewaschen“ hergeben müssen. Schade.
Abends war die Weihnachtsfeier der Kutscher-Studenten, und es war sehr nett und lustig. Als literarische Gäste waren außer mir noch Max Halbe und Karl Henckell dort, und mir fiel die Aufgabe zu, Kutschers Rede auf uns zu erwidern. – Nachher Torggelstube. Dort traf ich Halbe, der vor mir fortgegangen war, mit Waldau, den Grafen Keyserlingk, Gotthelf, Seyffert und einem Professor Meyer. Gotthelf hatte ein Mädel bei sich. Nach und nach konzentrierten sich Halbe und dann ich in den Nebenraum zu Wedekind. Halbe machte mir Vorwürfe, weil ich mich nicht um den Fastenrath-Preis beworben habe. Ich habe es unterlassen, weil Fulda dort im Ausschuß sitzt, und ich den seinerzeit in Nr 1 des „Kain“ scharf angegriffen hatte. Es kam mir unreinlich vor, ihn für mich zu stimmen, da er doch wahrscheinlich den Artikel nicht kennt. Halbe meint aber, persönliche Dinge spielten garkeine Rolle. So werde ich also noch nachträglich schreiben, werde aber in diesem Jahr wohl sicher nicht mehr berücksichtigt werden. Halbe fuhr mich dann im Regen heim.
Ein Brief von Johannes ist gestern gekommen. Leider wieder sehr Unangenehmes. Im Leumundszeugnis der Polizei, das er zur Immatrikulation braucht, steht drin, daß gegen ihn zwei Verfahren wegen Betrugs und Unterschlagung anhängig sind. Das eine geht von dem Herrn Trinkl, unsrem früheren Wirt in der Kaulbachstrasse aus, dem er seinerzeit die Miete nicht gezahlt hat. Natürlich muß ich jetzt hin zu dem Mann und die Sache ins Reine bringen. Ich will nur erst warten, bis Wolfskehl wieder da ist. Der muß helfen. Ich kann zur Zeit nicht.
München, Sonntag, d. 17. Dezember 1911.
Vorgestern – dies vergaß ich bei der gestrigen Registrierung – hatte ich Tischbesuch: Frl. Frieda Wiegand. (Daß die verfluchten Weiber immer ausgerechnet Frieda heißen müssen!) Ich hatte sie im Stefanie getroffen und dann mitgenommen. Sie tanzt im Kleinen Theater und möchte gern auch rezitieren. Ich gab ihr einen Brief an die Beutler, damit die ihr einige von ihren Gedichten gäbe. Natürlich küßte ich das Mädel weidlich ab; als es aber weitergehn sollte, stellte sich heraus, daß sie natürlich grade Periode hatte. Immerhin: ich glaube nicht, daß ich lange auf sie werde warten müssen.
Gestern spielte ich im Stefanie mit Gotthelf Schach. Dann fuhren wir zur Au, wo der Beleidigungsprozeß Possart gegen Bonn verhandelt werden sollte. Bonn hatte sich der Reklame wegen vorführen lassen. Leider war der Saal, als wir kamen, schon überfüllt, sodaß wir nicht hineinkonnten. Natürlich endete die Geschichte mit einem Vergleich. Es wäre aber amüsant gewesen, die drei Schmierenkomödianten Possart, Bonn und Oberlandesgerichtsrat Mayer zugleich am Werk zu sehn.
Abends ging ich in die Torggelstube, wo ich nur den Professor Meyer antraf, einen unsagbar öden Gesellen. Ehemals Literaturhistoriker, dann Architekt, dann Maler, jetzt Komödienschreiber. Er erzählte mir in bayerischer Langsamkeit und Undeutlichkeit, wie er dazu gekommen ist, das Stück, das er in Arbeit hat, zu schreiben, und als er glücklich weg war, und Lotte mit Strich kamen, konnte ich die noch lange mit Rekapitulationen der Meyerschen Fadheiten ergötzen. Auf dem Wege zum Stefanie gab es zwischen dem Puma und Strich – natürlich wegen einer Nichtigkeit – eine Szene. Lotte fühlte sich durch eine kritische Bemerkung Strichs heruntergesetzt, und es war sehr peinlich. Erst im Stefanie beruhigten sich die Gefühle, und wir pokerten – diesmal mit der langen Karte. Negoschann verlor, an uns alle, an mich allein 7 Mk 40, im ganzen 27 Mk. Natürlich zahlte er nachher keinen aus. Ich bin neugierig, ob wir zu unserm Geld kommen werden.
Heut mittag war ich im Stefanie. Zuerst saß ich mit Uli und Seewald. Dann sah ich im andern Raum Hardy und Emmy sitzen. Ich ging zu ihnen. Ich sprach – im Anschluß an ein Zitat, daß ich zufällig in einem Hardekopf gehörenden, auf dem Tisch liegenden Buch aufgeschlagen hatte, über die Anmaßlichkeit der Menschen immer sich als die „höheren“ Wesen auszugeben, da doch garkeine Norm für hoch und tief da sei, und die Wasserlaus in ihrer Art durchaus so „hoch“ stehe, wie der Mensch in seiner. Plötzlich unterbrach Hardy mich und fragte, ob ich nicht einverstanden sei, wenn wir in anständiger Form voneinander Abschied nähmen. Unsre Freundschaft, die einst für ihn ein sehr großes und tiefes Erlebnis gewesen sei, sei doch jetzt geborsten, und er finde, wir banalisierten sie durch die Fortsetzung der Beziehung. Er schlug also vor, daß wir uns nicht mehr kennen sollen. Ich war natürlich sehr konsterniert, und erklärte ihm dann, ich würde eine solche Trennung, wenn er sie wünsche, ja nicht hindern können, sie komme mir doch aber sehr als Pose vor. Ich könne in einer Freundschaft nichts sehn, was man erst gründen und dann wieder abtragen könne, und wenn ich jetzt aufstände, ihm die Hand drückte und sagte: Leb wohl! und frohes Gedenken! – so wüßte ich nicht, ob ich dabei lachen oder weinen solle. Er meinte, er stehe mir jetzt ganz anders gegenüber. Den „Kain“ finde er garnicht gut und er wolle die Freiheit haben, eventuell auch mal gegen mich zu schreiben. Ich bat ihn, das nur zu tun, das seien Dinge, die den öffentlichen Kritiker bzw. Dichter, nicht die Freunde angehn. Im übrigen glaube ich, daß er heute kratzbürstig sei, morgen vielleicht, übermorgen ganz sicher anders urteilen werde, und bat ihn, falls sein Entschluß stehn bliebe, möchte er zu mir kommen, damit wir in Ruhe und ohne Zeugen darüber reden könnten. Jetzt sei ich in einer sehr peinlichen Situation, da ich harmlos und freundschaftlich an seinen Tisch gekommen sei und nun durch die plötzliche Ankündigung des Bruchs mich gedemütigt fühle. Emmy verhielt sich sehr nett dabei. Hardy fragte sie einmal, ob er nicht recht habe. Darauf fragte ich sofort auch, ob nicht ich recht habe, und Emmy meinte: „Ja, wenn man euch so hört, habt ihr eigentlich beide recht.“ – Wie seltsam doch dieser Hardekopf ist. Ich weiß, daß seine große Ehrlichkeit die Konsequenz seiner Gefühle verlangt. Ich zweifle aber an der Ehrlichkeit seiner Gefühle überhaupt.
München Montag, d. 18. Dezember 1911.
Die Auseinandersetzung mit Hardekopf geht mir doch sehr nah. Als ich gestern nachmittag Emmy allein im Café traf, platzte ich los. Ich erkannte plötzlich, daß hinter dem ganzen Gehaben schließlich Eifersucht steckt, und das kränkt mich sehr. Eine Freundschaft, die an der Eifersucht wegen Emmy kaput geht! Den eigentlichen Knacks erhielt sie ja eigentlich wegen Lotte. Gegen sie hat Hardy sich ganz unschön benommen, aber ich war ihm nicht böse, weil er zu dieser Frau, die ich gewiß so sehr liebe wie er Emmy, zu liebenswürdig gewesen wäre, sondern weil er der Herrlichkeit ihrer Liebe, die ihm Jahre hindurch gehört hatte, sich nicht gewachsen zeigte, als sie zu Ende war. Aus Feigheit und Pose setzte sich damals sein Benehmen gegen Lotte zusammen. Ich werde es nicht vergessen, wie sie sich damals an ihm rächte, indem sie noch einmal eine Reise mit ihm machte, um ihm zu zeigen, wer sie eigentlich sei. Er hat es nicht gemerkt, auch dann noch nicht. Er hat sie mit dämonischen Zutaten aus seiner Phantasie versehn, und damit verkleinert, daß er sie vergrößern wollte. Ich holte sie von der Bahn ab, die beiden, und mußte mich sofort mit Lotte in den Zug setzten, und mit ihr nach Starnberg fahren. Oh, ich weiß es noch gut, wie sie damals weinend in meinen Armen lag, und sich nicht trösten konnte darüber, daß das Geschenk ihrer Liebe von dem, der am meisten daran gewachsen war, nicht die richtige Würdigung fand. Und dann – als Hardy im vorigen Jahr die unglaubliche Taktlosigkeit beging, mit Emmy hierherzukommen, ich weiß es noch gut, wie ich mit Lotte in die Telefonzelle des Cafés Stefanie mußte, wo sie mir weinend die Hände küßte, weil sie es nicht fassen konnte, daß man ihr diesen Tort antue. Ich weiß auch noch, wie wir dann im Luitpold saßen, wie sie zischend ihre Vorwürfe gegen Hardy vorbrachte und dann wieder hilflos nach meinen Händen griff und sie fortwährend küßte, da sie ja nicht einmal Strich ihr Inneres zeigen konnte. Ich habe das alles Hardy nicht vergessen, und wenn ich immer eine möglichst freundschaftliche Beziehung aufrechtzuerhalten wünschte, so deshalb, weil er mir einfach lieb ist, und weil ich seiner bodenlosen Schwäche viel verzeihe. Ach, als er damals mit Emmy zu mir kam und dann, als ich Emmy das Jacket abnehmen wollte, lostobte: „Ich kenne deine verruchte Sinnlichkeit!“ – Wie er Emmy befahl: „Komm! Verlassen wir diesen Herrn!“ – Waren das nicht auch Momente der Schwäche und Armseligkeit? Da er doch nichts dagegen hat, daß Emmy fürs Geld mit jedem Fremden schlafen geht! – Unsre Wege sollen sich jetzt trennen (natürlich werden sie sich nun trennen). Wir sollen in anständiger Form von einander Abschied nehmen. Was geht mich die Form an! Er denkt zuerst an die Form, ich denke an den Zustand, da wir keine Freunde mehr sein werden. Pose und Feigheit auch jetzt wieder. Innerlich die Feigheit, mit einem Menschen, den er einst bis ins Maßlose vergöttert hat, nicht zusammensein zu wollen, da er gemerkt hat, daß das auch nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen ist, ferner mit einem, der „sein“ Weib begehrt, und der endlos viel von seiner Vergangenheit weiß, mit einem, der ihn auch heute noch – obschon verstehend – hier und da kritisiert, ironisiert, leise Wahrheiten sagt. Und äußerlich die Pose des feierlichen Abschieds und des Anteilnehmenlassens sämtlicher Bekannter an der neuen Einstellung. Ich gebe zu, daß mir das letztere einfach unbequem ist. Und ich habe nicht gern Dinge, die mir schmerzlich sind, mit Unbequemlichkeiten verbunden. Abends wollte ich mit Emmy heimgehn. Sie meinte aber, sehr freundlich, das gehe doch jetzt nicht mehr gut. Wie reizend ist doch dieser naive Standpunkt, mit Hardys Freund Mühsam darf sie ihn betrügen, nach dem Bruch nicht mehr. Mein „erst recht jetzt!“ sah sie nicht ein. Liebes Ding!
Später erzählte ich Lotte die ganze Geschichte. Sie fand mein Verhalten richtig, und sagte: „Hardy ist doch ein rechter Affe. Aber er sieht reizend aus.“ Wir gingen ins Luitpold, wo sie die Strichs erwarten sollte. Sie kamen, und auch Georg Hirschfeld war dann bei uns. Wichtige Gespräche wurden nicht geführt. Dann ohne Hirschfeld Torggelstube. Am Haupttisch saßen Wedekind, Steinrück, Feuchtwanger und der allmählich unvermeidlich scheinende Professor Meyer. Als Steinrück und Feuchtwanger gingen, wollte ich Wedekind nicht mit dem besoffenen Idioten alleinlassen und setzte mich hinüber. Meyer quatschte aber so blöd daher, daß W. sehr bald ging.
Heut früh erschien Albert bei mir und lieferte 40 Kronen ab, von denen ich 30 für den „Kain“ abliefern muß. Die übrigen sind für verkaufte „Wüsten“ und gehören mir. Dann ging ich zur Redaktion des „Simplizissimus“ und sprach Thoma. Er versprach mir, mit Hirth zu sprechen, der ja vielleicht etwas hergeben werde. Große Hoffnungen wolle er mir nicht machen. Er selbst gab mir – unaufgefordert – 100 Mk. Ich war sehr glücklich. Natürlich lud ich mir das Puma zu Einkäufen ein und schenkte ihr einen Shawl, einen Sweater und eine Pelzmütze. Sie war unendlich glücklich. Wir brachten die Sachen zu ihr aufs Zimmer, wo sie mich oft sehr herzlich küßte. Einen Shawl hatte ich für Frieda gekauft, aber unter dem Glück der Puma-Küsse schenkte ich ihn auch ihr. Sie schenkte mir daraufhin meine hübsche Züricher silberne Uhr zurück. Auch stellte sie mir vor ihrer Abreise – die leider in 4–5 Tagen erfolgen soll – als wahrscheinlich ein Piacere in Aussicht. Sie entschuldigte sich, daß es heute nicht ging, damit, daß sie in verdrießlicher Stimmung wegen Strich sei. Sie sieht den Bestand des Verhältnisses recht pessimistisch an, kann aber mit Strich nicht brechen, da sie wirtschaftlich völlig auf ihn angewiesen ist. Ich liebe das Puma über die Maßen. Hoffentlich bringe ich sie doch noch zu dem Ehebruch in diesen Tagen. Das könnte mich in dieser eigentlich recht armen Zeit sehr sehr bereichern.
München, Mittwoch, d. 20. Dezember 1911.
Einige Kleinigkeiten, und ein Großes, wenn auch nicht sehr Großes. Gestern mittag rief mich Peppi an, ich möchte nachmittags in die Zeylon-Teestube kommen, wo sie mit Heinrich Mann sein werde. Ich ging zur Redaktionssitzung zum „Komet“. Fuhrmann setzte mir die Finanzlage auseinander. Das Blatt stehe in einer Krisis. Er hoffe aber, bald herauszukommen. Ob wir nicht Vorschläge machen könnten, wie die nächsten Wochen billiger zu wirtschaften wäre. Ein Wink mit dem Laternenpfahl: wir möchten billiger arbeiten oder das Honorar stunden. Ich fühlte alle Blicke auf mir. Ich mußte also meine Diplomatie bemühen. So antwortete ich, wir alle seien so gestellt, daß wir auf das, was uns der „Komet“ jetzt bringe, nicht verzichten können. Ich gebe aber den Rat, die Mitarbeiterzahl auf uns paar Leute, die wir bei den Sitzungen regelmäßig dabei seien, zu beschränken. Ich persönlich sei bereit, alles, was ich über die Kontraktsumme hinaus liefere, einen Monat lang zu stunden. Das sah nach viel Konzession aus, war aber garkeine große. Die Kollegen waren mit mir zufrieden, und Fuhrmann schien es auch. Ich empfahl mich während der Sitzung für eine Stunde, da ich „in Geldsachen“ eine wichtige Verabredung hätte. Natürlich ging ich in die Theestube. Ob zwischen Mann und Peppi schon etwas Intimes begonnen hat, konnte ich nicht herausfinden. Aber doch sehr möglich. Sehr lustig war, daß Peppi mich beiseite nahm, und mir sagte, Mann sei ja sehr nett, aber recht langweilig. Ich schlug ihr vor, manchmal zu mir zu kommen. Als Peppi auf die Toilette ging, sagte Mann: „Das Mädel ist ja sehr nett. Aber ich weiß nicht recht was mit ihr anzufangen.“ Ich schlug ihm vor, er solle sie mir überlassen. Mann lud mich zu Abendbrot ein, und nachdem ich zum „Kometen“ zurückgegangen war und dort noch eine Stunde lang Witze fabriziert hatte, fuhr ich zu ihm in die Pension Richter in Schwabing. Auch Brantl war da. Ich konstatierte mal wieder Manns primitiven Geschmack in Bildern. Er hat sich an die Wand eine Zeichnung von Dudovich genagelt. Unglaublich. Aber er hat es schon immer mit dem letzten Kitsch. Was er, speziell über Wedekind, sagte, war ungemein gescheit und fein. Zu essen gab es ausgezeichnet: Artischocken, Schnitzel mit Salat, kalten Aufschnitt, Käse und Kaffee, auch Obst. Und Bier, Thee und Schnaps zu trinken. Mann las einige Feinheiten von Peter Altenberg vor. Nachher gingen wir noch ins Café Noris. Gespräche über Stefan Zweig und die Wiener. Dann über Politik. Man gab meiner Logik recht, nicht aber meiner Grundstimmung. Doch kam Mann meiner Meinung viel näher als Brantl. Nachher ging ich ins Torggelhaus, wo ich den Stammtisch floh, da dort die Idioten Professor Meyer und der junge Graf Keyserlingk saßen. Ich fand zum Glück im Lokal die Brüder Strich. Nachher ging ich mit Walter ins Luitpold, wo das Puma mit zwei Damen saß – Mutter und Tochter. Die Tochter ist reizend, heißt Henny Frank, studiert Architektur und erinnerte mich, daß wir uns mal bei Schickele kennen gelernt hätten, wo auch Otto Flake (ihr Onkel) gewesen sei. Wir gingen noch in die Odeon-Bar, wo sich die Kleine einen allerliebsten Schwips antrank. Es war ein hübscher Abend.
Heut mittag traf ich im Café Frieda Wiegand. Ich nahm sie zum Essen mit mir, und es erfolgte, was erfolgen mußte. Ich bin recht froh darüber, daß ich endlich mal wieder koitieren konnte, und fühle mich seitdem heute viel frischer und lebendiger. Sie sträubte sich nur wenig. Ich trug sie auf den Divan, und war gleich bei ihr. Zwar störte ihr langes himmelblaues Korsett, aber die Veranstaltung ging doch für beide Teile unterhaltsam vonstatten. Im Jahre 1911 der erste Koitus mit einem neuen Weibe. Das nächste wird wohl Peppi sein.
München, Donnerstag, d. 21. Dezember 1911.
Heute habe ich endlich meine letzte Arbeit am Kain-Kalender getan. Jetzt geht die fertig gesetzte Sache in Druck. Leider kann das Büchelchen vor Weihnachten nicht mehr fertig werden, aber bis Mittwoch sind mir die ersten Exemplare versprochen. Nun geht`s ans weitere Werk. Das „Scheinwerfer“-Buch muß schnellstens fertig werden. Ich muß mir leider dazu einen ganzen Jahrgang der „Funken“ kommen lassen, da ich den Artikel „Wider die Aestheten“ nicht mehr habe und, wie mir der Verlag mitteilte, einzelne Hefte nicht mehr abgegeben werden können. Die Januar-Nummer des „Kains“ hoffe ich während der Feiertage schreiben zu können. Was hineinkommt, weiß ich schon zumeist. Und nun fordert mich der „Akademische Verband für Literatur und Musik“ in Wien in so schmeichelhafter Art auf, für ein Faschingsblatt gratis einen Beitrag zu schreiben, daß ich unmöglich nein sagen kann. Vor den Feiertagen graust mir einigermaßen. Strich fährt heut abend nach Berlin. Lotte bleibt noch bis morgen oder übermorgen, und dadurch werde ich recht verwaist sein. Hoffentlich gewährt mir das liebe Puma noch eine Nacht. Die beiden schenkten mir heute zu Weihnachten ein reizendes Gehängsel aus Tula-Silber: ein Messer, ein Zigarrenabschneider und ein Bleistift. Ich freue mich sehr, zumal ich mir schon lange etwas Silbernes gewünscht hatte, das man in der Tasche tragen kann. Ich will mir eine Kette dazu kaufen. Furchtbar lieb von den guten Menschen. Das Puma hat ihre Geschenke von mir ja schon bekommen. Ich habe ihr aber noch ein Shawl versprochen. Ferner will ich mit ihrer Hilfe für Strich etwas besorgen, und auch Uli soll eine Kleinigkeit kriegen. Johannes schicke ich 20 Kronen, und Ella 10 Mk. Das wird mir dadurch wohl möglich werden, daß Gotthelf mir eben im Café, wo ich klagte, daß Weihnachten so teuer sei, und daß ich nicht ein noch aus wisse, aus eignem Antrieb 30 Mk gab. – Aber trotzdem: die Dienstmädel müssen Trinkgeld haben, und der Monat dauert noch 12 Tage. Gott gebe, daß Hirth oder der Kutscha-Freund für den „Kain“ Geld herausrücken. – Aus Berlin bekam ich eine lustige Weihnachtspostkarte. Ella schreibt darauf, daß sie noch bis Anfang Januar in Berlin bleibe, und wünscht, daß ich hinkäme. Ich tät’s gern. Mit unterschrieben haben Anny Rawenetz, ein Graf Eberbach, Löbel und Ali Hubert. –
Mein Nebenzimmer hat wieder eine Bewohnerin. Frl. Hell hat – offenbar, um bei den häufigen Nachtbesuchen, die sie empfängt, keinen Zeugen zu haben (ich hörte oft das Allerintimste ihrer Liebesnächte), ein andres Zimmer bekommen. Die jetzige Nachbarin singt ebenfalls im „Serenissimus“. Ich sah sie nur einmal am Telefon und fand sie entzückend. Wir gehn aber jede Nacht fast zu gleicher Zeit schlafen, und mir scheint, daß das Husten und Räuspern, das sie dabei hören läßt, mir gelte. Heut nacht klopfte ich schon vorsichtig an die Wand, bin aber noch nicht sicher genug, ob ihr eine Bekanntschaft auf diese Art erwünscht wäre, als daß ich schon wagte, durch die Zimmerwand hindurch ein Gespräch anzuknüpfen. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Nächten mal eine Situation, die auszunutzen wäre. Vorläufig denke ich auch zuviel an die Möglichkeiten mit Lotte.
München, Freitag, d. 22. Dezember 1911.
Strich ist mit seinem Bruder abgereist. Lotte und ich waren an der Bahn. Dann setzte ich das Puma in ein Auto, und wir fuhren zur Torggelstube. Da dort an einem Tisch gepokert wurde, der Haupttisch aber leer war, fuhren wir gleich weiter zu Trefler nach „Wien in München“. Ein ödes Cabaret. Wir aber tranken Piesporter und viel Wermuth, und es dauerte nicht lang, da hatte mein Puma einen Mordsschwips. Vorher hatte sie mir erklärt, sie werde Strich diesen Abend treu bleiben, ihr Innerstes verbiete ihr, mir etwas zu gestatten. Dann aber fing sie an, mit zwei Nachbartischen zu poussieren und dadurch mehrere Herren im Umkreis schwer aufzuregen. Wir brachen auf und ließen uns bei einem Momentphotographen zusammen aufnehmen. 8 Mk kostete das Vergnügen, aber es ist ein reizendes Bild geworden. In die Atelierbude, die im Vestibül des Hotels Wagner untergebracht ist, schickte uns ein Nachbartisch den Kellner nach mit der Einladung zu Sekt. Ich lehnte ab, da man mich bei Namen nannte, und da ich nicht die Rolle Altenbergs zu spielen wünsche, der für ein Glas Champagner jedem Commis Vorstellungen giebt. Wir fuhren also – wieder im Auto – zum „Simplizissiumus“, und es wurde eine wunderhübsche kleine Porzellanfahrt, mit allerlei erotischen Abwechslungen. Bei der Kati trafen wir Uli und Seewald. Auch Thesing und der junge Tarrasch, der Zwillingsbruder der Bolz-Braut, waren da. Von dort aus, wieder im Auto, zum Stefanie. Thesing und Tarrasch folgten, und das Puma beschloß, den noch sehr naiven, erst 19jährigen Tarrasch zu verführen. Ich mußte beide in ein Auto setzen, stieg selbst in der Akademiestrasse aus und ließ die beiden zur Kaulbachstrasse weiter fahren. Ich war merkwürdigerweise garnicht eifersüchtig, die Geschichte machte mir einfach Spaß, und ich setzte zuhause die Hustenbeziehung zu der hübschen Nachbarin fort, der ich auf ein kräftiges Niesen ein ebensokräftiges Prosit! zurief, das sie allerdings nicht beantwortete. Als Lotte sich von mir trennte, versprach sie, heute mein Mittagsgast sein zu wollen, und ich freute mich endlos auf das, was ihr Versprechen außerdem enthielt. Aber ich traf sie vorher im Stefanie mit Uli und Seewald, und da sagte sie, sie werde Uli mitbringen. Ich ließ meine Verstimmung nicht merken, und die beiden kamen. Während wir bei Tisch saßen, erschien auch plötzlich Muschi Diekmann, und so aßen heute drei Damen bei mir Mittag. Uli und Lotte gingen fort, nachdem ich mit dem Puma verabredet hatte, daß ich gleich zu ihr kommen solle. So küßte ich Muschi noch gehörig ab und ging dann zu Lotte. Ich mußte erst einige Besorgungen für sie machen und zusehn, wie sie ein Paket fertig machte. Dann aber wurde ich aufs Köstlichste belohnt. Wir hatten uns so lieb wie schon sehr lange nicht mehr. Und jetzt habe ich bis eben mit ihr Einkäufe gemacht. – Inzwischen hätte ich zur Redaktionssitzung zum „Kometen“ kommen sollen. Ich hatte aber der Seidenbeck aufgetragen, mich dort als krank telefonisch zu entschuldigen. Ich kam mir den ganzen Nachmittag so vergnügt vor, wie ein Schuljunge, der das Pennal schwänzt. Bei Gott: ich habe die Stunden besser angewandt, als wenn ich dort gesessen hätte und mir schlechte Witze aus den Fingern gelutscht hätte. Das Puma hat jetzt eine Verabredung mit Cronos. Ob sie Strich mit dem jetzt zum vierten Mal in den 20 Stunden, seit er fort ist, betrügen wird? Der Gedanke reizte sie, sie sprach aber die Absicht aus, ihm nichts zu gewähren, da er ihr allmählich auch ziemlich unsympathisch geworden zu sein scheint. Morgen abend fährt sie auch ab. Heut treffen wir uns bei Uli, der ich zu Weihnachten ein Spitzenhöschen gekauft habe. Von den 130 Mk, die ich von Thoma und Gotthelf erhielt, sind blos noch etwa 25 vorhanden. Dabei habe ich Johannes blos 15 Kronen, Ella garnichts geschickt, und Lotte noch um 5 Mk angepumpt. Wenn doch Hirth ein Einsehen hätte!
München, Sonnabend, d. 23. Dezember 1911.
Lotte hat tatsächlich den üblen Herrn „Cronos“ gestern bei sich empfangen, und somit Strich am ersten Tage seiner Abwesenheit mit drei verschiedenen Männern hintergangen. Als ich heut früh bei ihr war, bereute sie die Intimität mit dem Kitschier schon etwas, war abgespannt, aber nicht übellaunig, und ließ sich von mir willig ihren köstlichen süßen nackten Busen küssen. Etwas reizenderes, als das Pumachen nach dem Erwachen im Bett liegen zu sehn, giebt es in der Welt nicht mehr. – Gestern abend waren wir bei Uli und Seewald. Ich bekam für das Spitzenhöschen von Uli einen schönen Kuß und durfte auch gleich beim Dominospiel 2 Mk an sie verlieren. Nachher waren wir noch alle im Simplizissimus und im Stefanie, wo ich – natürlich vergebens – versuchte, von Negoschann die Spielschuld einzutreiben.
Heut beschäftigt mich ein Brief des Dreimasken-Verlags. Darin wird mir in der denkbar schmeichelhaftesten Weise eine dauernde Beziehung zu dem Verlage angeboten auf Grund der „Freivermählten“. Das Stück selbst scheint man leider wieder nicht nehmen zu wollen wegen der Verbot-Gefahr. Man wünscht aber mit mir darüber zu sprechen und ist sogar erbötig, einen Herrn des Verlags zur Rücksprache zu mir zu schicken. Ich werde jetzt recht klug sein müssen, um wenigstens einen Vertrag wegen des Vertriebes des Stücks zu bewerkstelligen. Dann wird es ja auch wohl im Druck erscheinen. Als ich vorgestern mit dem Puma im Café Orlando di Lasso saß, kam der Schwätzer Maximilian Burg an den Tisch und berichtete, er habe in Wien mit dem Verleger Schmiedell über das Stück gesprochen, der sich nun dafür interessiere. Er – Burg – werde mir sogleich die Adresse des Mannes senden, und ich möchte das Manuskript hinschicken. Bis jetzt hat sich Burg nichts weiter merken lassen. Lieber wäre mir natürlich auch, mit dem reichen Drei-Masken-Verlag in Beziehung zu kommen. Ich glaube, es wäre endlich an der Zeit, wenn mein Schaffen ein wenig äußere Anerkennung fände.
München, Sonntag, de. 24. Dezember 1911.
Nun ist auch das Puma weg. Mittag aß sie bei mir, dann blieben wir den ganzen Tag beisammen und ich sah bei ihr zu, wie sie packte, und wie sie für Weisgerber eine ihrer reizendsten Puppen herrichtete, die er bestellt hatte. Ich brachte sie hin und sie schenkte mir von dem Erlös (40 Mk) 10 Mk. Ungeheuer glücklich war sie, als auch noch 130 Mk für verkaufte Puppen von auswärts kamen, und rechnete mir vor, wieviel sie in den letzten Wochen und Tagen mit ihrer Kunst verdient hat. Um 10h 10 setzte ich sie in den Schlafwagen, sie küßte mich noch einmal warm auf den Mund und fuhr ab. Etwas niedergeschlagen ging ich ins Torggelhaus. Dort saß Halbe, Waldau, Mie, Korfiz Holm mit Sohn, Maaß, der weiche Mayer (die beiden gingen bald), dann kam noch Basil und der „Nachbar“, Herr Ulrich Weigert, und schließlich Wedekind. Ich zeigte Wedekind und Gustel Waldau den Brief vom Dreimasken-Verlag. Beide sind der Meinung, daß das keine höflich verklausulierte Ablehnung sei, und Wedekind riet mir, hinzugehn, und alles zu tun, um die Leute zu bewegen, das Stück wenigstens drucken zu lassen. Wedekind erbot sich außerdem, an Robert zu schreiben, und ihm dringend anzuraten, das Stück aufzuführen. Würde doch endlich was draus! Ich konzipiere eben ein neues Werk: eine Hure, die in bessere Lebenslage kommt, und je bürgerlicher sich ihr Leben gestaltet, um so tiefer innerlich sinkt. Bis jetzt weiß ich noch wenig von dem Inhalt des Dramas, nur habe ich dieses Mal stärker als bei früheren Plänen die Empfindung der Notwendigkeit, an die Arbeit zu gehn. Halbe fuhr mich heim, und lud mich unterwegs ein, bei ihm den Weihnachtsabend zu verbringen. Sein Haus sei jedes Jahr die Zuflucht einiger Heimatloser. Um 8 Uhr soll ich dort sein.
Heut kam ein Brief von Johannes an, der mir in sehr lieben Worten seine Freundschaft nahebringt. Er legt 12 Stahlfedern bei, und ich kann wohl sagen, daß mich dieses kleine Freundesgeschenk mehr erfreut, als mich irgend etwas andres erfreuen könnte. Er klagt leider wieder sehr über die materielle Not, in der er lebt. Aber wie kann ich ihm nur helfen? Es ist ein großes Kreuz. Uli überreichte mir im Café eine Kiste mit guten Zigarren. Jetzt wird es Abend, und überall erhellen sich schon die Fenster, und die Weihnachtsbäume werden angezündet. Ob ich im nächsten Jahr endlich ein Weib haben werde, das mit liebender Hand für mich ein kleines Fest zurüstet? Ich bin des Vagabundierens eigentlich herzlich müde.
München, Montag, d. 25. Dezember 1911.
Weihnachten – und es regnet in Strippen. Kälte und Schnee scheint uns der liebe Gott für Ostern und Pfingsten vorbehalten zu haben. Momentan ist kein Wetter, das mir den Katzenjammer mildern könnte, der meinen Schädel benimmt. Aber es war sehr hübsch bei Halbes. Ich spielte von 7–8 Uhr noch im Stefanie mit Herrn – ich glaube, er heißt Sörensen – Billard und fuhr per Auto in die Wilhelmstrasse. Frau Luise öffnete mir die Tür, stellte mir ihre Kinder vor, (den ältesten, Robert, kannte ich schon) und führte mich ins Zimmer, wo Ludwig Scharf schon wartete. Die ganze Bescherung stand noch bevor, was ich mit einiger Beklemmung bemerkte. Denn ich hatte geglaubt, der ganze familiäre Teil wäre schon vorüber. Max Halbe erschien und begrüßte uns. Auch noch ein junger Mann, Roberts Freund, war als Gast gekommen. Paul Brann wurde aus Frankfurt erwartet. Die alten Halbes zogen sich ins Bescherungszimmer zurück, und eine etwas gezwungene Unterhaltung begann, bei der zumeist Robert, der zum ersten Mal seit seiner Schauspielerlaufbahn zuhause ist, von seinen Innsbrucker Bühnenerlebnissen erzählte. Hin und wieder sprang die 17jährige Anna-Liese ins Zimmer, ein ganz prächtiges Mädel, bildhübsch, unglaublich lebendig, unterhaltsam und lustig. Ihre Nähe tat mir den ganzen Abend überaus wohl. Endlich wurden wir herbeigerufen. Jeder eilte an seinen Tisch und freute sich der für ihn aufgebauten Geschenke. Ein mächtiger Tannenbaum stand, schön geschmückt, im Zimmer. Die Dienstmädels standen herum und zupften an ihren Schürzen, bis sie beschenkt wieder hinausgehn durften. Der Hund Terrie bekam feierlich einige Stücke Leberwurst, die er jubelnd vertilgte. Auch für uns Gäste war gesorgt. Jeder hatte einen Teller hingestellt bekommen mit erlesenen Leckereien. Auf meinem Teller fand ich, außer Äpfeln und Pfefferkuchen, eine köstliche Mettwurst, eine Flasche Danziger Goldwasser in Original-Packung und einen Originaltopf Gänseleberpastete. Ich werde alle die Herrlichkeiten – auch den Leckerteller des Frl. Seidenbeck, zu Uli bringen, und mich dort zum abendlichen Stammgast machen. – Es war wohl seit meiner Kindheit das erste Mal, daß ich bei einem Weihnachtsabend in einer Familie richtig dabei sein konnte, und ich leugne nicht, daß ich, ohne sentimental zu werden, sehr große Freude hatte. Vor allem gefiel mir, daß kein Rührungszimt serviert wurde, daß man heiter, aber nicht elegisch war, und keine frommen Lieder zu singen noch anzuhören brauchte. Schon während der Bescherung wurde Chablis gereicht. Dann ging’s, gegen 10 Uhr, da Brann noch nicht gekommen war, ans Essen. Es gab Pute, ein sehr schöner Vogel, mit grünen Bohnen und Kartoffeln. Dazu trank man Bier, und zwar war mir ein Riesenhumpen vorgesetzt worden, der wohl 4–500 Jahre alt sein mochte, aus Zinn, der 1½ Liter faßte, die ich bewältigen mußte. Als wir fertig gegessen hatten, erschien Brann, dessen Zug 1½ Stunden Verspätung gehabt hatte, und der nur für den abend bei Halbes von Frankfurt aus gekommen war, und heut früh um 9 Uhr schon wieder zurück mußte. Ich hatte den Eindruck, als ob er als künftiger Schwiegersohn ausersehn sei, wenn er gleich über 20 Jahre älter ist als Anna-Liese. Nachher wurde geraucht, geplaudert und getrunken. Alle möglichen Schnäpse gab es, auch verschiedene Weine und schließlich Sekt. Ich trank unheimliche Mengen. Alle zogen sich nach und nach zurück. Brann und ich aber saßen mit Halbe noch bis ¼ 4 Uhr und soffen. Zuhause zeigten sich dann auch die Folgen. Ich kotzte wie ein Albatros. Einen solchen Rausch habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Aber außer einer gewissen Benommenheit merke ich keine schlechten Folgen. Im Gegenteil habe ich so gute Gefühle von dem Abend und für die prächtigen Menschen, die meine Gastgeber waren, mitgenommen, daß ich eigentlich heute recht froh und glücklich bin. Wenn diese Leute mal einen Freund brauchen sollten, dann werden sie auf mich rechnen dürfen.
München, Dienstag, d. 26. Dezember 1911.
Rößler ist von Berlin zurück. Er hat mit den „fünf Frankfurtern“ am „Berliner Theater“ einen Riesenerfolg gehabt. Ich traf ihn gestern im Stefanie. Er war aber kühl und etwas feierlich zu mir. Meine Fragen, was er und Consul jetzt vorhaben, beantwortete er ausweichend. Ich hatte den Eindruck, daß er in seiner Altersleidenschaft mal wieder hysterisch eifersüchtig ist. Wie ich die Dinge beurteile, wird er den Consul heiraten, und dann in kurzer Zeit noch eine geschiedene Frau zu alimentieren haben. Ich bin gespannt, ob er mich diesmal überhaupt mit Consul zusammenführen wird. Sie wohnen im Hotel „Englischer Hof“.
Mittags hatte mich Peppi angerufen, und es kam eine Verabredung mit Heinrich Mann, dem ich telefonisch Bescheid gab, zustande, auf die hin wir alle uns um ½ 10 Uhr abends im Weinrestaurant Eckel trafen. Auch Dr. Brantl war dabei. Mann bezahlte alle 4 Soupers mit Wein und Sekt. Um Mitternacht trennten wir uns und ich übernahm es, Peppi heimzubegleiten. Droschke mußte ich mir versagen, wir fuhren Trambahn. Sie wohnt fast in Sendling draußen, in der Zanettistrasse, weit unten bei der Lindwurmstrasse. Als wir ausgestiegen waren, gingen wir die Straße noch ein paar Mal auf und nieder. Sie sprach viel von Heinrich Mann. Sie habe ihn sehr gern, mich habe sie auch sehr gern, aber jeden ganz verschieden. „Aber“, sagte ich, „mit mir möchtest du wohl schlafen!“ Sie sagte „Ja“. Ganz einfach und grade heraus. Ich war glücklich und stolz. Beherbergen konnte sie mich leider nicht bei sich, da sie nicht sturmfrei wohnt. Auch den Abschiedskuß blieb sie mir schuldig. Denn unten im Hause ist eine Kneipe, aus der ununterbrochen Menschen strömten. Und da genierte sie sich. Sie sagte aber: „Du kriegst scho’ noch gnua von mir“ – und versprach, in diesen Tagen mein Mittagsgast zu sein. Da keine Elektrische mehr zurückfuhr, ging ich zu Fuß in die Torggelstube. Da saß Wedekind mit seinem Neffen Armin Wedekind, mit dem ich jüngst bei Kutscher zusammen war, und mit seinem Schwager Neves. Wedekind spendierte uns Kaviar und Sekt. Wir blieben in lustigen Gesprächen bis 3 Uhr beisammen. Nachher ging ich noch mit dem Neffen in das neu eröffnete Odeon-Casino, um einen Mokka zu trinken. Erst durch viel Zureden und Trinkgeld erhielten wir Einlaß. Es war recht fidel dort. Ich zahlte die Zeche, die inclusive Hennessy und Trinkgeld 8 Mk 50 betrug. Nun bin ich wieder ziemlich pleite und setze alle Hoffnung auf den Besuch, den ich morgen dem Dreimasken-Verlag machen will. Armin Wedekind begleitete mich dann noch heim. Unterwegs legte er mir Konfessionen ab: er sei bisher homosexuell gewesen, liebe aber jetzt ein 15jähriges Mädchen, das maßlos in ihn verliebt sei, und nun wisse er nicht, ob er sie koitieren dürfe: beste Kreise, Angst vor einem Kinde etc. Es war schwer zu raten. Ich sagte, wenn die Leidenschaft auf beiden Seiten so groß sei, so werde wohl von selbst kommen, was kommen muß. Könne er sein Tun nach festen Plänen bestimmen, so solle er tun, was sein Verstand oder sein Gewissen ihm rate. Im übrigen empfahl ich ihm, die Sache seiner Tante Tilly Wedekind vorzutragen, da eine Frau in solchen Dingen stets besser zu urteilen weiß als ein Mann. – Ein weicher, zutraulicher, lieber Mensch.
Heut sprach ich im Café den Affen Werner Daya, der in Ascona gewesen ist. Ich hoffte, etwas über Frieda zu erfahren. Er wußte aber nicht viel, nur, daß Lisi ihm verraten habe, bald würde Frieda nach Zürich oder nach München kommen. Im übrigen quatschte er sich in seiner eingebildeten süßlichen Tonart einen widerlichen Literaturstiefel zusammen. Ich kenne kaum einen Menschen, dessen Art mich so sehr degoutiert ... Jetzt erwarte ich Frieda Wiegand, und dann will ich endlich an die Arbeit. Die Januar-Nummer des „Kain“ muß geschrieben werden. Viel von ihrem Inhalt weiß ich leider noch nicht.
München, Mittwoch, d. 27. Dezember 1911.
Der Besuch Frieda Wiegands, die zu mir kam, um Gedichte zur Rezitation zu erhalten und die ich mit Caffee und Kuchen bewirtete, endete mit einem Piacere. Das Richtige war es aber immer noch nicht, obgleich ich sie genötigt hatte, das blaue Korset mitsamt Kleid und Höschen auszuziehen. Jedes Geräusch auf dem Korridor, jedes Anläuten des Fernsprechers irritierte das Mädel derart, daß wir leider nicht in die rechte Stimmung kamen, und daß ich froh war, als nach viel Quälerei alles überstanden war. Ich muß sie schon mal nachts mit zu mir nehmen. Lieber finge ich allerdings mit Peppi ein kleines Verhältnis an. – Nachher ging ich zu Uli, wo wir die Weihnachtsgeschenke von Halbe vertilgten. Das Gespräch ging bald zur Seewaldschen Ehe über, und Uli erklärte deutlich, daß sie sich nicht verheiratet fühle, und die gleiche Uli Trotsch sei wie immer. Wir sprachen auch über ihre Morfiumzeit und wärmten viele Erinnerungen auf. Als Seewald einmal das Zimmer verlassen hatte, fielen wir uns spontan um den Hals und küßten uns auf den Mund. Ich habe Uli sehr lieb.
Abends Torggelstube. Zuerst B. v. Jacobi und seine Frau, die mir mit ihrer prätentiösen Intelligenz nachgrade auf die Nerven geht. Dann kam Gumppenberg mit seiner Nebbich-Baronin hinzu. Schließlich Max Langheinrich aus Kropfmühl. Als die adligen Herrschaften gegangen waren, stritt ich mit Langheinrich über die sozialen Probleme. Er ist ein kluger Mensch. Aber auch die klügsten machen immer wieder den albernen Fehler, mit Einzelbeispielen Allgemeines erweisen zu wollen. Ehe wir hitzig wurden, kamen Steinrück, Waldau, Dumke und der Wiener Siegfried Geyer. Jetzt wurde es fidel. Um ½ 3 Uhr brachen wir auf, und ich begleitete Langheinrich noch im Auto zum Schottenhammel. Unterwegs erinnerte ich ihn an den Brief, den ich ihm seinerzeit wegen Kätchen Brauer geschrieben hatte. Er sagte, er müsse sein Geld zusammenhalten, und äußerte sich dabei über „diese Dame“, der er einmal sehr nahe gestanden hat, in einer Weise, die mir mißfiel. – Ich erhielt heute einen Brief von Dr. Ludwig, eingelegt darin ein Schreiben von Zilla Stamm an Dr. Theodor Lessing. Es geht der armen Cilla und ihrem Kind in Zürich schlecht. Lessing sandte den Brief an Ludwig weiter, und der, statt ihr ein Goldstück zu schicken, belastet mich damit. Ich werde mein Heil jetzt bei Jaffé versuchen. – Mir selbst geht es so, daß ich heute den Oberkellner Julius im Stefanie um fünf Mark anpumpen mußte, um abends mit Uli ins Theater und dann auf die Kegelbahn gehn zu können. Morgen mittag soll ich bei Jadassohn am Dreimasken-Verlag sein. Ob da ein nennenswerter Vorschuß herausspringen wird? Nötig wärs.
München, Donnerstag, d. 28. Dezember 1911.
Ein Brief von Kutscha. Sein Freund lehnt ab mir zu helfen, weil er fürchtet, die Sache könne publik werden, und er könne dadurch Unannehmlichkeiten haben. Es ist schon herrlich bestellt um den Mut meiner Verehrer. – Gestern abend war ich mit Uli im Schauspielhaus. Thesing schloß sich uns an. Es gab ein dreiaktiges Lustspiel von Korfiz Holm: „Hundstage“. Ein fader Schmarren. Alte Witze, fast garkeine Handlung. Aber den Philistern gefällts. Gespielt wurde flott. Drei Ehepaare, die untereinander poussieren, sich Eifersuchtsgeschichten machen, bis schließlich jeder Ehemann in die Arme seiner Ehefrau sinkt. Waldau und Dumke waren recht gut, Colla Jessen sauschlecht. Die Gerhäuser und die Blümer waren ganz brav, die Woiwode reizend, die Schaffer scheußlich. – Nachher fuhren wir Droschke fort. Uli und Thesing wollten noch in ein Caféhaus, natürlich, wo kein Seewald getroffen werden konnte. Ich empfahl ihnen das Café Elite Grossischen Angedenkens (Schellingstrasse). Mich setzten die beiden bei der Kegelbahn ab. Dort war Weihnachtsbetrieb mit Bowle und Damen. Roda Roda, Wilm, Kutscher, Etzel und Jacobi hatten ihre Frauen mitgebracht, Roda außerdem noch die Kusine der seinen, ein Fräulein v. Riehl, und Halbe seine Schwägerin Bertha. Es war nett und lustig. Ich trank sehr viel Ananasbowle und kam hinreichend geladen heim. Heut vormittag ging ich nun zum Dreimaskenverlag und sprach Jadassohn. Das Ergebnis ist, daß ich morgen Kontrakt machen soll, wonach ich mich verpflichte, alle Bühnenwerke dem Verlag zu geben und wahrscheinlich gleich 300 Mk Vorschuß erhalte. Mir tut jetzt leid, daß ich nicht 500 verlangt habe. Vielleicht hätte man mir auch die bewilligt. Jedenfalls war ich sehr froh, und ging ins Stefanie, wo ich Emmy traf. Sie erzählte mir Neues von Hardy, den sie für verrückt hält, da er jetzt, ähnlich wie bei mir, alle seine Bekannten brüskiert. So hat er jetzt urplötzlich und in der verletzendsten Form den Verkehr mit Przybyszewsky abgebrochen. Ich nahm Emmy mit mir, sie aß hier Mittag, dann krochen wir ins Bettchen. Es war sehr süß, und ich fühlte mich mordsfroh danach. Leider reist sie in den nächsten Tagen für längere Wochen mit Hardy nach Frankreich, sodaß dieser längeren Pause zwischen unsern Verständigungen wohl wieder eine längere Pause folgen dürfte. Hoffentlich erbarmt sich Peppi inzwischen meiner. An Ella wage ich noch nicht zu denken.
München, Freitag, d. 29. Dezember 1911.
Jadassohn hat mich zu heut abend um ½ 8 Uhr auf sein Büro bestellt. Bis dahin habe ich also Zeit, mich zu ängstigen, ob aus der Geschichte nun wirklich etwas wird, oder ob nicht doch wieder im letzten Moment irgend etwas passiert, was auch diesen großen Schritt nach vorwärts noch zurückhalten könnte. Als ich gestern durchlas, was ich vor einem Jahr hier schrieb, fand ich den Wunsch daß das Jahr 1911 mir endlich die Aufführung der „Freivermählten“ bringen werde. Jetzt, in den allerletzten Tagen dieses Jahres, flehe ich mein Schicksal nur noch darum an, dem Stück endlich das Institut zu schaffen, das fachmännisch und interessiert das Nötige zu seiner Publizität tun kann. Ob das dann für 1912 endlich die Aufführung, und sei es auch nur vor kleinerem Kreise, bewirken wird? Ich will’s abwarten, ohne mich Illusionen hinzugeben.
In der Torggelstube ging es gestern seltsam her. Als ich gegen 11 Uhr kam, saß allein Seyffert da. Plötzlich aber erschien, ein wenig wankend, Alexander Eckert. Große Freude. Er kam von einer Hochzeit und war stockvoll. Aber ich habe kaum je einen liebenswürdigeren Besoffenen gesehn als Eckert, der für 4 Wochen ans Lustspielhaus engagiert ist. Schon vor 1½ Jahren, als er mit Reinhardt am Künstlertheater war, sah ich ihn manchmal so, und erinnere mich lebhaft, wie ihn mir Tilla Durieux einmal, mütterlich besorgt, anvertraute, damit ich ihn nach Hause brächte. Gestern also war er wieder ungemein lustig. Langheinrich und Körting kamen. Nachher Steinrück, Weigert und Steiner. Alle hatten ihn lieb wegen seiner köstlichen Laune. Wedekind kam, von Eckert stürmisch begrüßt, der ihm gleich eine entfernte Verwandtschaft vorrechnete. Wedekind hat leider keine Spur von Humor. Wir alle waren etwas betreten. Wedekind versuchte erst, in etwas feierlicher Weise auf Eckert einzugehn, und meinte, er möge seine Rollen spielen, das wäre eine Art, Verwandtschaft herzustellen. Eckert wurde immer zärtlicher: „Lieber guter Frank Wedekind!“ – „Ich bin weder lieb noch gut –“. „Lieber Guter darf ich nicht sagen. Also vielleicht: Erhabener –“. Wedekind erhebt sich, dreht sich um, verläßt das Lokal, setzt sich in den Nebenraum. Wir platzten heraus vor Lachen. Und jetzt ging es los, den guten Alex aufzuhetzen. Steinrück vorne an. Er müsse Wedekind die Verwandtschaft noch einmal auseinandersetzen etc. Eckert wankt hinaus. Wir hören, wie Wedekind ihn anschreit. Er kommt selig lächelnd zurück und berichtet: Wedekind habe gesagt: „Lassen Sie mich bitte in Ruhe! – Scheren Sie sich bitte zum Teufel!“ „Bitte, hat er gesagt“, berichtet der Besoffene. „Die Form hat er immerhin gewahrt.“ – Später geht Eckert noch einmal hinaus zu Wedekind mit der Klampfe. Wedekind flüchtet auf den Lokus. Wir bersten vor Lachen. Aber traurig ist’s doch. Eckerts entzückende Art, betrunken zu sein, darf man nicht feierlich begegnen. Wedekind bringt sich mit dieser Noli me tangere-Geste um jede harmlose Geselligkeit, und jede fröhliche Gesellschaft um ihre Lustigkeit. Hoffentlich werden die Zusammenstöße zwischen den beiden Herren in der nächsten Zeit nicht chronisch werden.
Ich muß an die Arbeit. Die neue Kain-Nummer habe ich noch kaum angefangen. Das Heft wird dieses Mal noch später erscheinen als sonst. – In Berlin sind im Obdachlosen-Asyl über 100 Personen unter geheimnisvollen Erscheinungen erkrankt. Über fünfzig sind schon gestorben. Man weiß noch nicht, ob sichs um eine Infektionskrankheit oder um Massenvergiftung handelt. Die Sache ist furchtbar. Aber ich werde mir die Schmöcke vornehmen, die jetzt plötzlich sich der Allerärmsten annehmen, wo es zu den Wahlen geht, und die mir in ihren Versammlungen das Wort nicht geben, weil ich es mit diesen Allerärmsten gehalten habe. Wartet, Kanaillen!
München, Sonnabend, d. 30. Dezember 1911.
Ich habe heute nicht 300, sondern 500 Mark vom Dreimasken-Verlag bekommen und bin nun für die nächsten Tage und Wochen aus allen Nöten. Johannes soll heute geschickt bekommen (Bing berichtete mir gestern von einem Pumpbrief, den er von ihm bekommen habe), Ella soll kriegen. Der „Kain“ ist wieder für den Januar gedeckt, und ich werde sogar noch nach der Zahlung meiner Schulden an Uli und Lotte Geld genug übrig behalten. Ich konnte den Vorschuß dadurch höher schrauben, daß Jadassohn noch im letzten Moment mit dem Vorschlag kam, der Verlag solle einen Teil der Tantiemen, etwa ⅓ oder ¼ für 1000 Mk pro Akt kaufen dürfen. Ich sträubte mich erst sehr dagegen, aber die Aussicht auf 200 Mark mehr betäubte meine Bedenken. Und vor allem: Ich habe endlich die „Freivermählten“ bei einem Bühnenverlag. Sobald die Manuskriptdrucke da sind, gehe ich mit dem Buch zu Langen. Ich glaube fast, Korfiz Holm wird die Edition befürworten. – Ein merkwürdiger Zwischenfall stellte im letzten Moment noch in Frage, ob ich überhaupt zum Verlag gehn könnte. Ich stand erst um 12 Uhr mittags auf, und fand meine Schuhe nicht vor der Tür. Das Mädel behauptete, auch keine zum Putzen gefunden zu haben. Kurz und gut: die Schuhe waren gestohlen. Die andern sind beim Schuster in Reparatur, und meine alten Stiefel habe ich neulich verschenkt. Ich konnte also nicht fortgehn und tobte. Endlich lieh mir ein Herr Stöhr, Vortragskünstler vom „Serenissimus“ ein Paar gelbe Stiefel, die halbwegs paßten. Nur war der linke eigens für ihn gebaut, da er an dem Fuß sechs Zehen hat, und so mußte ich mich sehr quälen, bis ich, reich vom Dreimasken-Verlag zurückkehrend, mir auf dem Wege schon ein Paar neue Schuhe für 18.50 Mk kaufte.
Gestern abend war endlich mal wieder eine Gruppenzusammenkunft im „Gambrinus“. Wir waren nur sehr wenige, mit Morax und mir etwa 12 Personen, da die eingeladenen Studenten, die wohl alle zu den Ferien fort sind, nicht gekommen waren. Ich sprach, obwohl wir so wenige waren, eine ganze Stunde über die Wahlen, da vier neue Leute dabei waren, die Morax aus der Volksküche herangeschleppt hatte. Wir haben beschlossen, vorläufig wieder alle Freitage im „Gambrinus“ zusammenzukommen. Vielleicht kommt doch noch eine neue ansehnliche Gruppe Tat zustande. – Am 6ten Januar soll ich bei der freien Vereinigung der Holzarbeiter über die Reichstagswahl sprechen.
München, Sonntag, d. 31. Dezember 1911.
Der „Kain-Kalender für das Jahr 1912“ ist heraus. Gottseidank. Seit drei Jahren meine erste Buch-Publikation. Der „Krater“ war die letzte. Der Kalender sieht sauber und hübsch aus. Auch der Inhalt erfreut mich jetzt, da ich das ganze endlich gedruckt vor mir sehe. Vorne mein Porträt auf gelblichem Kunstdruckpapier (die Photographie der Hänse Hermann, stehend, mit dem Hut in der Hand), mit Faksimile-Namenszug. Das Büchelchen ist fünf Bogen stark. Ich hoffe, daß die Buchhandlungen es ordentlich absetzen werden, damit Steinebach Mut faßt, weiter zu drucken und weiter zu kreditieren.
Auf meinen Reichtum hin, mußte ich schon gehörig bluten, so daß ich heute bereits den dritten Hundertmarkschein wechseln ließ. 30 Mk verpumpte ich an Thesing, 20 an Bolz, 10 an den Grafen Keyserlingk. An Johannes schickte ich 80 Kronen statt 50, an Ella 20 Mk. Uli versprach ich 10 Mark, und ebenfalls 10 Mark schenkte ich eben Frieda Wiegand, die mich diesen Moment verließ – ich hatte das Einschreiben hier bei ihrem Kommen abgebrochen –, und mit der sich das alte Jahr mit einem schön verlaufenen und durch kein Korset und keinen Klingellärm gestörten Koitus verabschiedete.
Von Minnie Kornfeld kam ein Bild, ihr Porträt als Sonderdruck aus der Monatsschrift „das Theater“. Das Bild ist in der Aufmachung so vornehm, daß ich nicht umhin können werde, es einrahmen zu lassen. Sie widmet es „Erich Mühsam, dem Dichter u. Freunde in Verehrung u. Zuneigung. Weihnachten 1911.“
Jetzt muß ich endlich an den „Kain“ gehn. So spät ist es noch nie mit einer Nummer geworden.
München, Montag, d. 1. Januar 1912
Als ich gestern abend in die Torggelstube ging, sah ich der Sylvesternacht mit einigem Mißbehagen entgegen. Ich wußte durch Rößler (den ich flüchtig im Stefanie gesprochen hatte), daß die Bekannten, die Halbe-Gesellschaft und die um Gustel Waldau, alle beim Direktor Stolberg zu Gast seien und fürchtete rechte Langeweile. Der einzige, den ich antraf, war Alexander Eckert, der seine Kollegen vom Lustspielhaus erwartete. So aß ich Abendbrot, poussierte dabei die neue Kellnerin Anny, ein nettes junges lebendiges Ding, freute mich am Anblick eines reizenden Mädchens am Nebentisch und ärgerte mich darüber, daß sie da mit zwei Fadianen saß, mit denen sie sich siezte. Dann kamen die Lustspielhäusler: Feldhammer, Sidonie Lorm, Schwaiger mit Frau, Gottowt mit Frau, Frl. Werner –; ich ging. In den Simplizissimus, obwohl ich lebhaft die Überfüllung und den Gestank fürchtete und sicher glaubte, der Betrieb dort werde mir recht zum Ekel sein. Natürlich saß man auch nahezu übereinander. Als es Mitternacht wurde, erschien Koppel als alter müder Mann maskiert und stellte sich als altes Jahr vor, sagte ein paar schlechte Verse und verschwand. Dann kam Emmy mit himmelblauem Spitzenkleid, rotem Kranz auf den Haaren und riesigem Brautschleier: das neue Jahr. Auch sie sagte ein paar schlechte Koppelsche Verse, und nun durfte man das neue Jahr begrüßen. Ich machte gute Geschäfte dabei, denn soviel Küsse von schönen Frauen habe ich wohl noch nie auf einmal bekommen. Die erste war Emmy, die mir ihren Mund gab. Dann flog mir Fränze um den Hals, von der ich noch nie einen Kuß bekommen hatte. Anny Trautner kam gestern von Mannheim zurück: Kuß. Uli führte ich zum Zweck der Luftschöpfung auf den Hof: Küsse. Mary Irber kam herein, und wir wühlten sogleich die Schnauzen ineinander. Seit einigen Tagen ist Mucki Bergé von London zurück, und hat eine Freundin von dort mitgebracht, die mir sehr gut gefällt: Grete Krüger. Sie behauptet, mich seit vielen Jahren, schon von Berlin her zu kennen. Jedenfalls gefällt sie mir sehr und ich habe mich in den letzten Tagen schon lebhaft um sie bemüht. Vergebens, da sie mit einem Griechen verlobt ist, dem sie angeblich die Treue hält. Als sie aber in den Simpl. kam, nahm ich sie gleich in den Arm und sie knallte mir a tempo einen prächtigen Kuß auf den Mund. Die dicke Mucki sank mir gerührt an die Brust. Ich kam also nicht zu kurz. Gleichwohl hätte mich der Jahresanfang noch nicht befriedigt, wäre nicht etwas recht Merkwürdiges passiert. Ich saß mit Thesing vor dem Ofen, an dem ich einst die Bekanntschaft von Gustav Gross gemacht habe. Plötzlich erschien ein blonder Jüngling und erklärte, er sei mit einer Französin da, die gern unsre Bekanntschaft machen möchte. Wir ließen bitten, und nun erschien eine junge Dame von einer solchen Anmut, Schönheit, Liebenswürdigkeit, daß ich hingerissen war. Ich konnte plötzlich französisch, und es kam eine entzückende Unterhaltung zustande. Küssen ließ sie sich noch nicht. Aber ihren Namen und die Adresse habe ich, und ich denke mir, ich werde sie wiedersehn. Der junge Mann, ein Herr v. Scharberg hat sie in einer Pension kennen gelernt vor 3 Wochen, und die beiden haben offenbar ein Verhältnis miteinander. Die Art, wie wir durch die Initiative der Frau ihre Bekanntschaft machten, läßt mich darauf schließen, daß sie in München Abenteuer sucht. Ich sende ihr heute noch meinen Kalender, und hoffe auf den Karneval. Sie heißt Jeanne Usote und wohnt Luisenstrasse 12.
Das alte Jahr hat gut geendet, das neue gut begonnen. Jetzt gehe ich an die Arbeit. Der erste Tag des Jahres soll mich fleißig finden.
München, Dienstag, d. 2. Januar 1912.
Ich habe nun glücklich den Hauptartikel für den „Kain“ Nr. 10 fertig. Er heißt: „Der Humbug der Wahlen“ und ist so lang geworden, daß das halbe Blatt damit gefüllt wird. Bringe ich noch ein tüchtiges Stück vom Gefängnistagebuch, so wird mit 3–4 „Bemerkungen“ das Heft voll. Dann ging ich ins Stefanie, spielte mit Weisgerber Schach, mit Morax Billard und mit Uli Domino und wollte eben in die Torggelstube aufbrechen, als mich Graf Keyserlingk aus dem Simplizissimus antelefonierte, die Französin sei dort. Ich stürzte zu Kati Kobus. Da saß sie, bereits umdrängt von Thesing, Bolz und Keyserlingk. Ich als der Onkel mit dem vielen Geld durfte mich ganz an ihre Seite pressen und die Zeche bezahlen. Erst später kam der Jüngling, Herr v. Scharberg. Ich hatte aus dem Adressbuch ermittelt, daß es das Haus Luisenstrasse 12 garnicht gibt, und nun rückte das Mädel mit der Wahrheit heraus: Sie heißt Jeanne Ducrest und wohnt Türkenstrasse 60. Wir gingen später noch in den Bunten Vogel, und es war äußerst lustig. Bing schloß sich uns an. Die andern sind der Meinung, Jeanne sei eine Pariser Hure. Ich glaube eher, daß sie ein geiles Bürgermädchen aus der Provinz ist, die hierhergekommen ist, unter dem Vorgeben, malen lernen zu wollen, und sich nun nach Kräften ausleben will. Daß sie nicht unzugänglich ist, scheint mir sicher. Ich machte deutliche Anspielungen, und als ich sie zu heut mittag zu Tisch zu mir einlud, lehnte sie das mit einem Seitenblick auf ihren Begleiter ab (der kein Französisch versteht) und sagte: „C’est trop dangereux.“ – Ich schicke ihr jetzt den Kain-Kalender. Ich habe hineingeschrieben: „C’est l’amour, qui fait connaître les hommes. J’espère, que vous me connaisserez un jour. À Mademoiselle Jeanne Ducrest, la plus belle, la plus gracieuse, la plus aimable Française“. Ob das ein einwandfreies Französisch ist, weiß ich nicht. Aber sie wird ja verstehn, was ich will. Sonnabend habe ich mit ihr gemeinsamen Theaterbesuch verabredet. Der Teufel soll mich holen, wenn es mir nicht gelingt, das Weib zu erobern.
Heut will ich zu Steinebach, ihm 160 Mark für zwei Kain-Nummern bar zahlen. Dann habe ich Redaktionssitzung beim „Kometen“ und hoffe, die 200 Mark Monatsgehalt zu kriegen (Onkel Leopold hat rechtzeitig geschickt), und um ½ 6 Uhr treffe ich Peppi Kirchhof im Stefanie.
München, Mittwoch, d. 3. Januar 1912.
Eine kleine Episode von vorgestern Nacht will ich festhalten. Als wir aus dem „Bunten Vogel“ kamen, ziemlich angezecht, stellte ich mich hinter ein Auto und brunzte die Laterne seiner Rückseite an. Ein junger Mensch kam des Wegs und stieß mich an. Ohne lange zu überlegen, schlug ich ihm eine Ohrfeige ins Gesicht, daß die Barerstrasse knallte. Kaum geschehn, bereute ich schon. Denn ich sah, daß er ein großer starker Kerl war, der mich nun wohl zusammenhauen würde. Das tat er aber nicht, sondern reichte mir die Hand, entschuldigte sich sehr höflich und erklärte, er würde mich nicht gestoßen haben, wenn er gesehn hätte, daß es sich um einen älteren Herrn handelte. Meine altmachende Bärtigkeit hatte mich also gerettet. Die Freunde standen um uns herum und lachten unbändig. Der Jüngling aber ging in den Bunten Vogel hinein, hielt sich die Backe und sagte: „Hoffentlich sieht man es nicht.“ – Ich habe wohl seit mindestens 10 Jahren keinen Menschen mehr geohrfeigt. Gewöhnlich bin ich der Empfänger.
Gestern zahlte ich Steinebach 160 Mark für die Januar- und Februar-Nummern. Ich habe mit ihm ausgemacht, daß der „Kain“ von jetzt ab erst Mitte jedes Monats erscheinen soll. So habe ich also mit meiner Arbeit wieder ein paar Tage Zeit.
Nach der Redaktionssitzung des „Kometen“ (der mir die 200 Mark Monatsgehalt auszahlte) traf ich Peppi. Sie saß mit Roda Roda im Stefanie. Übrigens heißt sie nicht Kirchhof, sondern Krchov; sie ist Böhmin. Wir fuhren per Droschke zum Gärtnerplatztheater, nachdem ich ihr ein Zehnmarkstück geschenkt hatte. Ich kaufte mir ein Billet und sah mir die Operette „der Rodelzigeuner“ an. Text von Leo Kastner, Musik von Josef Snaga. Ein unsagbarer Mist. Wer die Gisela Fischer einmal von der Bühne herunterschösse, müßte wegen Notwehr freigesprochen werden. Pepi wirkte nur im Chor mit und sah reizend aus. Wir gingen nachher in den Rathskeller essen, und ich schenkte ihr dort noch 20 Mark, weil ich recht verliebt in sie war und merkte, daß auch sie mich sehr gern hatte. Dann fuhr ich sie im Auto heim. Sie war, wie sie sich ausdrückte, „zum Busseln aufg’legt“. Ich kenne kaum eine Frau, die so raffiniert, so um das Verlangen des Mannes wissend küßt, wie dieses Mädchen. Es war eine herrliche Fahrt. Morgen soll ich sie am Nachmittage besuchen, und dann wird wohl erfolgen, was sich doch nicht mehr lange aufschieben läßt. Das Unglück ist nur: sie will geheiratet werden, und – so gern ich sie habe: dafür müßte ich mich bedanken.
Torggelstube: Eckert, Gumppenberg, Steiner, Maaß, Sobotka, Direktor Fuchs und Frau. Später gingen Eckert, Steiner und ich ins Orlando Billard spielen. Nach 3 Uhr totmüde ins Bett.
Heut im Café traf ich Henry und die Delvard mit Dr. Sieveking und Frau aus Zürich. Die Frau ist die Lübecker Nachbarin Röschen Benda, in meiner Schulzeit eines der schönsten Mädchen Lübecks, jetzt dick und häßlich. Mutter dreier Kinder. Vor zwei Jahren sah ich ihre Schwester wieder, die ebenfalls in Zürich mit dem Architekten Haller verheiratet ist. Die war als Kind häßlich und ist jetzt sehr reizvoll und nett.
An einem andern Tisch saß Thesing mit Jeanne Ducrest, die entzückend aussah. Sonnabend soll ich mit ihr ins Lustspielhaus, Sonntag zu Henrys Vortragsabend gehn. Heut und morgen abend sehe ich im Hoftheater Strindbergs „Totentanz“. Morgen Nachmittag Piacere bei Pepi. Sonnabend nachmittag soll ich Lina Woiwode zum Thee besuchen. Ich telefonierte vorhin mit ihr. Ein reichhaltiges Programm. Mag sich der erotische Betrieb in diesem Jahre recht erfolgreich anlassen!
München, Donnerstag, d. 4. Januar 1912.
Ich bin in der letzten Zeit merkwürdig bewegt von Erlebnissen mit Frauen. Auch hier in der Pension ist mal wieder ein Stubenmädel, das mir nicht schlecht gefällt, groß, blauäugig und mit sehr schönem aschblonden Haar. Sie läßt sich – nachdem sie sich in den ersten Tagen sträubte – jetzt willig küssen, bleibt sogar wartend mit spitzen Lippen stehn, wenn sie mal ins Zimmer kommt. Leider scheint man sie mir wegnehmen zu wollen und in die höhere Etage abzukommandieren. Wenigstens brachte mir heute eine andre das Frühstück. – Gestern nachmittag – ich saß eben mit Weisgerber beim Schach – kam Thesing mit Jeanne ins Café. Wir okkupierten die kleine Loge, die wir dunkel ließen, und jetzt ging ein köstliches galantes Zoten los. Thesing ist anscheinend immer noch dermaßen in Uli verliebt, daß er mit Jeanne, die offenbar scharf auf ihn ist, nur spielt. Er sagte mir ausdrücklich, er werde sie, obwohl sie ihm die größten Avancen mache, nicht nehmen, und halte sie mir stets zur Verfügung. Daß er sie leicht haben könnte, zeigte sich mir daran, daß sie ihm in der dunklen Loge plötzlich auf die Backe küßte. Ich mußte mir die gleiche Gunst erst erbitten. Mir ist übrigens eine sonderbare Ähnlichkeit aufgefallen, die mir von allen bestätigt wird, die ich darauf hinwies: Jeanne Ducrest sieht genau aus wie die Bettlerin vom Pont des Arts, so genau, daß man, wäre das Bild nicht soviel älter als sie, meinen möchte, sie habe dazu Modell gestanden. Eine etwas kitschige, sentimentale aber wirklich große Schönheit. Will ich ehrlich gegen mich sein, so gestehe ich mir, daß mir die garnicht sehr schöne, garnicht sehr gescheite, nicht im mindesten witzige, aber grundanständige und in ihren Gefühlen reinliche Pepi weitaus lieber und begehrenswerter ist als die wunderschöne, sehr interessante, raffinierte Französin. Momentan warte ich (sehr nervös allmählich, weil schon eine viertel Stunde über die verabredete Zeit verstrichen ist) auf Pepis telefonischen Anruf, die mich für heute zu sich einladen will. Versetzt sie mich, so würde ich sehr ungehalten sein, und alles versuchen, Jeanne ins Bett zu bekommen. – Wir – Jeanne, Thesing und ich – gingen also dann in die Torggelstube Abendbrot essen, und ich dann allein ins Residenztheater, wo ich den ersten Teil von Strindbergs „Totentanz“ sah. Ein unglaublich genialer Kerl, dieser Strindberg. Es ist ganz gewaltig, wie er dieses furchtbare Aneinandergeschmiedetsein der Ehe aufzeigt. Ein Stimmungs- und Schicksalsbild von schauerlicher Gewalt. Steinrück wieder ganz mächtig. Jacobsohn wollte mich damals verhöhnen, als er höhnisch über Steinrück schrieb: Das ist also der Münchner Mitterwurzer! – Ich habe Mitterwurzer nicht mehr gekannt, kann mir aber kaum noch denken, daß er größer als Steinrück gewesen wäre. Die Dandler und B. v. Jacobi waren vielleicht nicht so schlecht wie sie schienen. Steinrück drückte sie einfach an die Wand. Gegen dessen Meisterschaft zu bestehn, dazu gehören Größere. Heut abend sehe ich den zweiten Teil. –
Nachher ging ich kegeln. Das tat mir nach der Aufregung des Strindberg-Stücks wohl. Später mit Halbe und den andern zu Kati Kobus. Ein Freund von Wilm war da, ein Herr Dümling, Großkaufmann aus dem Anhaltischen. Ich überlege, ob ich ihn nicht wegen des „Kains“ herankriegen sollte.
Die Post brachte den neuen „Sozialist“. Landauer publiziert darin eine Neuformulierung der 12 Artikel des Sozialistischen Bundes, die mir aber kaum besser, mindestens weniger eindringlich scheint, als die erste Fassung. Ferner eine neue Nummer des „Pan“, der unter W. Freds Redaktion reichlich langweilig geworden ist. Die „Schaubühne“, die meinen Artikel „Volksfestspiele“ aus dem Kain-Kalender an der Spitze des Blattes abdruckt. Ferner eine Karte von Onkel Leopold. Er schreibt, daß Papa krank sei. Auch Grethe hat schon davon berichtet, aber so, daß ich nur an einen Influenza-Anfall glaubte. Nach Onkels Bericht scheint sein Unwohlsein aber wieder mit den Herzen zusammenzuhängen. Diese Bedrängungen häufen sich doch in den letzten zwei Jahren so, daß man sich doch wohl bald auf eine Katastrophe gefaßt halten muß. Ich will nicht weibisch und nicht verlogen sein: Jawohl, ich wünsche diese Katastrophe! Weil ich sie um meiner Kunst, um meiner Aufgaben willen wünschen muß! – Mögen spätere Leser dieser Blätter diese Empfindung für Rohheit halten. Ich weiß, daß die Ehrlichkeit, mit der ich sie ins Bewußtsein hole, anständig ist.
Felix Dahn ist gestorben. 78 Jahre alt. Nach meinem Gefühl müßte er längst 90 gewesen sein. Sein teutsches Geschmetter war mir von jeher in der Seele widerlich. Sein Tod ändert nichts am Bestand der Kultur von heute. Wieder einer, der seine Zeit weit überlebt hat.
Pepi hat immer noch nicht angeklingelt. Ich überlege, ob ich nicht einfach zu ihr fahren soll.
München, Freitag, d. 5. Januar 1912.
Mein altes Pech hat sich wieder glänzend bewährt. Peppi meldete sich nicht mehr, und als ich dann per Auto hinunterfuhr zur ihr – ein blödsinniges Ende –, war sie vor zwei Minuten weggegangen. So ging ich betrübt ins Stefanie und verlor an Uli Geld im Domino. Dann mit Uli ins Residenztheater. 2ter Teil von Strindbergs „Totentanz“. Steinrück so herrlich, daß alle andern daneben verschwanden. Übrigens war die Michalek ganz leidlich, besser jedenfalls, als ich sie zuvor je sah. Torggelstube. Ich saß lange allein. Endlich kam eine Dame, die ich nicht kannte. Sie setzte sich mit stummem Gruß an die andre Ecke des Tisches. Die Situation wurde mir ungemütlich, und ich zahlte. Aber eben wollte ich gehn, da kamen Weigert, Eyssler, Gotthelf und Strauß. Jetzt stellte sich heraus, daß das Mädel Gotthelfs Verhältnis, das Lottchen vom Gärtnerplatztheater, war. Ich hatte sie nicht erkannt gehabt. Man wollte zu Benz fahren, da ich aber Jeanne noch zu treffen hoffte, lehnte ich ab, mitzufahren. Im letzten Moment, als wir gingen, erzählte mir Lottchen, daß sie mit Peppi zusammen gekommen sei, die sich hinüber ins Café Orlando gesetzt habe. Ich stürzte hin. Sie war schon weg. Ich schrieb ihr, sie möge mich heut nachmittag antelefonieren. Auch das tat sie nicht. Unbegreiflich. Ich glaubte wirklich, sie habe mich lieb. Auch Jeanne verfehlte ich, und ging dann etwas traurig in den Simplizissimus. Dort traf ich May Keller mit einer lesbischen Freundin, deren Bekanntschaft ich machte. Eine sehr maskuline, aber schöne Person, intelligent, frei und sympathisch. Ich begleitete die Frauen dann noch heim zur Pension Führmann. Wir mußten uns Keyserlings Begleitung dabei gefallen lassen. Der fragte mich um Rat wegen der Faschingszeitschrift „Abel“. Ich verwies ihn an meine Feinde, speziell an Karl Kraus in Wien. Unter zwei Frauen hatte ich geglaubt, auswählen zu dürfen. Beide sah ich nicht einmal, und mußte mich mit den Küssen des Dienstmädchens, in der Droschke mit einem Kuß von Uli, und im „Simpl.“ mit einem von Mary Irber begnügen. Heut abend soll ich Thesing und Jeanne im Café treffen. Bin gespannt. – Eben komme ich aus dem Caféhause vom Schachspiel. Meyrink redete tolles Zeug daher, schimpfte über die Kunst der alten Griechen, erklärte Rafael für fast so blöd wie Goethe, und fand, daß die griechische Literatur von Schimpansen geschrieben sein müsse. Das alles aber so geistreich, pointiert und aus einem klaren, wenn auch schiefen Weltbild heraus begründet, daß man sich amüsiert, ohne böse zu sein. Jetzt muß ich fort zur Gruppe Tat.